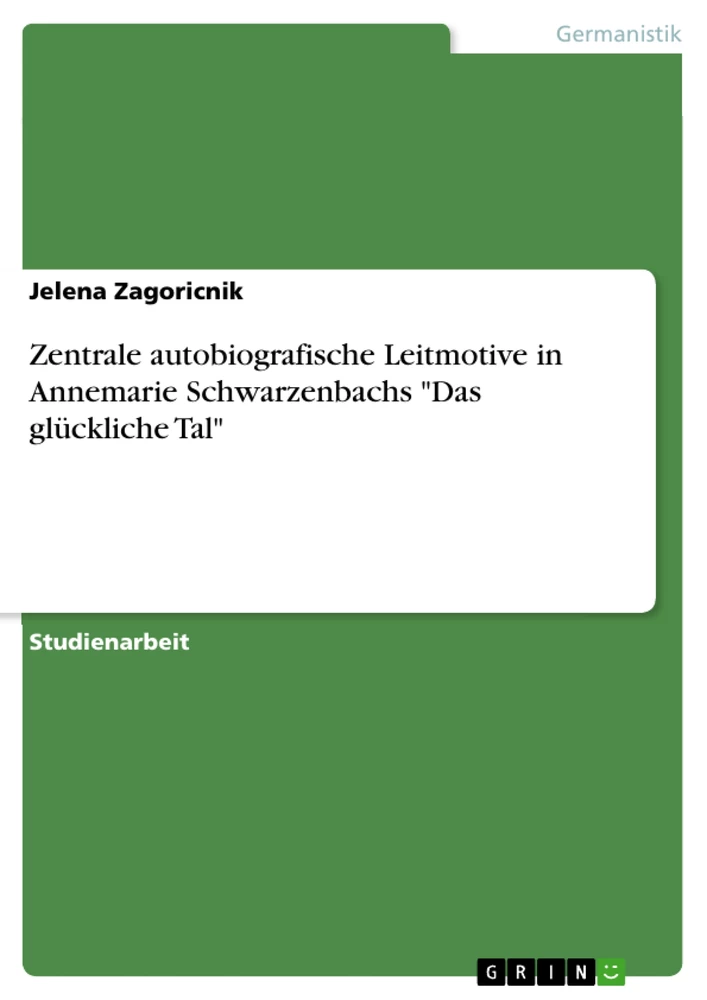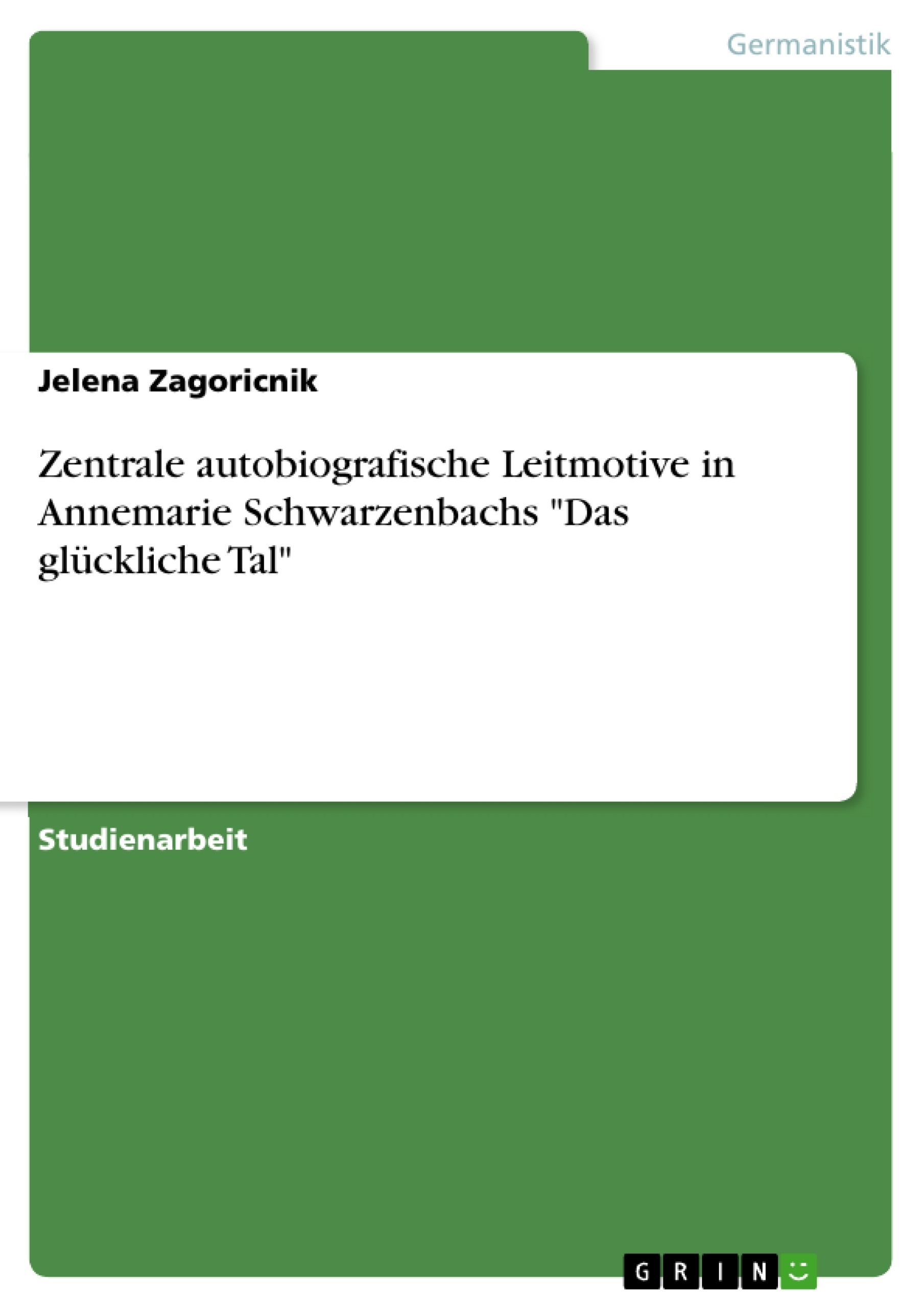Wie Klara Obermüller in Annemarie Schwarzenbachs Gedächtnisrede im Jahr 2008 bereits sagte, „gibt [es] in der Schweizer Literatur der letzten 100 Jahre kaum einen Autor – und schon gar keine Autorin -, über die mehr geforscht, geschrieben und publiziert worden wäre als über Annemarie Schwarzenbach.“ Trotz des schlagartig grossen Interesses an Schwarzenbachs Leben und Werk, seit ihrer Wiederentdeckung 1987, schrieben Schweizer Germanisten bisher im Schnitt dennoch weniger über sie, als solche aus Belgien, Deutschland, Italien, Kanada und Portugal.
Die Faszination an Annemarie Schwarzenbach gründet vor allem auf ihrer aussergewöhnlichen und tragischen Biografie, die geprägt ist von Konflikten mit Familie und Freunden, ihren exotischen Reisen, Homosexualität, Drogenmissbrauch und ihrem plötzlichen Tod, welche sie „im Verlaufe der Jahre zur Kultfigur“ heraushob.
Mehrere Forscher, wie Walter Fähnders, Sabine Rohlf und Klara Obermüller, bedauern die Tatsache, dass der Reiz Schwarzenbachs Werke – wie vor allem Tod in Persien und Das glückliche Tal – allein biografisch zu deuten so stark geworden sei, dass den Werken als autonomen Texten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde. Dennoch betonen auch sie, dass „Annemarie Schwarzenbachs literarische Arbeiten […] aus ihrer Biographie schöpfen“, und dass gerade bei ihrer Reiseprosa „das Autobiografische und das Schreiben sehr eng beieinander zu liegen scheinen“, was schon allein mit dem Genre der Reiseliteratur begründbar ist.
Doch welches sind die Ereignisse, Emotionen und Motive, die Schwarzenbach so stark beschäftigten, dass sie sie in ihre Werke einfliessen liess und weshalb unternimmt sie dies immer wieder von Neuem? Wieso kommt das autobiografische Schreiben gerade in den beiden Werken Tod in Persien und Das glückliche Tal so stark zum Vorschein? Um diese Fragen beantworten zu können, sollen in der folgenden Arbeit zentrale Leitmotive in Annemarie Schwarzenbachs Werk Das glückliche Tal auf ihren autobiografischen Gehalt hin untersucht werden, wobei sein Vorläufer Tod in Persien stellenweise als Stütze benutzt werden soll. Weil eine detaillierte Darstellung der Biografie Annemarie Schwarzenbachs zu viel Raum in Anspruch genommen hätte, wurde diese in tabellarischer Form zur Übersicht hinten im Anhang zusammengefasst, da diese im Zusammenhang dieser Arbeit dennoch unerlässlich ist; ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Tod in Persien und Das glückliche Tal
- 1.1. Entstehungsrahmen von Tod in Persien
- 1.2. Entstehungsrahmen von Das glückliche Tal
- 1.3. Das Genre des glücklichen Tals
- 2. Autobiografische Leitmotive in Das glückliche Tal
- 2.1. Reisen, Ungeduld und Freiheitsdrang
- 2.2. Flucht und Verbannung
- 2.3. Aussenseitertum oder „Am Rande der Welt"
- 2.4. Heimweh und die Unmöglichkeit der endgültigen Heimkehr
- 2.5. Drogen und Magie
- 2.6. Sprache und Schreiben
- Fazit
- Bibliografie
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die zentralen autobiografischen Leitmotive in Annemarie Schwarzenbachs Werk „Das glückliche Tal“ und untersucht, wie diese Motive mit ihrer Biografie in Verbindung stehen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des autobiografischen Schreibens in Schwarzenbachs Werk aufzuzeigen und die Frage zu beantworten, warum diese Motive in ihren Werken so prominent erscheinen.
- Reisen und Freiheitsdrang
- Flucht und Verbannung
- Aussenseitertum und Heimweh
- Drogen und Magie
- Sprache und Schreiben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Entstehungsgeschichte von „Tod in Persien“ und „Das glückliche Tal“, zwei Werken, die auf Schwarzenbachs Reisen in den Orient basieren. Die Einleitung beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Werken und stellt den Kontext für die Analyse der autobiografischen Leitmotive in „Das glückliche Tal“ dar.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Entstehungsrahmen von „Tod in Persien“ und „Das glückliche Tal“. Es beleuchtet die biografischen Hintergründe der beiden Werke und analysiert die Rolle, die Schwarzenbachs Reisen, ihre Ehe und ihre psychischen Probleme in der Entstehung der Werke spielten.
Das zweite Kapitel untersucht die zentralen autobiografischen Leitmotive in „Das glückliche Tal“. Es analysiert die Motive Reisen, Ungeduld und Freiheitsdrang, Flucht und Verbannung, Aussenseitertum, Heimweh, Drogen und Magie sowie Sprache und Schreiben. Die Analyse zeigt, wie diese Motive mit Schwarzenbachs eigener Lebensgeschichte und ihren persönlichen Erfahrungen in Verbindung stehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Annemarie Schwarzenbach, „Das glückliche Tal“, „Tod in Persien“, autobiografisches Schreiben, Reisen, Freiheitsdrang, Flucht, Verbannung, Aussenseitertum, Heimweh, Drogen, Magie, Sprache, Schreiben, Biografie, Literaturanalyse.
- Quote paper
- Jelena Zagoricnik (Author), 2013, Zentrale autobiografische Leitmotive in Annemarie Schwarzenbachs "Das glückliche Tal", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278360