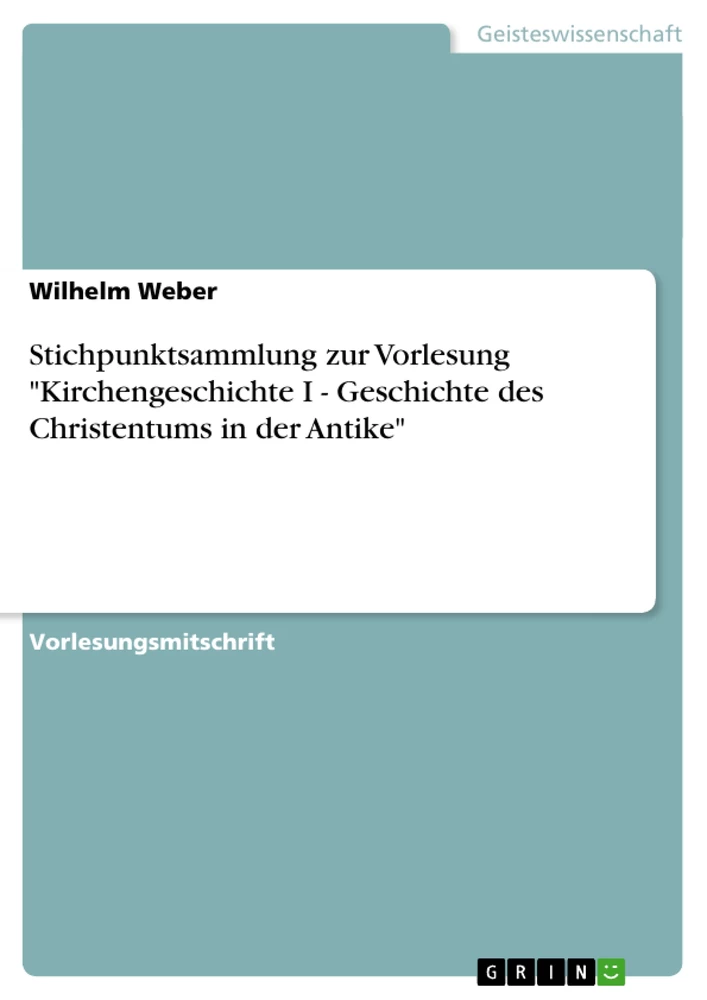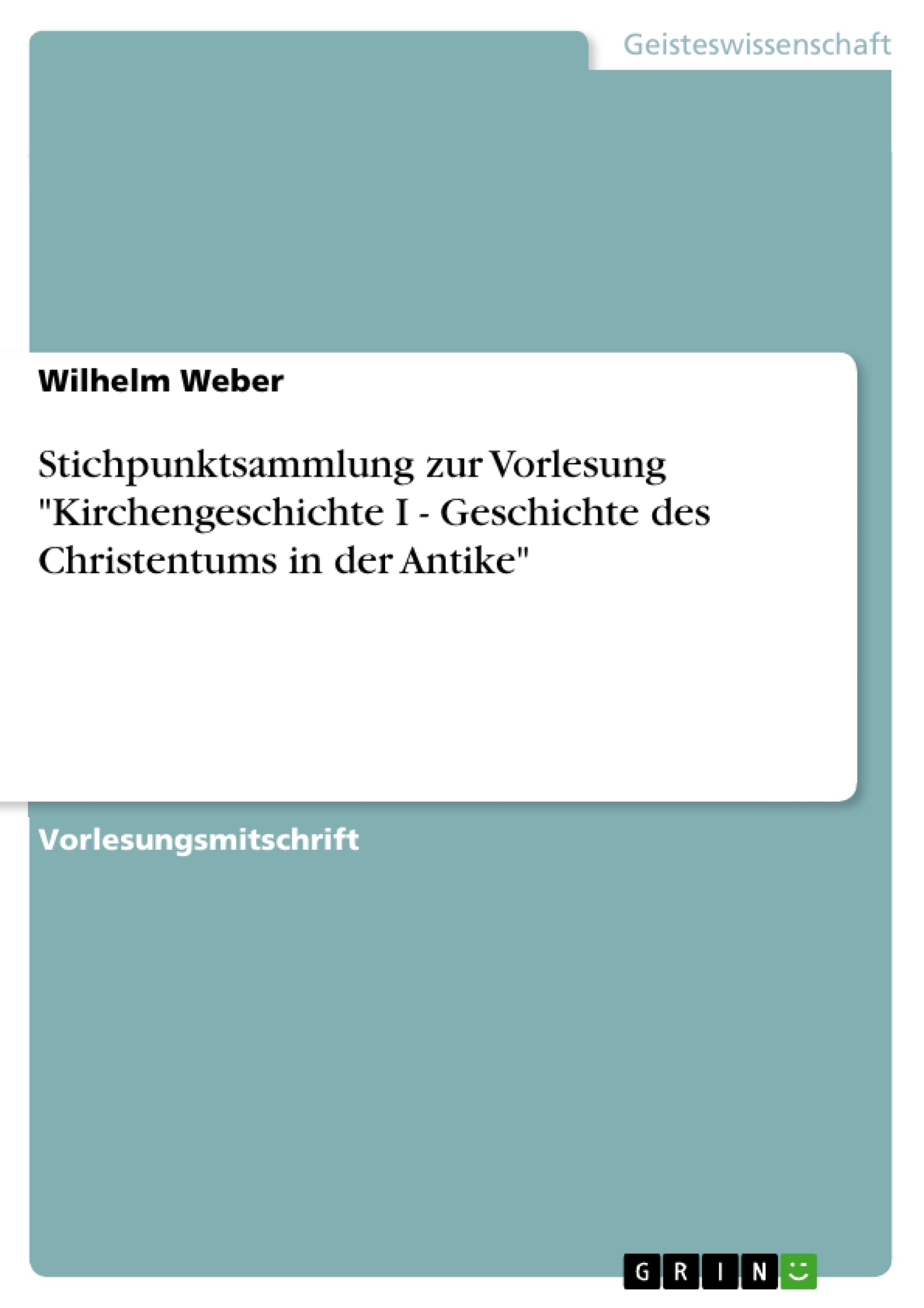Kommentar zur besagten Vorlesung; aus dem Vorlesungsverzeichnis: "Die Vorlesung vermittelt einen Einblick in die Geschichte des Christentums in der griechisch-römischen Antike. Vom Urchristentum über die konstantinische Wende bis an den Vorabend der Völkerwanderung werden die geschichtlichen Hauptereignisse, die wichtigsten Persönlichkeiten und die gestaltenden Kräfte beschrieben, die den Weg der christlichen Kirche bestimmt haben."
Inhaltsverzeichnis
- Unterschied Frühchristentum/Alte Kirche
- Die Alte Kirche bei Luther
- Vorgeschichte: Humanismus
- Laienbewegung
- Weltliche Themen: Stadtgeschichte, Künstlerbiografien
- kritischer Blick auf die Geschichte (Laurentius Valla)
- Hinwendung zu den Quellen (,,ad fontes")
- emanzipatorische Bedeutung
- Erasmus von Rotterdam (gest. 1536)
- Edition der Kirchenväter
- Neuausgabe des gr. NT
- Unterscheidung zw. Welt- und Kirchengeschichte
- Geschichte als eigenständige Disziplin (Main 1504)
- Martin Luthers Geschichtssicht
- keine eigene Geschichtsdarstellung
- Interesse an Geschichte in Auseinandersetzung mit Rom
- Geschichtsdeutung im Dienst der Theologie
- Christus als kritischer Maßstab (,,solus Christus")
- Abs. 1:
- Quellentext: E. von Caesarea - Über die Kirchengeschichte
- Äußerung des Entschlusses zur schriftlichen Fixierung der Kirchengeschichte mit allen Höhen und Tiefen
- Abs. 2
- Eingestehen nicht fehlerfreien Arbeitens
- Feststellung der erstmaligen Abfassung einer Kirchengeschichte
- Verlassen auf Gottes Führung in der kirchenhistorischen Forschung
- Kompilation seriöser Quellen mit kirchengeschichtlicher Relevanz
- Entschluss der historischen Aufarbeitung von der apostolischen Sukzession vor allem anhand schriftlicher Quellen
- Objektivität wahrend
- für nachfolgende Generationen tauglich
- Hoffnung von der Nützlichkeit der schriftlich fixierten Kirchengeschichte für spätere Generationen
- Abs. 3
- Wirken Jesu Christi als Anfangspunkt
- Lehren Christi als Basis aller kirchlichen Dogmen
- Zeitgenossen Christi mit der Unfähigkeit zur Erkenntnis seiner Lehren
- Zeitgenossen Christi als verstockt und uneinsichtig dargestellt
- Erkenntnis seiner Lehren erst durch späteren Generation infolge der auẞerisraelitischen Verbreitung
- Worte Gottes und Lehren Christi von da an für die gesamte Menschheit zugänglich
- unentbehrliche Basis des Guten in der Welt und für das Heil bzw. den Frieden unter allen Menschen
- Verdienste, Lehren, Wirken und Leben Christi als vorherbestimmter Weg zum Wohle der Menschen
- Legitimation vom Ursprung her
- im engeren Sinne: die Lehrmeinung
- Beginn der Kirchengeschichte: mit den Pfingstereignissen
- Kirche als Schöpfung Gottes und somit ewig existierend
- Kirche(n)
- Antike Welt ←→ Christentum
- Hell.-röm. Kultur ←→ Römerreich
- Alte Kirche ←→ frühe Christenheit
- Antike → Mittelalter
- 1500: Reformation
- Papstkirche
- Urchristentum
- Alte Kirche
- Kirchenväter
- Mittelalterliche Kirchengeschichtsschreibung
- keine historische Entfaltung
- sondern,,mythische Gesamtschau" der Weltgeschichte:
- Vorstellung der sieben Weltzeitalter (Gen 1; Ps 90,4)
- Vorstellung der vier Weltreiche (Daniel 2)
- Neue Themen: Heilige, Klöster, Bistümer, Völker
- 2,Der Neuansatz von Joachims von Fiore
- Leben:
- geb. in Celico/Kalabrien 1135
- Bekehrung (,,conversio") zum monastischen Leben
- Pilgerfahrt nach Jerusalem 1166/67
- Abt des Benediktinerklosters Corazzo
- Neugründung von San Giovanni in Fiore 1189
- gest. 1202
- Werk:
- ,,Liber de cocordia Novi ac Veteris Testamenti" (1191)
- ,,Expositio in Apocalypsim" (1196)
- Trinitarische Gliederung der Geschichte:
- Zeitalter des Vaters (Gesetz)
- Zeitalter des Sohnes (Gnade)
- Zeitalter des Geistes (Liebe)
- Kirchenkritischer Gedanke:
- im Mönchstum sich ankündigende Geistkirche die Priesterkirche ablösend
- Joachim das Zeitalter des Geistes für 1260 erwartend
- Eusebius von Caesarea
- ,,Vater der Kirchengeschichtsschreibung“
- Leben
- geb. in Palästina 263/265
- theologische Ausbildung in Schule von Caesarea
- während kaiserlicher Verfolgung nach Ägypten 303
- Rückkehr nach Palästina 313
- Wahl zum Bischof von Caesarea
- Berufung zum kaiserlichen Berater (,,Vita Constanini")
- gest. 339/340
- Werk
- apologetische, exegetisch und dogmatische Schriften
- historische Schriften:
- Chronik (303)
- Über die Märthyrer von Palästina (303-311)
- Kirchengeschichte (311-324)
- Geschichtsprogramm
- Sicherung der Apostelnachfolge (,,successio apostolica")
- Häresie Einheit der Kirche bedrohend
- Bischöfe als Garanten der sichtbaren Kontinuität
- Geschichte Israels Erwählung der Kirche belegend
- Verfolgung der Christen Standhaftigkeit der Kirche zeigend
- Christliche Gemeindebildung
- Jakobus als Leiter der Urgemeinde mit alternativem Modell
- innerhalb in den Grenzen des Römischen Reiches
- jüdische Gemeinden dazugehörend
- jüdische Diaspora
- jüdische Mission in Kleinasien stattfindend
- Ausbreitung bis in den Mittelmeerraum
- Christliche Mission im Mittelmeerraum
- Nutzung römischer Verkehrswege
- Missionierung vor allem im urbanen Raum
- bes. an paulinischen Briefen erkennbar
- Rahmenbedingungen der Mission
- Adolf v. Harnack: „Ein Imperium, eine Weltsprache, ein Verkehrsnetz, eine gemeinsame Entwicklung zum Monotheismus und eine gemeinsame Sehnsucht nach Heilanden." (Die Mission und Ausbreitung des Christentums, Bd. 1, S.27)
- Römisches Reich als christlicher Handlungsraum: Bewusstsein der Überlegenheit, Verbreitung jüdischer Gemeinden; städtische Zentren
- Frühe Christenheit als städtische Religion
- (Koine-)Griechisch als gemeinsame Sprache; keine Sprachbarrieren; Beschränkung auf Städte
- Volkssprachen auf dem Land
- Tertullian als erster lateinischer Theologe
- Frühchristliche theologische Werke auf Altgriechisch
- Infrastruktur: einheitliches Verkehrsnetz (Straßen, Schiffswege) im Mittelmeerraum für Handel, Militär, Verwaltung,Hellenistische (Stadt-)Kultur: Mischkultur unter Einbeziehung gr. Und nationaler Kulturen
- Entwicklung zum Monotheismus:,,Toleranz des Götterglaubens; Verehrung der höchsten Gottheit (Jupiter); Polytheismus als ausdifferenzierter Monotheismus
- Erlösungssehnsucht: Sehnsucht nach Heilanden, Wiederbelebung der altrömischen Religion, Aufkommen des Kaiserkultes
- Schwerpunkte der Mission
- Kleinasien:
- Zentrum christlicher Mission (Ephesus), Verbreitung in Stadt und Land, Absorbation heidnischer Kulte (Plinius)
- Ägypten:
- Philosophisches Christentum (christianisierte Gnosis), hellenistisches Judentum (Philo)
- Katechetenschule in Alexandrien
- Italien
- Alte christliche Gemeinde in Rom (Römerbrief), Verfolgung unter Nero (64), bischöfliches Führungsbewusstsein (Ignatius; Clemens)
- Afrika
- Missionierung von Rom; Christen auf dem Land (Scili); Zentrum: Karthago (Tertullian, Cyprian); Ausbreitung im 3. Jh.
- Gallien
- Legendarischer Ursprung; Mission von Kleinasien (Irenäus), Zentrum im Süden: Marseille, Lyon, Vienne (Rhonetal)
- Spanien
- Paulus in Spanien (Kanon Muratori)?, Gemeinden erst seit Ende 2. Jh.; keine Personen bekannt; strenge Ethik (Synode von Elvira)
- Themen an der Wende zum 2. Jahrhundert
- Abstand zum Ursprung deutlicher geworden
- Gedanke der endlichen Welt
- Zurücktreten der Naherwartung
- Paulus vor allem am himmlischen Christus interessiert
- Kirche erstmals in der Apg dargestellt
- wachsende Distanz zum Ursprung
- sich historisch identifizierende Kirche
- Aufkommen enthusiastischer Strömungen
- Behauptung als eigenständige Religion
- Gestaltung des Gemeindelebens
- eher praktisches Interesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Geschichte der Alten Kirche und beleuchtet die Entwicklung des Christentums von seinen Anfängen bis zum Mittelalter. Dabei werden die wichtigsten Ereignisse, Personen und Strömungen dieser Epoche behandelt und in ihren historischen Kontext eingeordnet. Der Text analysiert die Entstehung und Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich, die Entwicklung der christlichen Lehre und die Herausforderungen, denen die Kirche in dieser Zeit begegnete.
- Die Entstehung und Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich
- Die Entwicklung der christlichen Lehre und Theologie
- Die Herausforderungen, denen die Kirche in der Antike begegnete
- Die Rolle der Kirchenväter in der Entwicklung des Christentums
- Die Bedeutung der Kirchengeschichtsschreibung für das Verständnis des Christentums
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den Unterschied zwischen Frühchristentum und Alter Kirche sowie die Bedeutung der Kirchengeschichte für Martin Luther beleuchtet. Anschließend wird die Vorgeschichte des Humanismus und die Laienbewegung im Kontext der Kirchengeschichte dargestellt. Der Text analysiert den kritischen Blick auf die Geschichte durch Laurentius Valla und die Hinwendung zu den Quellen (,,ad fontes"). Die Bedeutung von Erasmus von Rotterdam und seine Edition der Kirchenväter sowie die Neuausgabe des griechischen Neuen Testaments werden ebenfalls behandelt. Der Text beleuchtet die Unterscheidung zwischen Welt- und Kirchengeschichte und die Entwicklung der Geschichte als eigenständige Disziplin. Die Geschichtssicht von Martin Luther und seine Auseinandersetzung mit Rom werden ebenfalls analysiert.
Im zweiten Kapitel wird die Kirchengeschichtsschreibung des Mittelalters behandelt. Der Text analysiert die Vorstellung der sieben Weltzeitalter und der vier Weltreiche sowie die neuen Themen, die in der mittelalterlichen Kirchengeschichtsschreibung auftauchen, wie Heilige, Klöster, Bistümer und Völker.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Neuansatz von Joachims von Fiore. Der Text beleuchtet sein Leben, seine Werke und seine trinitarische Gliederung der Geschichte. Der kirchenkritische Gedanke von Joachim von Fiore und seine Erwartung des Zeitalters des Geistes werden ebenfalls behandelt.
Das vierte Kapitel widmet sich Eusebius von Caesarea, dem ,,Vater der Kirchengeschichtsschreibung". Der Text analysiert sein Leben, seine Werke und sein Geschichtsprogramm. Die Sicherung der Apostelnachfolge (,,successio apostolica") und die Bedeutung der Häresie für die Einheit der Kirche werden ebenfalls behandelt.
Das fünfte Kapitel behandelt die christliche Gemeindebildung. Der Text analysiert die Rolle von Jakobus als Leiter der Urgemeinde und die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich. Die Rahmenbedingungen der Mission und die Bedeutung des Römischen Reiches als christlicher Handlungsraum werden ebenfalls beleuchtet.
Das sechste Kapitel befasst sich mit den Themen an der Wende zum 2. Jahrhundert. Der Text analysiert den wachsenden Abstand zum Ursprung des Christentums, die Entwicklung der Kirche als eigenständige Religion und die Gestaltung des Gemeindelebens.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Alte Kirche, das Frühchristentum, die Kirchengeschichte, die Kirchenväter, die Entwicklung der christlichen Lehre, die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich, die Herausforderungen der Kirche in der Antike, die Bedeutung der Kirchengeschichtsschreibung, der Humanismus, die Laienbewegung, die Hinwendung zu den Quellen (,,ad fontes"), Erasmus von Rotterdam, Martin Luther, die mittelalterliche Kirchengeschichtsschreibung, Joachim von Fiore, Eusebius von Caesarea, die christliche Gemeindebildung und die Themen an der Wende zum 2. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt als der Vater der Kirchengeschichtsschreibung?
Eusebius von Caesarea gilt als der Vater der Kirchengeschichtsschreibung. Er verfasste zwischen 311 und 324 n. Chr. die erste umfassende Kirchengeschichte.
Was bedeutet das Prinzip „ad fontes“ im Kontext der Kirchengeschichte?
„Ad fontes“ bedeutet die Hinwendung zu den ursprünglichen Quellen. Im Humanismus und bei Erasmus von Rotterdam führte dies zu einer kritischen Neu-Edition der Kirchenväter und des griechischen Neuen Testaments.
Wie deutete Martin Luther die Kirchengeschichte?
Luther nutzte die Geschichte vor allem in der Auseinandersetzung mit Rom. Für ihn war Christus der kritische Maßstab („solus Christus“), und die Geschichtsdeutung stand im Dienst der Theologie.
Was ist die trinitarische Geschichtsgliederung nach Joachim von Fiore?
Joachim von Fiore gliederte die Geschichte in drei Zeitalter: das Zeitalter des Vaters (Gesetz), des Sohnes (Gnade) und des Geistes (Liebe).
Welche Faktoren begünstigten die Ausbreitung des frühen Christentums im Römischen Reich?
Wichtige Faktoren waren das einheitliche Imperium, die Weltsprache Griechisch (Koine), das römische Verkehrsnetz sowie eine allgemeine Sehnsucht nach Erlösung und Heilanden.
Wann beginnt nach traditioneller Auffassung die Kirchengeschichte?
Die Kirchengeschichte beginnt im engeren Sinne mit den Pfingstereignissen, wobei die Kirche theologisch oft als ewige Schöpfung Gottes betrachtet wird.
- Citar trabajo
- stud.phil. Wilhelm Weber (Autor), 2011, Stichpunktsammlung zur Vorlesung "Kirchengeschichte I - Geschichte des Christentums in der Antike", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278367