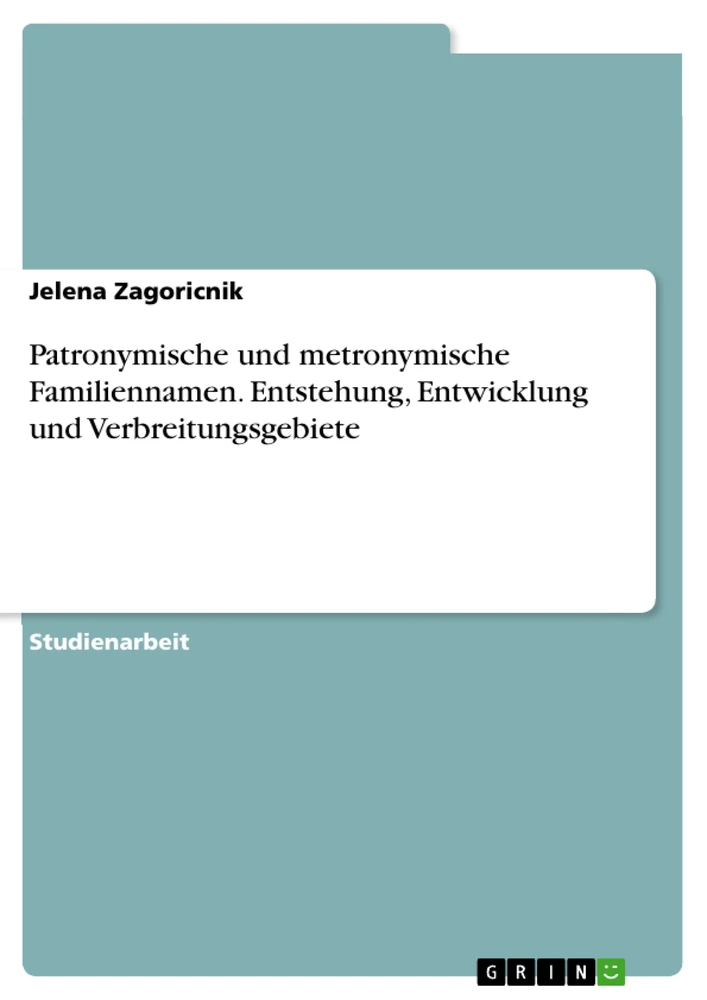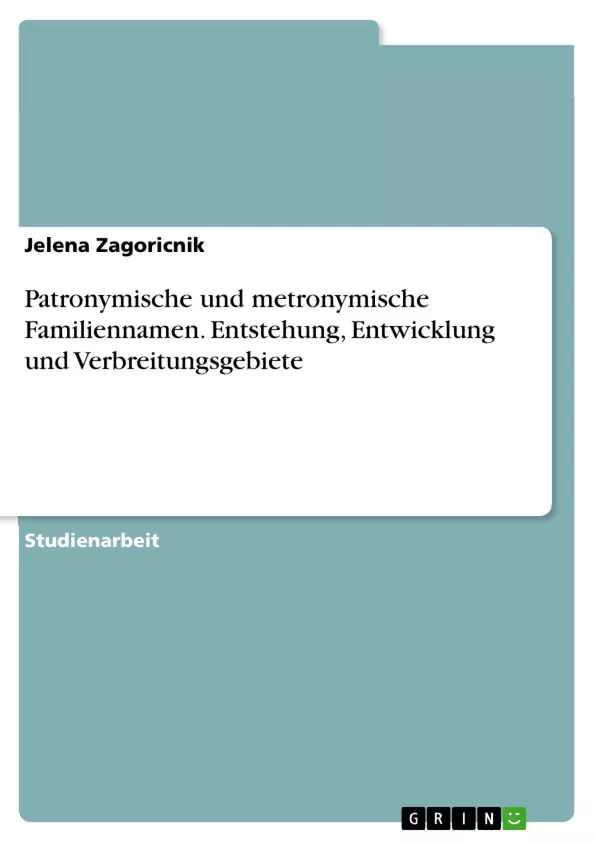In der folgenden Arbeit sollen die Entstehung, Entwicklung und die Verbreitungsgebiete patronymischer und metronymischer Familiennamen aufgezeigt werden. Dazu wird in einem ersten Schritt die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Familiennamen im germanischen Sprachgebiet behandelt werden. Um diesen Entwicklungsverlauf in seiner vollen Ganzheit erfassen zu können, sollen zunächst die Hauptgründe veranschaulicht werden, welche für den Übergang vom einnamigen zum zweinamigen Personennamensystem verantwortlich waren.
In einem zweiten Schritt soll die Familiennamenbildung aus Rufnamen (Patronymie / Metronymie) ausgehend vom patronymischen Beinamen, über sekundäre Patronymika bis zum patronymischen Familiennamen aufgezeigt werden, um den Prozess der Ausformung nachvollziehen zu können. Hierbei werden auch die konkreten Bildungsarten deutscher Patronymika und Metronymika mit all ihren Eigentümlichkeiten erörtert, um dem Leser die Fülle an verschiedenen patronymischen Familiennamenarten zu demonstrieren; dabei soll im Unterkapitel 3.2.3. auch auf fremdsprachige Patronymika eingegangen werden.
Im Kapitel 4 sollen schliesslich die spezifischen Verbreitungsgebiete der verschiedenen Patronymika-Arten im germanischen Sprachraum in der gleichen Reihenfolge veranschaulicht werden, in welcher sie schon im vorherigen Kapitel aufgezeigt wurden, um sich ein Bild von der geographischen Konzentrierung der jeweiligen patronymischen Familiennamen machen zu können. Zur Illustrierung sind dazu im Anhang diverse Karten und Diagramme abgebildet, welche sich auf konkrete Beispiele dieser Arbeit beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung und Entwicklung der Familiennamen im germanischen Sprachraum
- 2.1. Übergang vom einnamigen zum zweinamigen Personennamensystem
- 3. Familiennamenbildung aus Rufnamen (Patronymie/Metronymie)
- 3.1. Patronymika als Beinamen
- 3.2. Patronymika/Metronymika als Familiennamen
- 3.2.1. Bildungsarten von Patronymika
- 3.2.2. Bildungsarten von Metronymika
- 3.2.3. Bildungsarten von Patronymika/Metronymika in anderen Nationen
- 4. Verbreitungsgebiete der Patronymika/Metronymika im germanischen Sprachraum
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung patronymischer und metronymischer Familiennamen im germanischen Sprachraum. Das Ziel ist es, den Prozess der Namensbildung von der Einnamigkeit zum Zweinamensystem nachzuvollziehen und die geographische Verteilung verschiedener patronymischer Familiennamen aufzuzeigen.
- Übergang vom einnamigen zum zweinamigen Personennamensystem
- Familiennamenbildung aus Rufnamen (Patronymie/Metronymie)
- Bildungsarten von Patronymika und Metronymika
- Verbreitung von Patronymika und Metronymika im germanischen Sprachraum
- Entwicklung patronymischer Beinamen zu Familiennamen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung patronymischer und metronymischer Familiennamen im germanischen Sprachraum. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die einzelnen Kapitel und deren Schwerpunkte. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Entwicklungsprozesses von Beinamen zu etablierten Familiennamen und der geographischen Verteilung dieser Namen.
2. Entstehung und Entwicklung der Familiennamen im germanischen Sprachraum: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel vom einnamigen zum zweinamigen Personennamensystem im germanischen Sprachraum. Es analysiert die Ursachen dieses Wandels, die von rechtlichen Erwägungen (Erbrecht), steigender Bevölkerungsdichte und der Entwicklung einer komplexeren schriftlichen Verwaltung beeinflusst wurden. Der Fokus liegt auf der Entstehung von Beinamen als Vorläufer der Familiennamen und deren Bedeutung für die soziale und administrative Organisation. Die zunehmende Notwendigkeit zur Unterscheidung von Personen mit gleichen Rufnamen in einer wachsenden Bevölkerung wird als wichtiger Faktor für die Entwicklung von Beinamen herausgestellt.
3. Familiennamenbildung aus Rufnamen (Patronymie/Metronymie): Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der Bildung von Familiennamen aus Rufnamen (Patronymie und Metronymie). Es untersucht die Entwicklung von Patronymika als Beinamen zu etablierten Familiennamen, untersucht verschiedene Bildungsarten deutscher Patronymika und Metronymika und beleuchtet deren Besonderheiten. Die Diskussion umfasst sowohl die deutschen als auch die fremdsprachigen Varianten. Das Kapitel zeigt die Vielfalt der patronymischen Familiennamen auf und erklärt die Mechanismen ihrer Entstehung und Verbreitung.
4. Verbreitungsgebiete der Patronymika/Metronymika im germanischen Sprachraum: Dieses Kapitel widmet sich der geographischen Verteilung verschiedener Arten von Patronymika im germanischen Sprachraum. Die Verbreitung der verschiedenen Formen wird im Kontext ihrer Entstehung und Entwicklung dargestellt. Die Kapitel befasst sich mit der geographischen Konzentration bestimmter patronymischer Familiennamen und deren regionaler Spezifität. (Hinweis: Der Text erwähnt Karten und Diagramme im Anhang, die hier nicht reproduziert werden können.)
Schlüsselwörter
Patronymika, Metronymika, Familiennamen, Namensforschung, germanischer Sprachraum, Beinamen, Einnamigkeit, Zweinamigkeit, Bevölkerungsentwicklung, schriftliche Verwaltung, geographische Verbreitung.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Entstehung und Entwicklung patronymischer und metronymischer Familiennamen im germanischen Sprachraum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung von Familiennamen, die von Rufnamen abgeleitet sind (Patronymika und Metronymika), im germanischen Sprachraum. Sie verfolgt den Prozess der Namensbildung vom einnamigen zum zweinamigen System und analysiert die geographische Verteilung dieser Namen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Übergang vom einnamigen zum zweinamigen Personennamensystem, die Bildung von Familiennamen aus Rufnamen (Patronymie/Metronymie), verschiedene Bildungsarten von Patronymika und Metronymika (inklusive internationaler Beispiele), die Verbreitungsgebiete dieser Namen im germanischen Sprachraum und die Entwicklung patronymischer Beinamen zu Familiennamen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Entstehung und Entwicklung der Familiennamen im germanischen Sprachraum, Familiennamenbildung aus Rufnamen (Patronymie/Metronymie), Verbreitungsgebiete der Patronymika/Metronymika im germanischen Sprachraum und Schlusswort. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Was wird im Kapitel zur Entstehung und Entwicklung der Familiennamen beschrieben?
Dieses Kapitel analysiert den Wandel vom einnamigen zum zweinamigen System, die Ursachen dieses Wandels (rechtliche Erwägungen, Bevölkerungsdichte, schriftliche Verwaltung), die Entstehung von Beinamen als Vorläufer der Familiennamen und deren Bedeutung für die soziale und administrative Organisation.
Was ist der Fokus des Kapitels zur Familiennamenbildung aus Rufnamen?
Der Fokus liegt auf der detaillierten Betrachtung der Bildung von Familiennamen aus Rufnamen (Patronymie und Metronymie). Es werden verschiedene Bildungsarten deutscher und fremdsprachiger Patronymika und Metronymika untersucht und deren Besonderheiten erläutert.
Was wird im Kapitel zur Verbreitung der Patronymika/Metronymika behandelt?
Dieses Kapitel widmet sich der geographischen Verteilung verschiedener Arten von Patronymika im germanischen Sprachraum, ihrer Konzentration in bestimmten Regionen und ihrer regionalen Spezifität. (Karten und Diagramme, die im Anhang der Originalpublikation enthalten sind, fehlen hier.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Patronymika, Metronymika, Familiennamen, Namensforschung, germanischer Sprachraum, Beinamen, Einnamigkeit, Zweinamigkeit, Bevölkerungsentwicklung, schriftliche Verwaltung, geographische Verbreitung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, den Prozess der Namensbildung von der Einnamigkeit zum Zweinamensystem nachzuvollziehen und die geographische Verteilung verschiedener patronymischer Familiennamen aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Jelena Zagoricnik (Autor), 2010, Patronymische und metronymische Familiennamen. Entstehung, Entwicklung und Verbreitungsgebiete, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278378