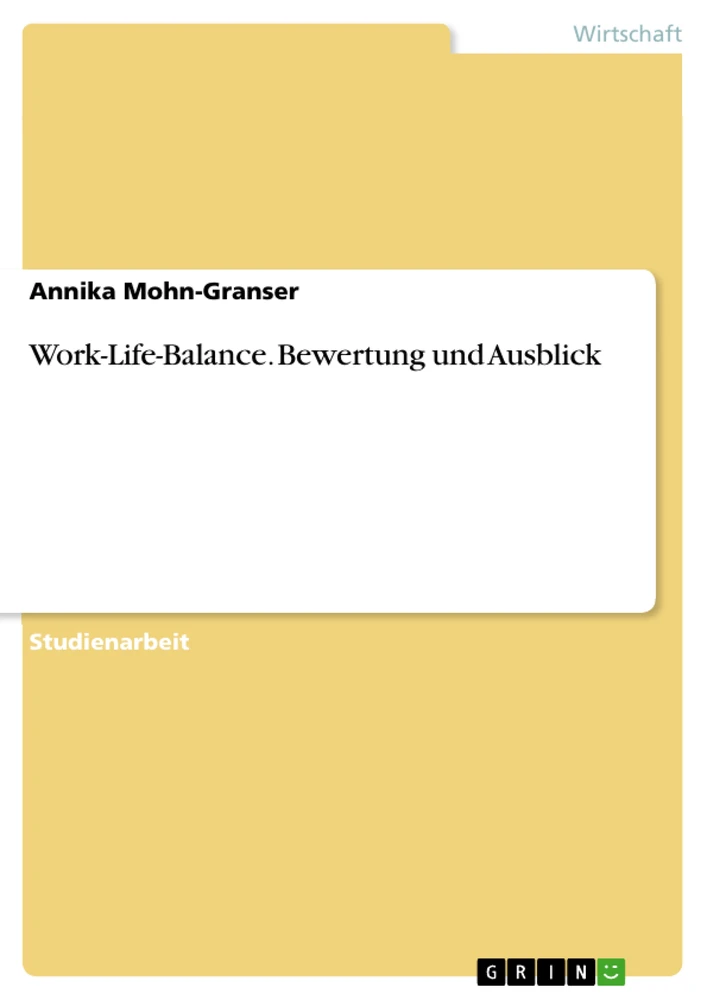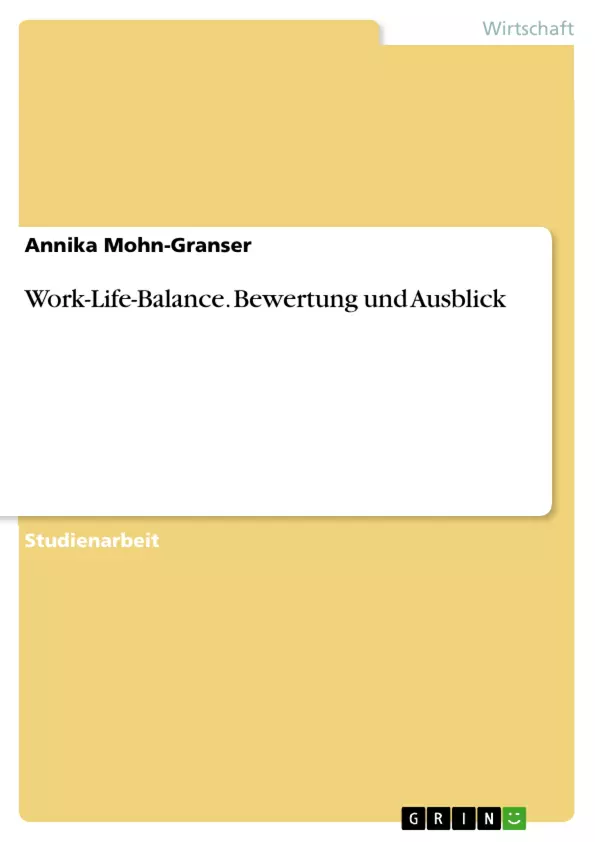Die Arbeits- und Lebenswelt hat sich unter dem Einfluss neuer Technologien, der Globalisierung, dem Wandel der Rollenbilder und soziostrukturellen Veränderungen wie die zunehmende Instabilität von Partnerschaften und der immer älter werdenden Gesellschaft rapide verändert.
Der Stellenabbau bei Kernbelegschaften, die Verlagerung unternehmerischer Risiken auf die Mitarbeiter, die Zunahme von befristeten Verträgen und Leiharbeit führt zu
immer höheren Produktivitätserwartungen der Unternehmen. Die Folge ist eine Zunahme der psycho- und sozio-emotionalen Störungen, die auf gestiegenem Zeitdruck, erhöhten Mobilitätsanforderungen, zunehmendem Interaktionsstress in Dienstleistungsberufen und der Angst vor Arbeitsplatzverlust beruhen.
Traditionelle Erholungsphasen wie das Wochenende oder der geregelte Feierabend werden beeinträchtigt durch die Entgrenzung der Arbeitszeiten und Schichtdienst.
Den veränderten Anforderungen der Arbeitswelt stehen Lebensentwürfe gegenüber, die auffallend die persönliche Gesundheit bzw. soziale Aspekte betonen.
Einen Ausgleich zwischen den divergierenden Anforderungen und Interessen zu schaffen, der sowohl den Unternehmen als auch den Arbeitnehmern gerecht wird, ist die Aufgabe der Konzepte und Maßnahmen, die unter dem Schlagwort „Work-Life-Balance“ subsumiert werden.
Obwohl eine gelungene Balance zwischen den Anforderungen des Berufs und dem Privatleben von jedem Individuum selbst empfunden und beeinflusst werden kann, sind auch Arbeitgeber als diejenigen beteiligt, die entsprechende WLB ermöglichende Maßnahmen in ihren Unternehmen umsetzen sollten. Dies kann auf freiwilliger Basis als Einzelmaßnahme oder durch Tarifverträge geschehen. Der Gesetzgeber gibt durch gesetzliche Regelungen Rahmenbedingungen vor, die sowohl individuelle Lebensentwürfe unterstützen als auch der Erreichung übergeordneter Ziele (z.B. Erhöhung der Geburtenrate, Entlastung des Gesundheitssystems) dienen. Auf jeder der im Folgenden dargestellten drei Ebenen finden sich spezifische Verhaltensempfehlungen, Maßnahmen und Konsequenzen. Das BMFSFJ spricht von einer dreifachen Win-Situation mit Vorteilen für die Beschäftigten, die Arbeitgeber und die gesamte Gesellschaft, sofern einer Vielzahl von Beschäftigten die Balance zwischen Berufsleben, Familie und Freizeit gelingt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Gang der Arbeit
- 2 Definitorische Ansätze zur Klärung des Begriffs Work-Life-Balance
- 2.1 WLB nach Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- 2.2 WLB nach Kastner
- 3 Bewertung von WLB-Maßnahmen
- 3.1 Maßnahmen zur Erreichung der Work-Life-Balance
- 3.1.1 Individuelle Ebene
- 3.1.2 Unternehmensebene
- 3.1.3 Gesetzgeberische Rahmenbedingungen
- 3.2 WLB-Maßnahmen im Hinblick auf die Zielerreichung
- 4 Schlussbetrachtung
- 4.1 Zusammenfassendes Praxisbeispiel
- 4.2 Kritische Auseinandersetzung
- 4.3 Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept der Work-Life-Balance (WLB) und analysiert dessen Relevanz in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt. Die Arbeit strebt danach, die Vielschichtigkeit des Begriffs WLB aufzuzeigen und das Zusammenspiel von individuellen Faktoren, unternehmerischen Maßnahmen und politischen Rahmenbedingungen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs WLB
- Bewertung verschiedener WLB-Maßnahmen auf individueller, unternehmerischer und politischer Ebene
- Zusammenhang zwischen WLB-Maßnahmen und ihrer Zielerreichung
- Praxisbeispiele und kritische Analyse der Implementierung von WLB-Maßnahmen
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der WLB
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Work-Life-Balance ein und beleuchtet die sich verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen, die den Bedarf nach einer ausgewogenen Balance zwischen Berufs- und Privatleben hervorrufen. Das zweite Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs WLB, wobei die Definitionen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von Kastner im Detail betrachtet werden. Kapitel drei untersucht verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der WLB auf individueller, unternehmerischer und politischer Ebene und analysiert deren Auswirkungen auf die Zielerreichung.
Schlüsselwörter
Work-Life-Balance, Arbeitswelt, Lebenswelt, Individuum, Unternehmen, Politik, Maßnahmen, Zielerreichung, Praxisbeispiel, kritische Analyse, Ausblick
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Work-Life-Balance (WLB)?
Work-Life-Balance beschreibt den Zustand, in dem Berufs- und Privatleben (Familie, Freizeit, Gesundheit) in einem harmonischen Einklang zueinander stehen.
Welche Faktoren gefährden die Work-Life-Balance heute?
Gefährdungen entstehen durch Globalisierung, ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung der Arbeitszeiten, hohen Leistungsdruck und zunehmende Mobilitätsanforderungen.
Welche Maßnahmen können Unternehmen zur WLB umsetzen?
Unternehmen können flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Optionen, betriebliche Kinderbetreuung oder Gesundheitsförderungsprogramme anbieten.
Welche Rolle spielt der Gesetzgeber bei der Work-Life-Balance?
Der Gesetzgeber schafft Rahmenbedingungen durch Gesetze zu Elternzeit, Teilzeitansprüchen und Arbeitsschutz, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.
Warum profitieren Arbeitgeber von WLB-Maßnahmen?
Zufriedene Mitarbeiter sind produktiver, seltener krank und binden sich langfristig an das Unternehmen, was die Fluktuationskosten senkt.
- Citation du texte
- Annika Mohn-Granser (Auteur), 2013, Work-Life-Balance. Bewertung und Ausblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278399