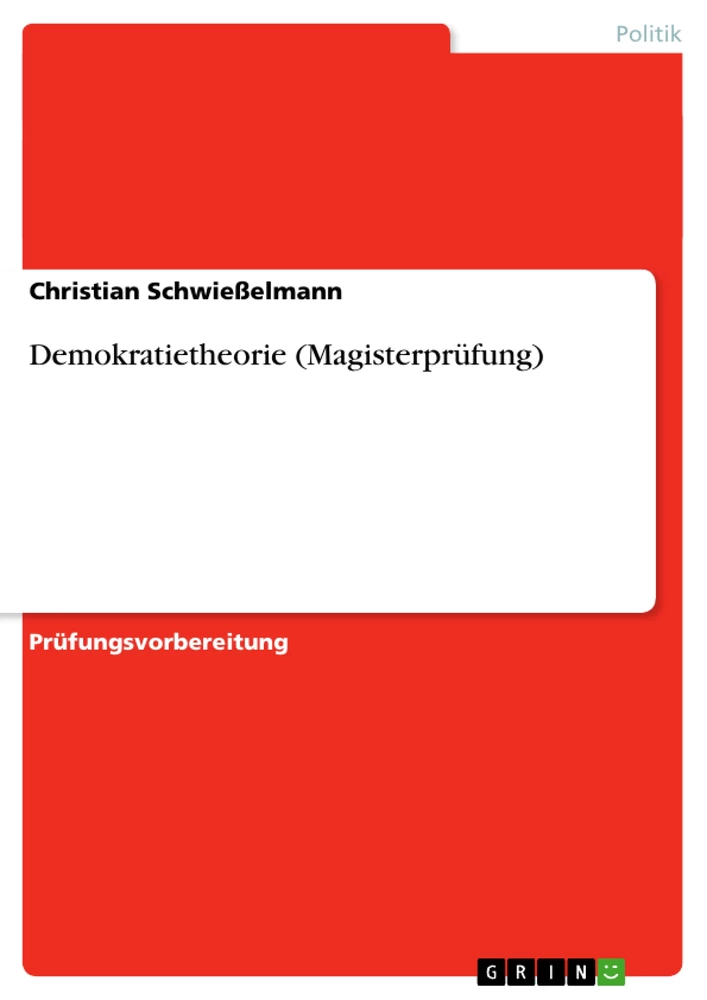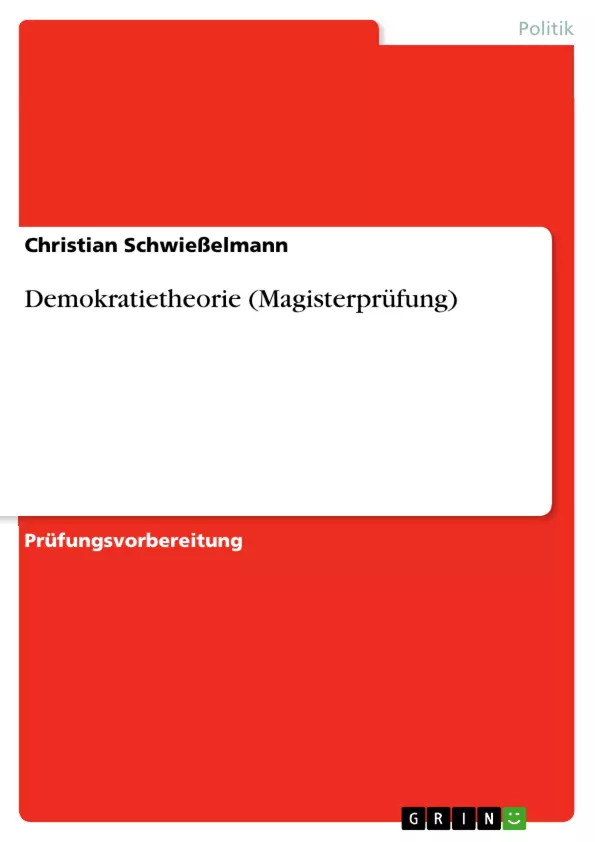Ausführliche Prüfungsvorbereitung auf eine Magisterprüfung zum Thema "Demokratietheorie" mit Literaturverweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Demokratie, Etymologie und Theorie
- nach Giovanni Sartori: Demokratietheorie, Darmstadt 1997
- Unterscheidung der Demokratie in:
- Wahldemokratie
- Mitwirkungsdemokratie
- Referendumsdemokratie
- Konkurrenztheorie
- Methodik: operative Theorie der Demokratie muß sowohl präskriptiv als auch deskriptiv sein -> nicht zu trennen
- Etymologie: Demokratie ist Volksherrschaft; Volk = jedermann; sehr viele; Unterschicht, organisches Ganzes, größerer Teil (Mehrheit); Masse
- ,,Volksherrschaft ist eine durch Minderheitsrechte beschränkte Mehrheitsherrschaft“ (S. 33)
- in der Antike bestand polis aus 2000-3000 Menschen (tw. auch im MA), in der Moderne sprechen wir dagegen von der Massengesellschaft (die für Hannah Arendt aufgrund der Atomisierung, Entpersönlichung, Beschleunigung, Entfremdung und Entwurzelung eine Voraussetzung für den Totalitarismus darstellte)
- moderne Demokratie beruht auf:
- beschränkte Mehrheitsherrschaft - Wahrung von Minderheitsrechten
- Wahlverfahren
- repräsentative Übertragung von Macht
- Abraham Lincoln meinte 1863 in der Ansprache von Gettysbury: Demokratie sei „government of the people, by the people, for the people"
- der politische Realismus begann mit Machiavelli, aber Machtpolitik ist Sachpolitik
- Realismus als Voraussetzung westlicher Modernität -> empirische Demokratietheorien sind realistisch, rationalistische meistens idealistisch oder antirealistisch
- Demokratietypen:
- französische Tradition
- Ursprung in der französischen Revolution
- Rationalismus
- Schwerpunkt: Volkssouveränität (Rousseau)
- Betonung des starken Staats, des Volks(geistes), Verhältniswahlrechts und des Parlaments
- engl.-amerk. Tradition
- Ursprung in der engl. und amerk. Revolution (eigentlich Sezession vom Mutterland)
- Empirismus
- Schwerpunkt: Funktion der Demokratie, Föderalismus (Federalist Papers)
- Betonung der Regierung (government), people, Mehrheitswahlrecht und der Exekutive
- -> Sartori will zwischen Rationalismus und Empirismus vermitteln
- Stärken und Schwächen der modernen Demokratietheorien
- nach Manfred G. Schmidt: Demokratietheorie, 2. Aufl., Opladen 1997
- Vorläufer moderner Demokratietheorien in der Antike = Aristoteles, Platon, in der Neuzeit Montesquieu (Gewaltenteilung), Rousseau (Volkssouveränität), Tocqueville (Freiheit/Gleichheit), Mill (Utilitarismus =Freiheit, Glück der größeren Zahl), Marx (Kommunismus und Diktatur des Proletariats)
- moderne Theorie der Demokratie entstanden im 20. Jh. unter dem Eindruck demokratischer Verfassungen und ihrer Realisierung in den Flächenstaaten
- Differenzen zu älteren Theorien betreffen vor allem das Wahlrecht, Demokratie-Begriff usw.
- erste moderne Massendemokratie in Tocquevilles Werk „Über die Demokratie in Amerika" (1835/1840) geschildert = Konflikt zwischen Freiheit als Lebensweise und Leidenschaft der Gleichheit (größere Gefahr für Freiheit) -> Diagnose: Gefahr der Tyrannei der Mehrheit, der Mediokrität, der Korruption, Abhängigkeiten und Vereinzelung der Menschen in demokratischen Gesellschaften
- im 19. Jh. Veränderungen in den Monarchien = Stärkung des Parlaments, Nationsbildung, Verfassung
- MAX WEBER (1864-1920) ALS VERTRETER DER ELITÄREN D-T
- Herrschaftssoziologie am Bsp. des Kaiserreichs (Konzept des Verstehens, der Werturteilsfreiheit und der Idealtypen)
- vertritt elitäre Demokratietheorie, deren Aufmerksamkeit der politischen Führung gilt
- Politik wird verstanden als Kampf um die Macht (realistischer Politikbegriff)
- Wiederentdeckung durch Talcott Parsons, erst dadurch rückt Weber in den Rang eines internationalen Großklassikers auf
- Entzauberung der Welt durch Rationalisierungsprozesse (Wissenschaft als Beruf 1919)
- Hauptwerke:
- ,,Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ 1905 (innerweltliche Askese, Lehre der Prädestination im Calvinismus etc.)
- ,,Wirtschaft und Gesellschaft“ 1921/1922 (Grundriß der verstehenden Soziologie, soziales Handeln und Menschenwissenschaft)
- 1922 erschien in den preußischen Jahrbüchern: „Die drei reinen Typen der legalen Herrschaft“:
- TYP
- RATIONAL-LEGAL
- Grundlage
- ▪ Glaube an Gültigkeit korrekt Satzungen
- Legitimität durch
- ▪ Gesetze, Regeln
- Beispiele
- ▪ moderner Staat, kapitalistischer Betrieb, politische Verbände
- ▪ Bürokratie
- Herr (Befehl)
- ▪ Vorgesetzter
- ▪ Herr
- " Beamter
- Beherrschter ■ (Gehorsam)
- ▪ Staatsbürger, Parteimtgl.)
- Prinzipien
- ▪ sachliche Kompetenz, Amtspflicht, Betriebsdisziplin
- TRADITIONAL
- Grundlage
- ■ Glaube an die Heiligkeit tradierter Ordnungen
- Legitimität durch
- ■ Gewohnheit, Sitte
- Beispiele
- ■ Feudalstaat, patriarch. Herrschaft des Familienvaters, Landesvaters, Sippenchefs
- Herr (Befehl)
- ▪ Vorgesetzter
- ▪ Herr
- " Beamter
- Beherrschter ■ (Gehorsam)
- ▪ Untertan
- Prinzipien
- ▪ Privilegien, ständische Verbandsmitglieder
- ▪ irrationales Vertrauen, Ehre und Treuebeziehungen
- CHARISMATISCH
- Grundlage
- ■ Glaube/Hingabe an die Gnadengaben des Herrn
- Legitimität durch
- ■ Charisma, Ausstrahlung
- Beispiele
- ▪ okzidentale Stadtstaat, religiöse Gefolgschaft, Führerdemokratie, Qualitäten von Jesus, Perikles, Napoleon
- ▪ Herrschaft der Propheten, Kriegshelden, Demagogen
- ▪ Führer reinster Typ
- ▪ sultanistische Herrschaft
- Herr (Befehl)
- ▪ Vorgesetzter
- ▪ Herr
- " Beamter
- Beherrschter ■ (Gehorsam)
- ▪ Jünger
- Prinzipien
- ▪ Autorität, Bewährung durch Wunder, Offenbarungen
- Weber selbst stammt aus einem national-liberalen Elternhaus
- seit 1917 setzt er sich in seinen politischen Schriften für eine Strukturreform der politischen Institutionen Deutschlands ein:
- 1) Demokratisierung des Wahlrechts auch in Preußen (Dreiklassenwahlrecht)
- 2) Parlamentarisierung
- 3) plesbizitäre Führerdemokratie = unmittelbare Führerwahl
- in,,Politik als Beruf" 1919
- soziologisches Kennzeichen des Staates = Monopol legitimer physischer Zwangsgewalt
- ,,Politik als Streben nach Machtanteil oder Beeinflussung der Machtverteilung"
- Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik
- ,,Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich"
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- spekulative Komponente
- empirisch, mittlerer Demokratiebegriff, mäßige Leistungskraft
- Erfassung der Phänomene der politischen Führung, Auslese, Herrschaft
- hierarchisches, unterkomplexes Politikmodell
- Politikbegriff: Kampf, Konkurrenz, Durchsetzung
- Demokratie nicht als Selbstzweck, sondern Stärkung der nationalen Werte und Entgegnung der Bürokratisierung
- zugute halten muß man Weber, daß vollentwickelte Massendemokratien vor dem ersten WK nicht vorhanden waren
- ÖKONOMISCHE THEORIE
- Vertreter sind Joseph Schumpeter und Anthony Downs
- maßgeblich ist Schumpeters Hauptwerk von 1942: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, darin vertritt er folgende Vorstellungen:
- Verträglichkeit von Sozialismus und Demokratie
- Demokratie = Institutionenordnung, bei dem das Volk durch den Konkurrenzkampf um Stimmen maßgeblich an den politischen Entscheidungen und der Wahl/Abwahl der Führungseliten beteiligt ist
- Infragestellung der Gemeinwohlorientierung, der Vernunft des Individuums und der Idee der volonté générale -> Wähler sind wie der homo oeconomicus auf die Maximierung ihres Eigennutzes orientiert
- Vorstellung von Politik als ein Markt
- => Schumpeter gilt als der Vertreter der Konkurrenzdemokratie angelsächsischer Provenienz (unterschiedliche Interessen und Interessengruppen; als demokratische Methode gilt der Konkurrenzkampf um Wählerstimmen; Prinzip der Repräsentation, Parlament, freies Mandat, Pluralismus und Meinungsvielfalt); während J. J. Rousseau die Identitätstheorie vertritt (einheitlicher, objektiv erkennbarer Volkswille, Ablehnung der Gewaltenteilung, Identität von Regierenden und Regierten, Plesbizit, imperatives Mandat, keine Partikularinteressen -> Gefahr der totalitären Erziehungsdiktatur)
- in Downs Economic Theory of Democracy (1957) wird das Wesen der Ökonomie = Profitmaximierung auf die Politik übertragen, d.h. Politik als komplexes Tauschsystem (Individualismus, Parteien streben nach Stimmenmaximierung, Wähler verhalten sich rational)
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- Unterstellung eines rationalen Wählers
- realistische Einschätzung politischer Wahlkämpfe und ihrer Konkurrenz
- magerer Demokratiebegriff, der auf Führerauslese rekurriert
- Partizipationsforschung widerlegt Schumpeters These von der Inkompetenz des Wählers
- DEMOKRATIETHEORIE DER PLURALISTEN
- Theoretiker: Bentley/Truman in den USA, Ernst Fraenkel in Deutschland
- Schlüsselbegriff = Pluralismus (Gewaltenteilung und Kontrolle der Regierung, Autonomie der Bürger, offene Konfliktaustragung)
- Plädoyer für Repräsentativverfassung und gegen plesbizitäre Demokratie
- Idealtypus des Rechtsstaates = heterogene Legitimität, homogene Stabilisierung
- die Herrschaftsorganisation der Demokratie ist vielgliedrig (pluralistisch), die der Diktatur einförmig (monistisch)
- Pluralisten betonen Vielgliedrigkeit von Staat un Gesellschaft (Mehrparteinensysteme, Interessensgruppen, Kirchen, Gewerkschaften, Vereine, Verbände)
- bei Fraenkel beinhaltet der pluralistische Demosbegriff den Demos als heterogene Menge unterschiedlicher Körperschaften, Parteien, Gruppen, Verbände -> Notwendigkeit von Konsens und Kompromissen; -> Prägung der Pluralismustheorie durch den Totalitarismus (Deutschland und die westlichen Demokratien = normativ aufgeladen)
- Pluralismus bedeutet Aufwertung von Interessenverbänden, die als Sozialverbände freie Pluralität auf allen ges. Gebieten genießen
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- schwerpunktartige Betonung der Interessengruppen, die jedoch im Falle des Machtzuwachses und des Lobbyismus lähmend sein können
- Postulat des Waffengleichgewichts zwischen den einzelnen Gesellschaftsgruppen wurde empirisch widerlegt
- Pluralismus ist offener als angenommen (1968/1969, die Grünen etc.)
- Theorie relativ leistungsfähig
- THEORIE DER SOZIALEN DEMOKRATIE
- aktivistisches und expansives Demokratieverständnis -> Demokratie soll Staat, Gesellschaft und Wirtschaft permanent reformieren
- Gleichheitsideal
- neben politischer Demokratie wird auch die Sozial- und Wirtschaftsdemokratie angestrebt durch Ausbau von Sozialleistungen, autonome demokratische Interessenorganisation
- soziale Demokratie war lange Zeit politische Zielstellung der Arbeiterbewegung (Marx' Lehre einer revolutionären Direktdemokratie, Theorie und Praxis der sozialdemokratischen Partei, Sozialstaatslehre der katholischen Arbeiterbewegung und der christdemokratischen Parteien) -> reformorientierte und radikale Varianten möglich
- Eduard Bernstein, 1899: „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“ -> Demokratie als Mittel zur Verwirklichung des Sozialismus bei Einlösung demokratischer Bürgerrechte; Demokratisierung von Politik, Wirtschaft und Kultur wird zum Wesen des Sozialismus erklärt; Zentralisierungstendenzen sollen zurückgedrängt werden durch lokale, kommunale und gewerbliche Demokratie -> Kontrast zur etatistischen Demokratieaufassung des Marxismus/Neomarxismus
- Kernpunkte sind der soziale Rechtsstaat, der Gefährdungen der sozialen Ordnung und damit seiner Grundlage durch prophylaktische Maßnahmen abfedert, und Umwandlung der politischen zur gesellschaftlichen Demokratie
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- Kern der Staatlichkeit wird zersetzt, d. h. Grenzverschiebung zwischen Politik und Nichtpolitik
- ambivalente Funktionen; einerseits Verbesserung der Partizipationschancen, andererseits totalitäre Staats- und Vereinheitlichungstendenzen
- im Resultat bedroht schleichender Sozialismus Effizienz der Wirtschaft und individuelle Freiheit (liberale Kritik)
- politisch-soziale Stagnation
- Übertünchung der Strukturkonflikte
- Gefährdung der Staatsfinanzen und Hemmung der Eigenverantwortlichkeit
- PARTIZIPATORISCHE DEMOKRATIETHEORIE
- Eigenwert von Beteiligung, Maximierung von Partizipationschancen und Demokratisierung der Arbeitswelt, des Ausbildungssektors und des privaten Bereichs
- Vergrößerung des Kreises der Stimmberechtigten
- wichtiges Werk von Benjamin Barber: Starke Demokratie. Über die Teilhabe am Politischen, 1984
- Kritik am Liberalismus, an der liberalen Demokratie, die als magere Demokratie zu wenig politische Rechte einräumt und der „Raubtierhaltung“ gleichkommt -> die liberale Demokratie schützt zwar das Individuum und seine Rechte, fördert aber nicht Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Bürgersinn
- demgegenüber begreift die starke Demokratie Politik als Lebensform vor dem Ideal selbst regierender Gemeinschaft von Bürgern -> Förderung bürgerlicher Tugend, Stärkung der Zivilgesellschaft durch Erziehung, Einstellung und Institution
- die liberale Demokratie wird wegen ihrer elitären Neigungen (Aristokratie Tocquevilles), der pauschalen Ablehnung direkter Demokratie und der schwachen staatsbürgerlichen Verantwortung kritisiert, sie sieht nicht den Bürger, sondern nur das Individuum, nicht Pflichten, sondern nur Rechte
- Barber unterbreitet Angebote starkdemokratischer Reformen auf dem Gebiet der Kommunikation, des Entscheidungsprozesses und des Handelns:
- 1) Zuhören, Einfühlen, Nachbarschaftsversammlung
- 2) Fernseh-Bürgerversammlung (Nutzung moderner Medien)
- 3) Erziehung zum Staatsbürger und Information für alle (Videotext)
- 4) ergänzende Einrichtungen (repräsentative Bürgerversammlung, Losverfahren, Rotation)
- 5) nationale Volksbegehren und Volksabstimmungsverfahren
- 6) Elektronische Abstimmung
- 7) Wahl durch Losverfahren, Losentscheid, Rotation und Bezahlung
- 8) Gutscheine und Funktion des Marktes bei öffentlichen Entscheidungen
- 9) Nationale Bürgerschaft und gemeinsames Handeln (Bürgerdienst)
- 10) Bürger in der Nachbarschaft
- 11) Demokratie in der Arbeitswelt
- 12) Wiederherstellung der Nachbarschaft als öffentlicher Raum
- Exkurs zum Kommunitarismus möglich (John Rawls, Amitai Etzioni: Die Entdeckung des Gemeinwesens, Stuttgart 1995)
- neueres Werk Barbers (Coca-Cola und Heiliger Krieg) sieht Demokratie durch Fundamentalismus und Globalisierung gefährdet -> Plädoyer für Graswurzeldemokratie, einheitliche Kultur, Binnenkonsens zur Heranbildung des Gemeinwillens; Stärkung des Bürgersinnes, Wiederbelebung staatlicher Institutionen, Schaffung weltweiter Öffentlichkeit
- abgesehen von Barbers Kritik an der liberalen Repräsentativdemokratie (Rosseaus Kritik: Repräsentation zerstört Partizipation) streben radikale Varianten die Totalpolitisierung an
- die partizipatorische D-T geht von einem positiven Menschenbild aus, wonach der Bürger über mehr Einsichten und Partizipationsabsichten verfügt, als generell angenommen wurde -> self-transformation zum vollwertigen Staatsbürger
- Interesse und politische Fähigkeiten der Staatsbürger werden nicht durch präpolitische Faktoren bestimmt, sondern durch Maximierung der Selbstbestimmungs- und Selbstentfaltungschancen, d. h. durch Beseitigung institutioneller Hürden
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- Primat des Normativen, fehlende empirische Absicherung
- unrealistisches Menschenbild, denn der Bürger maximiert in erster Linie Eigennutzen
- Tocquevilles Problem = Gefahr der Tyrannei der Mehrheit/Minderheit
- Destabilisierung durch Übermobilisierung
- Eindimensionalität = Vernachlässigung von Effizienzproblemen und Zielkonflikten
- Überschätzung der Bürgerkompetenzen (geringer Informationsstand, begrenztes Zeitbudget)
- Mischsysteme wie BRD gewähren unterschiedliche Partizipationschancen auf unterschiedlichen Ebenen, darunter direktdemokratische Bürgermeister-/Landratswahlen, die kaum genutzt werden
- Beitrag Habermas zur partizipatorischen Demokratietheorie = Theorie des kommunikativen Handelns -> herrschaftsfreier Dialog, d. h. Herrschaft der Mehrheit im Prozeß der Kommunikation -> Diskurs und öffentliche Debatte als Entscheidungsprozedur -> deliberative Poltik = Form des Austausches von Meinungen, Chancengleicheit/Zugang zum Diskurs, ideale Sprechsituation (ohne Zwang), unbegrenzte Dauer (Wiedereröffnung möglich), Themenfreiheit, verfassungspolitische Weichenstellungen für den Diskurs, Zusammenwirkung von Beratung und Meinungsbildung, Öffentlichkeit auf zivilgesellschaftlicher Grundlage, kommunikativ erzeugte Macht -> durch demokratische Verfahren entsteht Legitimität = Idee der diskursiven Demokratie
- KRITISCHE THEORIE DER DEMOKRATIE
- kritische Analyse der Binnenstruktur demokratischer Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse
- Vertreter: Claus Offe und Bernd Guggenberger = kapitalismus- und demokratiekritische Politiktheorie -> Demokratie repräsentiert den Willen des Volkes nicht hinreichend, weil er in sich als konsistent und einheitlich nicht existiert (viele unterschiedliche Motivationen, Verführbarkeit, Instabilität, Tyrannei der Mehrheit) = Problem der Mehrheit, da nicht feststehend, sondern wandernde, zyklische Mehrheiten
- Ostrogorski-Paradoxon besagt, daß der Volkswille dem Abstimmungsverhalten und der Parteipräferenz nicht entsprechen muß
- Claus Offe führt Analysen der Frankfurter Schule weiter und kombiniert sie mit den Erkenntnissen der modernen anglo-amerikanischen Politikwissenschaft
- -> Demokratie beseitigt zwar die ständische Privilegienordnung, bietet den Minoritäten durch Kartellbildung, Disziplinierung jedoch keine Chance
- -> Defekte der Institutionenordnung führen zu Defekten der Staatstätigkeit
- -> Kritik der Mehrheitsregel durch C. Offe und B. Guggenberger in den 80er Jahren = Mehrheitsregel ist als Basisinstitution zur Herstellung von Kollektiventscheidungen umstritten, traditionelle Kritik schon bei Schiller/Goethe (elitär):
- 1) Mehrheiten schwanken, sind fehlbar und verführbar (von Eliten oligopol organisiert)
- 2) Fiktion abstrakter Teilhabergleichheit (Stimmengleichheit: one man, one vote), meistens ist aber nur eine Minderheit hoch motiviert, interessiert und informiert, während eine wenig orientierte Mehrheit entscheidet
- 3) Verwischung öffentlicher und privater Sphäre -> Mehrheitsprinzip dringt in den privaten Bereich vor
- 4) Mehrheitsentscheidungen sind zeitbezogen, schnelles Verfallsdatum
- 5) Unrevidierbarkeit, Irreversibilität der Mehrheitsbeschlüsse
- 6) Diskrepanz zwischen Beteiligten und Betroffenen der Mehrheitsentscheidung
- 7) Spannung zwischen privater und öffentlicher Politik
- -> Mehrheitsregel ist wirkungsvolles, effizientes Verfahren, das vor allem in Perioden mit hohem Basiskonsens paßt; die Kritiker sind jedoch uneins, was an die Stelle dieses bewährten Verfahrens treten soll; empirisch läßt sich die Kritik der Mehrheitsregl nicht bestätigen; das GG ist jedoch mit starkem Minderheitenschutz ausgestatt, so daß die BRD eher als Zweidrittelmehrheitsdemokratie daher kommt (siehe GG 79,3 Ewigkeitsparagraph, Abs. 2 legt ZDM für GG-Änderung fest)
- KOMPLEXE DEMOKRATIETHEORIE
- Fritz Scharpf 1970: Demokratietheorie zwischen Utopia und Anpassung = Verknüpfung empirischer und normativer Theorieansätze
- Nachbildung der Wirklichkeit
- empirische und realistische Einschätzung bürgerlicher Partizipationsmöglichkeiten
- Delegation der Problemverarbeitung und Entscheidungsfindung an den Zentralstaat und nachgeordnete Systeme
- Internationalisierung von Wirtschaft, Kommunikation, Sicherheitspolitik führt zur Entgleisung nationalstaatlicher Kontrollfunktion -> grenzüberschreitende Probleme verlangen nach grenzüberschreitender Lösungsansätzen
- -> Legitimation außerhalb und oberhalb des NS nicht möglich, durch Globalisierung aufgeworfene Probleme verlangen jedoch grenzüberschreitende Antworten
- -> Effektivität-Legitimation-Dilemma mündet in Nichtkooperation
- Verweis auf Systemtheorie
- STÄRKEN UND SCHWÄCHEN
- Kombination empirischer und normativer Analyse
- Erörterung der Politikverflechtung
- Blick für Gefährdungen der Demokratie
- schwache empirische Fundierung und Nichtberücksichtigung international und historisch vergleichender Demokratieforschung
- Elitäre Demokratietheorie (Max Weber)
- Ökonomische Demokratietheorie (Joseph Schumpeter, Anthony Downs)
- Pluralistische Demokratietheorie (Bentley/Truman, Ernst Fraenkel)
- Theorie der Sozialen Demokratie (Eduard Bernstein)
- Partizipatorische Demokratietheorie (Benjamin Barber, Jürgen Habermas)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Klausur befasst sich mit der Analyse moderner Demokratietheorien und zielt darauf ab, deren Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze, die im 20. Jahrhundert entstanden sind und sich mit der Funktionsweise und den Herausforderungen der Demokratie auseinandersetzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Demokratie ein und beleuchtet die Etymologie des Begriffs sowie die verschiedenen Arten von Demokratie. Sie stellt die Methodik der Demokratietheorie vor und erläutert die Unterschiede zwischen rationalistischen und empirischen Ansätzen.
Der zweite Teil der Klausur widmet sich den Stärken und Schwächen der modernen Demokratietheorien. Er beginnt mit einer kurzen Darstellung der Vorläufer moderner Demokratietheorien in der Antike und der Neuzeit. Anschließend werden die wichtigsten Vertreter und ihre Theorien vorgestellt, darunter Max Weber, Joseph Schumpeter, Anthony Downs, Ernst Fraenkel, Eduard Bernstein, Benjamin Barber und Jürgen Habermas.
Die einzelnen Kapitel analysieren die jeweiligen Theorien und ihre zentralen Argumente. Sie beleuchten die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze und diskutieren deren Relevanz für die heutige Zeit.
Die Klausur endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einer kritischen Bewertung der modernen Demokratietheorien.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die moderne Demokratietheorie, die Stärken und Schwächen verschiedener Ansätze, die elitäre Demokratietheorie, die ökonomische Demokratietheorie, die pluralistische Demokratietheorie, die Theorie der Sozialen Demokratie, die partizipatorische Demokratietheorie, Max Weber, Joseph Schumpeter, Anthony Downs, Ernst Fraenkel, Eduard Bernstein, Benjamin Barber, Jürgen Habermas, die Funktionsweise der Demokratie, die Herausforderungen der Demokratie, die Kritik an der Demokratie, die Rolle des Volkes, die Rolle der Eliten, die Rolle der Interessengruppen, die Rolle des Staates, die Rolle der Zivilgesellschaft, die Rolle der Medien, die Rolle der Partizipation, die Rolle der Kommunikation, die Rolle des Konsenses, die Rolle des Kompromisses, die Rolle der Macht, die Rolle der Legitimität, die Rolle der Freiheit, die Rolle der Gleichheit, die Rolle der Gerechtigkeit, die Rolle des Gemeinwohls, die Rolle des Eigennutzes, die Rolle der Vernunft, die Rolle der Rationalität, die Rolle der Empirie, die Rolle der Normativität, die Rolle der Geschichte, die Rolle der Gegenwart, die Rolle der Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Idealtypen der Herrschaft nach Max Weber?
Weber unterscheidet zwischen rational-legaler Herrschaft (Gesetze/Bürokratie), traditionaler Herrschaft (Sitte/Feudalismus) und charismatischer Herrschaft (Hingabe an eine Führerpersönlichkeit).
Was ist der Kern der ökonomischen Theorie der Demokratie?
Vertreter wie Schumpeter und Downs sehen Politik als Markt: Parteien agieren als Stimmenmaximierer und Wähler verhalten sich wie rationale Konsumenten (homo oeconomicus).
Wie unterscheidet Giovanni Sartori verschiedene Demokratietypen?
Sartori differenziert zwischen Wahldemokratie, Mitwirkungsdemokratie und Referendumsdemokratie sowie zwischen der rationalistischen (französischen) und empirischen (englisch-amerikanischen) Tradition.
Was versteht man unter Pluralismus in der Demokratietheorie?
Pluralismus betont die Autonomie der Bürger, die Existenz vielfältiger Interessengruppen und die offene Austragung von Konflikten als Basis einer stabilen Demokratie.
Was ist der Unterschied zwischen Identitäts- und Konkurrenztheorie?
Die Identitätstheorie (Rousseau) setzt auf einen einheitlichen Volkswillen, während die Konkurrenztheorie (Schumpeter) den Wettbewerb zwischen Eliten und Gruppen als demokratisches Merkmal sieht.
- Citar trabajo
- Christian Schwießelmann (Autor), 2003, Demokratietheorie (Magisterprüfung), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278479