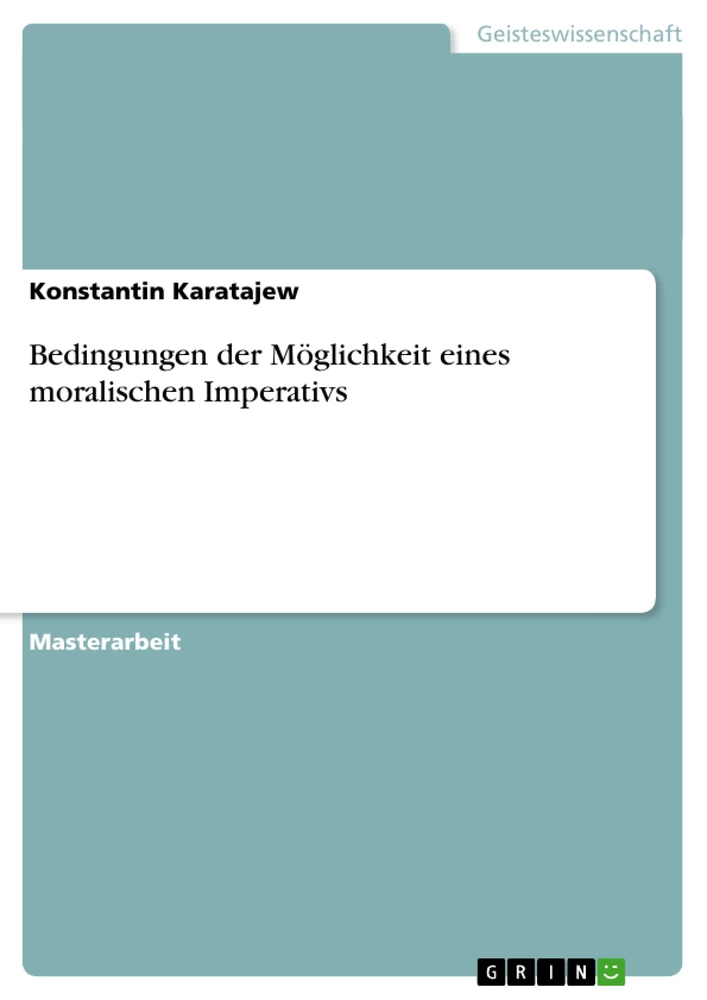Wozu brauchen wir einen moralischen Imperativ? Was erhoffen wir uns davon? Kant sagt, alles Hoffen gehe auf Glückseligkeit. Warum aber dürfen wir überhaupt etwas hoffen, und wie hängt Hoffnung mit der Moral zusammen? "Die Philosophie aber muß sich hüten, erbaulich sein zu wollen", weiß Hegel. In diesem Spannungsverhältnis steht die praktische Vernunft: einerseits muss sie den Menschen einen Hoffnungshorizont bieten, der das Leben sinnvoll, oder zumindest lebenswert macht, andererseits darf sie, der Wahrheit verpflichtet, keine Luftschlösser bauen. Ist ein moralischer Imperativ durch die Beschaffenheit der Vernunft selbst notwendig, und drängt er sich uns als Vernunftwesen unleugbar auf, so müssen wir, ohne Rücksicht darauf, ob wir uns von der Moral Glückseligkeit erhoffen können, um unserer Würde willen in einem heroischen Nihilismus moralische Wesen sein.
Das Ziel dieser Arbeit ist, den Sinn der Frage "Was soll ich tun?" in ihrem notwendigen Hoffnungszusammenhang begreiflich zu machen. Ist diese Frage überhaupt sinnvoll, und welche Bedingungen müssen in theoretischer und praktischer Hinsicht erfüllt werden, damit diese Frage sinnvoll ist? Die Fragestellung "Was soll ich tun?" impliziert, dass ich erstens meine Handlungen an einem moralischen Imperativ ausrichten muss, und zweitens, dass ich mit der Möglichkeit, das Gesollte wie nicht das Gesollte tun zu können, auch die Willensfreiheit dazu habe. Impliziert diese Frage aber noch mehr - dass es in der Welt als Ganzes vernünftig zugehen muss?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Kants Grundlegung der Moralität...
- Einleitung: Autonomie des Willens und freie Willkür..
- Der Begriff der Person: das moralische Subjekt..
- Die freie Willkür...
- Warum soll ich sollen?..
- Das einzelne Subjekt und der objektive Geist..
- Die Menschheit als Gattung..
- Die Menschheit als moralisch-sittliche Gemeinschaft..........................
- Die ontologische Einsamkeit des Einzelnen......
- Das Sollen und das Böse............
- Das Böse als Kritik der Moralität..
- Phänomenologie des Böse...............
- Das Böse als Spitze der Moralität..
- Objektiver Idealismus und subjektiver Realismus.….….….…...…………..
- Weltimmanente Moralität.............
- Eudämonismus und Sterblichkeit.….….….….….….….….….….…..
- Kritik der Unsterblichkeit..
- Was darf ich hoffen?..
- Die Hoffnung und das Solle..............
- Der Sinn des Lebens..
- Transzendentale Weltimmanenz...
- Schlusswort: Was soll ich tun?...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit eines moralischen Imperativs. Sie untersucht, welche Voraussetzungen in theoretischer und praktischer Hinsicht erfüllt sein müssen, damit die Frage "Was soll ich tun?" überhaupt sinnvoll ist. Die Arbeit analysiert Kants Grundlegung der Moralität und die Rolle der Autonomie des Willens, der freien Willkür und der Vernunft im moralischen Handeln. Sie beleuchtet die Beziehung zwischen dem einzelnen Subjekt und der Menschheit als moralisch-sittliche Gemeinschaft sowie die Problematik des Bösen und die Frage nach der Glückseligkeit im Kontext der Moralität.
- Autonomie des Willens und freie Willkür
- Das Verhältnis von Moralität und Glückseligkeit
- Die Rolle der Vernunft im moralischen Handeln
- Die Frage nach dem Sinn des Lebens
- Die Bedeutung des Bösen für die Moralität
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: "Was soll ich tun?" und beleuchtet die Spannungen zwischen der praktischen Vernunft und der Suche nach einem Hoffnungshorizont. Es wird die Notwendigkeit eines moralischen Imperativs und die Frage nach der Willensfreiheit diskutiert. Die Einleitung führt in die Konzepte der Autonomie des Willens und der freien Willkür ein und untersucht den Begriff der Person als moralischem Subjekt. Sie analysiert die Frage "Warum soll ich sollen?" und die Rolle der Vernunft im moralischen Handeln. Das Kapitel "Das einzelne Subjekt und der objektive Geist" befasst sich mit der Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Menschheit als moralisch-sittliche Gemeinschaft. Es untersucht die ontologische Einsamkeit des Einzelnen und die Frage nach der Bedeutung der Menschheit als Gattung. Das Kapitel "Das Sollen und das Böse" analysiert das Böse als Kritik der Moralität und untersucht die Phänomenologie des Bösen. Es beleuchtet die Frage, ob das Böse als Spitze der Moralität verstanden werden kann. Das Kapitel "Objektiver Idealismus und subjektiver Realismus" befasst sich mit der Frage nach der Weltimmanenz der Moralität und untersucht die Beziehung zwischen Eudämonismus und Sterblichkeit. Es analysiert die Kritik der Unsterblichkeit und die Frage nach der Hoffnung im Kontext der Moralität. Das Kapitel "Was darf ich hoffen?" untersucht die Beziehung zwischen Hoffnung und dem Sollen und befasst sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Es analysiert die Konzepte der transzendentalen Weltimmanenz und die Rolle der Vernunft im Hinblick auf die Hoffnung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den moralischen Imperativ, die Autonomie des Willens, die freie Willkür, die Vernunft, die Moralität, die Glückseligkeit, das Böse, die Hoffnung, der Sinn des Lebens, die Menschheit als Gattung und die ontologische Einsamkeit des Einzelnen. Die Arbeit analysiert Kants Philosophie und seine Grundlegung der Moralität, wobei sie die Beziehung zwischen Moralität und Glückseligkeit, die Frage nach der Weltimmanenz der Moralität und die Rolle der Vernunft im moralischen Handeln untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Kants moralischem Imperativ?
Es geht um die Frage "Was soll ich tun?" und die Ausrichtung des Handelns an Gesetzen, die für alle Vernunftwesen gültig sein könnten.
Wie hängen Moralität und Glückseligkeit zusammen?
Kant argumentiert, dass wir moralisch sein müssen, um der Glückseligkeit würdig zu sein, auch wenn Moral nicht direkt zur Glückseligkeit führt.
Was bedeutet "Autonomie des Willens"?
Es ist die Fähigkeit des Willens, sich selbst Gesetze zu geben, die allein aus der Vernunft entspringen, unabhängig von äußeren Trieben.
Welche Rolle spielt das Böse in der Moraltheorie?
Das Böse wird als Kritik der Moralität und als Phänomen untersucht, das die Freiheit der Willkür und die Grenzen des "Sollens" aufzeigt.
Was darf der Mensch laut Kant hoffen?
Der Mensch darf hoffen, dass die Welt letztlich vernünftig geordnet ist und dass moralisches Handeln in einem größeren Sinn sinnvoll ist.
- Citar trabajo
- B. A. Konstantin Karatajew (Autor), 2013, Bedingungen der Möglichkeit eines moralischen Imperativs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278500