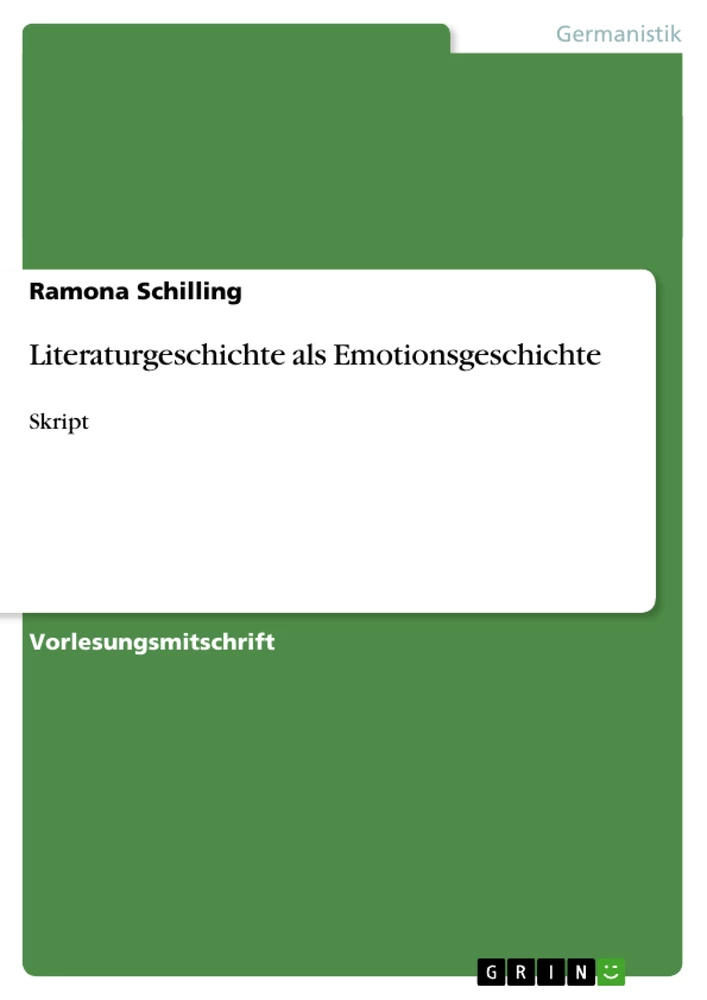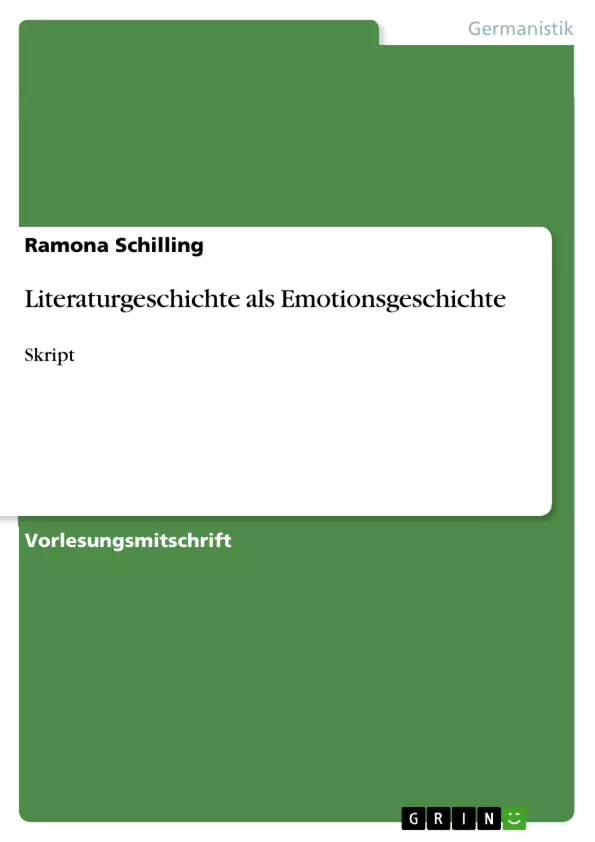Emotionsforschung als zentrales Thema von Literatur- und Kulturtheorie mit Beispielen aus der mittelhochdeutschen Epik. Analysen diverser Werke (König Rother / Heinrich von Veldeke: Eneasroman / Hartmann von Aue: Erec I und II / Gottfried von Straßburg: Tristan I / Konrad von Würzburg: Partonopier)
Inhaltsverzeichnis
- Literaturgeschichte als Emotionsgeschichte
- Einführung / Zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft
- Kulturwissenschaft und Literatur
- Emotionsforschung I
- Emotionsforschung II
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Angst in der Literaturgeschichte, insbesondere im Vergleich zwischen mittelalterlicher und moderner Literatur. Sie analysiert, wie sich der Umgang mit Angst in literarischen Texten und bildlichen Darstellungen verändert hat und wie kulturwissenschaftliche Perspektiven diese Entwicklung beleuchten. Die Arbeit hinterfragt den Wandel im Verständnis von Emotionen und Emotionstheorien selbst und ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft.
- Darstellung von Angst in mittelalterlicher und moderner Literatur
- Der Einfluss kulturwissenschaftlicher Perspektiven auf die Literaturanalyse
- Wandel des Verständnisses von Emotionen im Laufe der Geschichte
- Vergleichende Analyse von literarischen Texten und bildlichen Darstellungen
- Diskussion unterschiedlicher Emotionstheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Literaturgeschichte als Emotionsgeschichte: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit. Es stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung von Angst in der Literaturgeschichte auf und skizziert die methodischen Ansätze. Der Vergleich mittelalterlicher und moderner Literatur wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Veränderungen im Umgang mit Angst und deren ästhetischen Repräsentation vorgestellt. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit einer interdisziplinären Herangehensweise, die Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft und Emotionsforschung verbindet.
Einführung / Zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel von den geisteswissenschaftlichen zu den kulturwissenschaftlichen Ansätzen in der Literaturforschung. Es wird die Krise der traditionellen Geisteswissenschaften erörtert und die Notwendigkeit einer Umstrukturierung im Hinblick auf den Umgang mit den Begriffen Geist und Materie aufgezeigt. Der neue kulturwissenschaftliche Ansatz betont die Einbettung literarischer Werke in gesellschaftliche und materielle Kontexte und hinterfragt die Vorstellung des autonomen Genies. Das Kapitel analysiert den erweiterten Forschungsgegenstand und die interdisziplinären Methoden der Kulturwissenschaften, aber auch mögliche Gefahren und Kritikpunkte dieses Ansatzes werden angesprochen.
Kulturwissenschaft und Literatur: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem kulturwissenschaftlichen Ansatz in der Literaturwissenschaft. Es vertieft die Diskussion um den erweiterten Kulturbegriff und die Grenzen der interdisziplinären Forschung. Die Bedeutung von Emotionsforschung für die Literaturwissenschaft wird hervorgehoben. Die Kapitel analysiert die Herausforderungen einer umfassenden Emotionsforschung, die verschiedene Perspektiven und Disziplinen einbezieht. Konzepte wie "docere et delectare" und die Rolle des ängstlichen Protagonisten in mittelalterlicher Literatur werden im Detail analysiert.
Emotionsforschung I: Dieses Kapitel untersucht zentrale Begriffe der Emotionsforschung wie Affekt, Emotion und Gefühl, und analysiert die unterschiedlichen Definitionen und theoretischen Ansätze. Es wird der historische Wandel des Verständnisses von Affekten beleuchtet und die Abgrenzung von Affekt, Gefühl und Emotion diskutiert. Die verschiedenen Perspektiven auf Emotionen – psychologischer und behavioristischer Ansatz – werden vorgestellt und die Frage nach der Universalität von Emotionen erörtert. Die Rolle von "Display Rules" und ihre kulturelle Bedingtheit werden untersucht.
Emotionsforschung II: In diesem Kapitel werden unterschiedliche Theorien der Emotionsforschung vertieft und miteinander verglichen. Es werden die verschiedenen Ebenen von Emotionen beleuchtet, sowohl als psychologische Prozesse und Handlungen, als auch als universelle und konstruierte Elemente. Die Rolle des Körpers in der Emotionsforschung und die Einbeziehung neurologischer Prozesse werden diskutiert. Darwins Theorie der universellen Mimik wird ebenso angesprochen wie die Repräsentation körperlicher Symptome im Gehirn.
Schlüsselwörter
Angst, Literaturgeschichte, Mittelalter, Moderne, Kulturwissenschaft, Emotionsforschung, Affekt, Emotion, Gefühl, Interdisziplinarität, Display Rules, Universalität, Geisteswissenschaften.
Häufig gestellte Fragen zu: Darstellung von Angst in der Literaturgeschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Angst in der Literaturgeschichte, insbesondere im Vergleich zwischen mittelalterlicher und moderner Literatur. Sie analysiert den Wandel im Umgang mit Angst in literarischen Texten und bildlichen Darstellungen und beleuchtet diesen Wandel aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Wandel im Verständnis von Emotionen und Emotionstheorien selbst und deren Relevanz für die Literaturwissenschaft.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Angst in mittelalterlicher und moderner Literatur, den Einfluss kulturwissenschaftlicher Perspektiven auf die Literaturanalyse, den Wandel des Verständnisses von Emotionen im Laufe der Geschichte, einen Vergleich von literarischen Texten und bildlichen Darstellungen sowie eine Diskussion unterschiedlicher Emotionstheorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Das erste Kapitel legt den Grundstein und stellt die Forschungsfrage sowie die methodischen Ansätze vor. Das zweite Kapitel beleuchtet den Wandel von geisteswissenschaftlichen zu kulturwissenschaftlichen Ansätzen in der Literaturforschung. Das dritte Kapitel vertieft den kulturwissenschaftlichen Ansatz in der Literaturwissenschaft und die Bedeutung der Emotionsforschung. Das vierte und fünfte Kapitel befassen sich eingehend mit der Emotionsforschung, ihren zentralen Begriffen, unterschiedlichen Theorien und dem historischen Wandel im Verständnis von Affekten und Emotionen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft und Emotionsforschung verbindet. Sie analysiert literarische Texte und bildliche Darstellungen vergleichend und diskutiert verschiedene Emotionstheorien.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Angst, Literaturgeschichte, Mittelalter, Moderne, Kulturwissenschaft, Emotionsforschung, Affekt, Emotion, Gefühl, Interdisziplinarität, Display Rules, Universalität, Geisteswissenschaften.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Angst in der Literaturgeschichte zu untersuchen und den Wandel im Umgang mit dieser Emotion im Kontext kulturwissenschaftlicher Perspektiven zu analysieren. Sie möchte das Verständnis von Emotionen im Laufe der Geschichte beleuchten und die Relevanz der Emotionsforschung für die Literaturwissenschaft herausstellen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Literaturgeschichte, Kulturwissenschaft und Emotionsforschung interessieren und einen akademischen Zugang zu diesen Themen suchen. Sie ist insbesondere relevant für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Literatur- und Kulturwissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Bachelor Ramona Schilling (Autor:in), 2011, Literaturgeschichte als Emotionsgeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278596