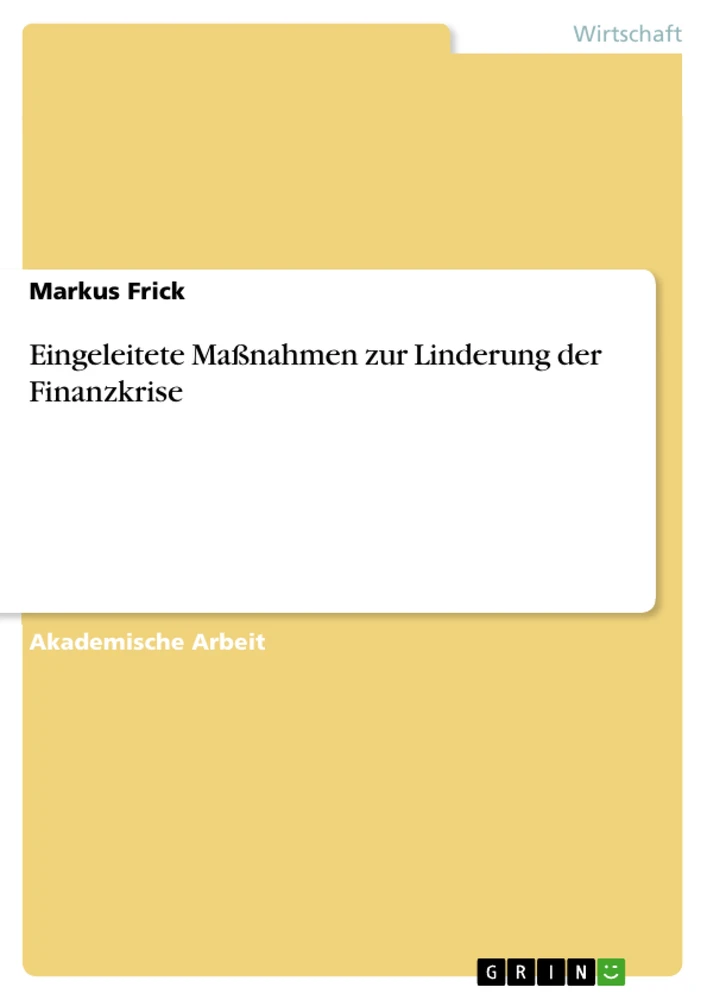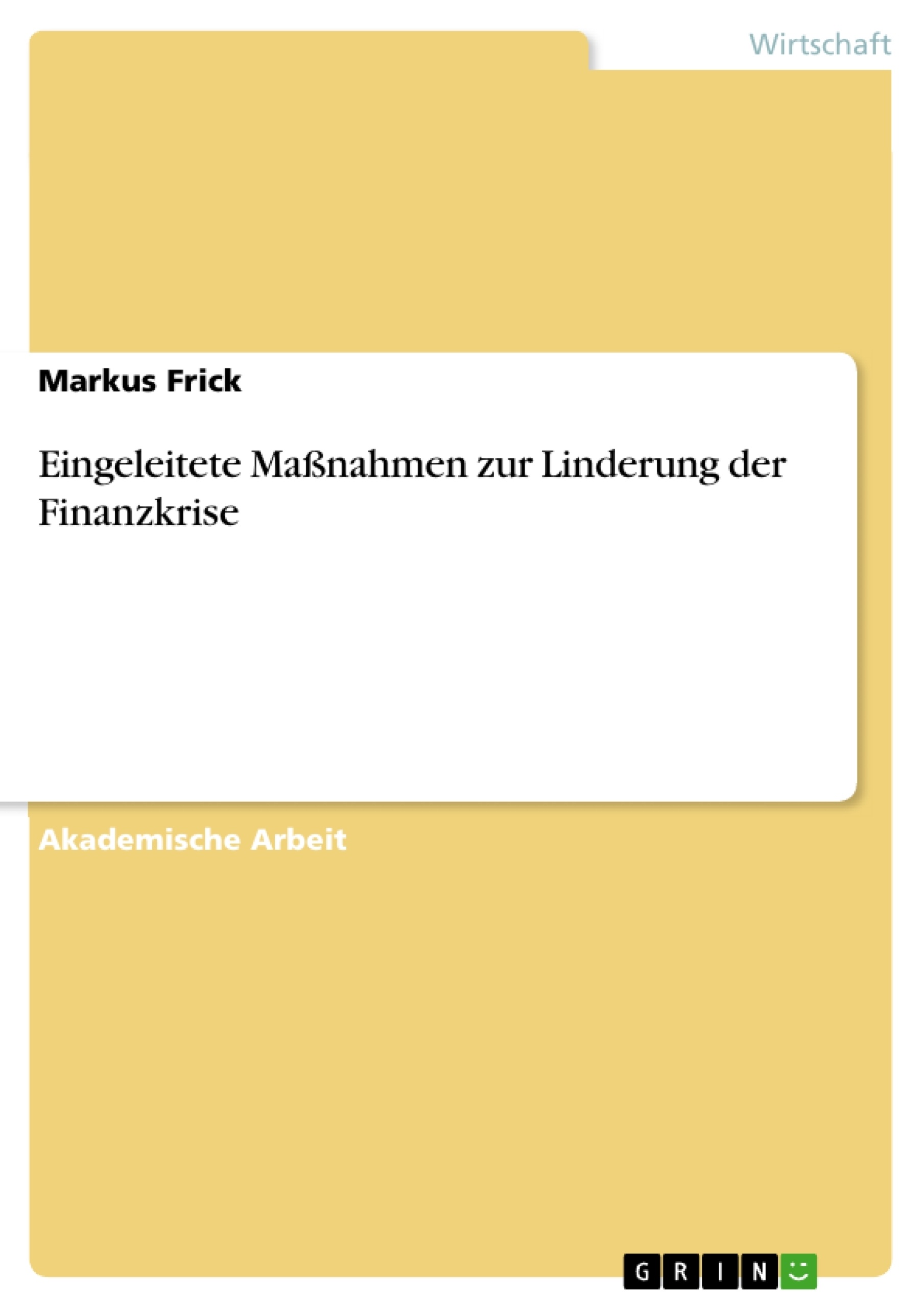Die Arbeit beleuchtet die Maßnahmen der europäischen und US-amerikanischen Zentralbankem sowie der USA und der EU zur Finanzmarktstabilisierung und Konjunkturbelebung im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009. Außerdem werden die eingeleiteten Maßnahmenpakete von Österreich und Deutschland detaillierter beschrieben und analysiert. Die Untersuchung schließt ab mit einer Beschreibung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und dessen Hilfsmaßnahmen.
Aus dem Inhalt:
- Maßnahmen der Zentralbanken und Nationalbanken.
- Maßnahmenpakete der USA und der EU.
- Maßnahmen des IWF.
Inhaltsverzeichnis
- Maßnahmen der Zentralbanken und Nationalbanken
- Einlagensicherung
- Mindestreserve
- Zinsen und Geldmenge
- Federal Reserve (Fed)
- Europäische Zentralbank (EZB)
- Maßnahmenpakete der Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
- Finanzmarktstabilisierung
- Konjunkturpakete
- Maßnahmenpakete der Europäischen Union (EU)
- Österreich
- Maßnahmenpaket: Interbankenmarkt und Finanzmarktstabilität
- Konjunkturpakete
- Deutschland
- Maßnahmenpaket: Interbankenmarkt und Finanzmarktstabilität
- Konjunkturpakete
- Fazit Konjunkturpakete
- Österreich
- Internationaler Währungsfonds (IWF)
- Island
- IWF-Hilfe für weitere Länder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Maßnahmen, die von Zentralbanken, Nationalbanken und internationalen Organisationen zur Bewältigung der Finanzkrise ab 2008 ergriffen wurden. Der Schwerpunkt liegt auf den Reaktionen der USA, der EU und dem Internationalen Währungsfonds (IWF).
- Einlagensicherung und ihre Bedeutung zur Vermeidung von Liquiditätsproblemen im Bankensektor.
- Die Rolle der Zentralbanken als „lender of last resort“ und die Auswirkungen von Zinssenkungen und zusätzlichen Liquiditätshilfen.
- Konjunkturpakete und ihre Bedeutung für die Stabilisierung der Wirtschaft.
- Die Reaktion des Internationalen Währungsfonds (IWF) auf die Finanzkrise und die Unterstützung von Ländern in Not.
- Die Herausforderungen und Folgen der eingeleiteten Maßnahmen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Maßnahmen der Zentralbanken und Nationalbanken zur Bewältigung der Finanzkrise. Es werden insbesondere die Einlagensicherung, die Mindestreserve und die Zinspolitik sowie die Rolle der Zentralbanken als „lender of last resort“ beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Strategien der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).
Kapitel 2 befasst sich mit den Maßnahmenpaketen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Dabei werden die Finanzmarktstabilisierung und die Konjunkturpakete im Detail dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich den Maßnahmenpaketen der Europäischen Union (EU). Es werden die Strategien von Österreich und Deutschland beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Bewältigung der Finanzkrise. Es werden die Hilfsprogramme für Island und andere Länder vorgestellt.
Schlüsselwörter
Finanzkrise, Zentralbanken, Nationalbanken, Einlagensicherung, Mindestreserve, Zinsen, Geldmenge, Federal Reserve (Fed), Europäische Zentralbank (EZB), Maßnahmenpakete, Konjunkturpakete, Internationaler Währungsfonds (IWF), Liquiditätshilfen, Finanzmarktstabilisierung, Weltwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Maßnahmen ergriffen die Zentralbanken in der Finanzkrise 2008?
Zentralbanken wie die Fed und die EZB fungierten als „lender of last resort“, senkten die Zinsen drastisch und stellten massive Liquiditätshilfen für den Bankensektor bereit.
Was war das Ziel der Konjunkturpakete in Deutschland und Österreich?
Die Pakete zielten darauf ab, die Binnennachfrage zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und die Realwirtschaft vor den Folgen des Finanzmarktschocks zu schützen.
Welche Rolle spielte die Einlagensicherung während der Krise?
Die Erhöhung der Einlagensicherung war ein entscheidendes Instrument, um das Vertrauen der Sparer zurückzugewinnen und einen „Bank Run“ zu verhindern.
Wie unterstützte der IWF Länder wie Island?
Der Internationale Währungsfonds stellte Notfallkredite und finanzielle Rettungsschirme bereit, um den Staatsbankrott von besonders hart getroffenen Ländern abzuwenden.
Was versteht man unter Finanzmarktstabilisierung?
Darunter fallen staatliche Maßnahmen wie Bankenrettungen, Garantien für Interbankenkredite und die Übernahme „toxischer“ Wertpapiere zur Sicherung des Finanzsystems.
- Quote paper
- MMag. Markus Frick (Author), 2009, Eingeleitete Maßnahmen zur Linderung der Finanzkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278609