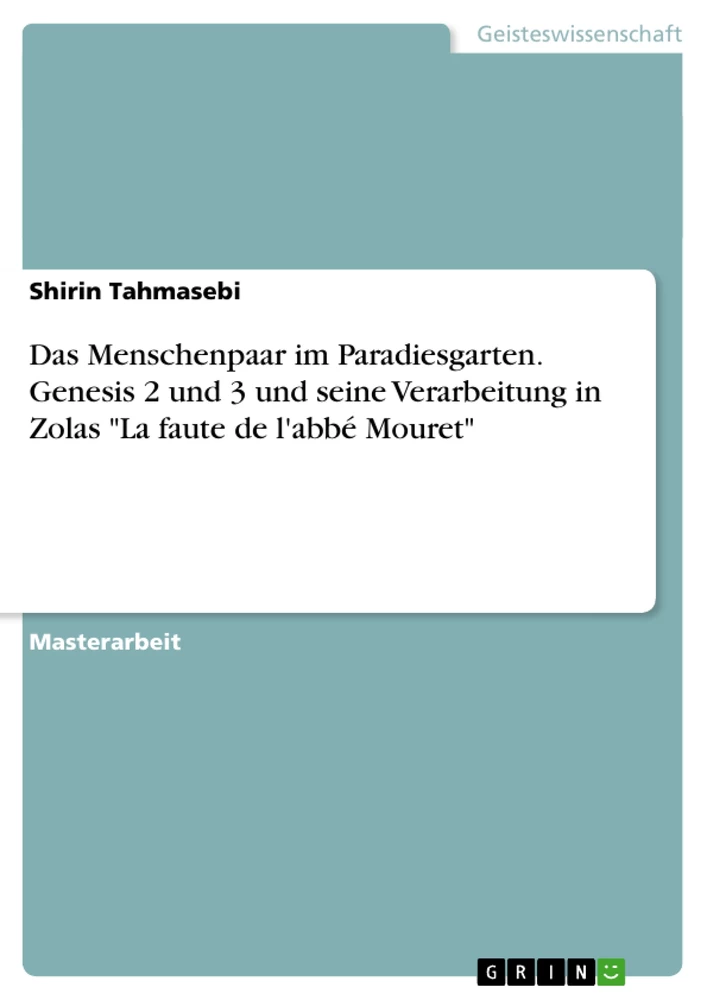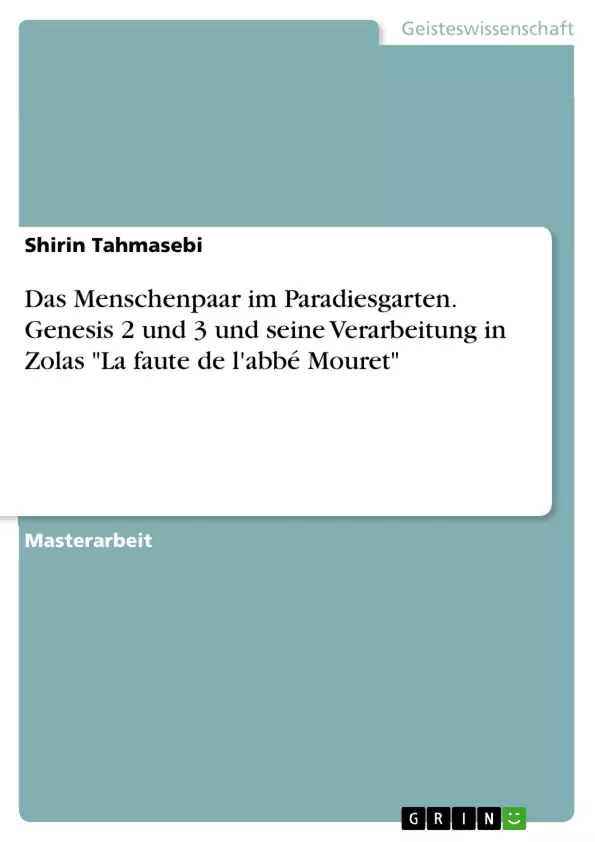Die biblische Paradiesgeschichte mit den zwei Hauptakteuren Adam und Eva, als erstes Menschen-paar, spielt in allen drei großen monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Isalm eine besondere Rolle und kann wohl als einer der bekanntesten Texte der Weltliteratur bezeichnet wer-den. Die Erzählung wird auch als der zweite Schöpfungsbericht oder die Geschichte vom Fall be-zeichnet. Sie ist Teil der Urgeschichte im Buch Genesis und erstreckt sich von Genesis 2,4b – 3,24. Worte wie „Paradies“, „Schlange“, Sünde“ und „Apfel“ rufen bei Vielen die Assoziation mit der Geschichte des ersten Menschenpaares hervor. Doch trotz der scheinbaren Vertrautheit mit der Er-zählung, bietet die knappe, zuweilen lückenhafte Erzählweise, viel Interpretationsspielraum. Be-sonders die Bezeichnung „Schöpfungserzählung“ suggeriert, dass hier von der Entstehung der Welt und seinen Geschöpfen berichtet wird, also vom Anfang der Welt oder „wie alles begann“. Dies ist sicherlich auch impliziert. Dabei geht es nachdem im ersten Schöpfungsbericht die „Entstehung von Himmel und Erde“ oder die „Erschaffung der Welt in sieben Tagen“ geschildert wurde, nun, ohne einen neuen zeitlichen Anfang zu setzten, um die Erschaffung des Menschen. Doch die Gen 2-3 innewohnende Intention ist weniger die Darlegung vom Anfang von Welt und Menschheit, wie es menschlicher Wissbegier entgegenkäme, sondern die Beschreibung gegenwärtiger Lebenswelt und ihrem Ursprung. Damit wohnt der Paradieserzählung die Ätiologie schlechthin inne: „[Sie] gibt eine Erklärung für den jetzigen Zustand der Menschheit, die infolge des Ungehorsams des ersten Menschenpaares gegenüber Gottes Gebot vielen Mühsalen und schließlich dem Tod unterworfen ist.“ Jedoch geht es nicht nur um eine Beschreibung des Zustandes des Menschen, sondern auch um eine Charakterisierung des Menschen an sich. Die Paradieserzählung liefert uns ein Bild davon, was Menschsein bedeutet. Adam und Eva sind nicht nur „unsere Ureltern“ und begründeten den Anfang der Menschheit, „sie präfigurieren vielmehr in unterschiedlichen Facetten, was Menschsein bedeutet- in allen Höhen, Tiefen und Mittelmäßigkeiten.“
Die Genesis und damit auch die Urgeschichte ist ein riesiges zusammenhängendes und doch aus Einzelschriften zusammengestelltes Erzählungswerk. Diese Erzählungen werden nicht nur in der kirchlichen Lehre ausgelegt, sondern dienen auch „in vielfältiger Weise [als] Quelle künstlerischer Inspiration“ . So auch für den französischen Natural
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die biblische Paradieserzählung Genesis 2, 4b – 3,24
- Übersetzung
- Entstehungsgeschichte
- Der erzählerische Aufbau
- Auslegung
- Die Erschaffung des Menschen und sein Lebensraum (Gen 2,4b-17)
- Der Garten Eden
- Die Bäume im Garten (Gen 2,9-14)
- Die Erschaffung der Frau (Gen 2,18-25)
- Mann und Frau
- Der Ausgangspunkt vor dem Fall und Rückgriff auf das Gebot in Gen 2,17
- Der Fall und das Verhör (Gen 3,1-7)
- Die Schlange und ihre List / Der nach Erkenntnis verlangende Mensch
- Die Schuldfrage
- Die Konsequenzen des Vergehens: Die Vertreibung / Flüche (Gen 3,22-24)
- Menschenbild
- Die Verarbeitung der Paradieserzählung in „La Faute de l'Abbé Mouret“
- Einleitung
- Zola und der Naturalismus
- Die Handlung des Romans
- Skizzierung des Aufbaus des Romans
- Biblische Mythologie im Roman
- Parallelen außerhalb des zweiten Buches
- Parallelen im zweiten Buch
- Das Paradies, „le paradou“
- Serge und Albine alias Adam und Eva?
- Der Sündenfall
- Liebe und Sexualität
- Intention des Romans
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die biblische Paradieserzählung aus Genesis 2,4b-3,24 und deren literarische Verarbeitung in Émile Zolas Roman „La Faute de l'Abbé Mouret“. Ziel ist es, die Parallelen und Unterschiede zwischen der biblischen Erzählung und Zolas Interpretation herauszuarbeiten und das Menschenbild in beiden Texten zu analysieren.
- Exegese der biblischen Paradieserzählung
- Analyse des erzählerischen Aufbaus und der Intention der Genesis-Erzählung
- Interpretation des Menschenbildes in der Genesis-Erzählung
- Vergleich der Paradieserzählung mit Zolas Roman „La Faute de l'Abbé Mouret“
- Analyse der gesellschaftlichen Perspektive in Zolas Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung der Paradieserzählung in den drei monotheistischen Religionen. Sie hebt die Vieldeutigkeit des Textes und die unterschiedlichen Interpretationsspielräume hervor. Der Fokus liegt auf der Frage nach dem Menschenbild und der Verarbeitung der Geschichte in Zolas Roman „La Faute de l'Abbé Mouret“. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der eine Exegese der biblischen Erzählung mit einer Analyse von Zolas Werk verbindet.
Die biblische Paradieserzählung Genesis 2, 4b – 3,24: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Exegese der Paradieserzählung. Es beinhaltet eine Übersetzung des relevanten Abschnitts aus Genesis, untersucht die Entstehungsgeschichte und den Aufbau der Erzählung und interpretiert zentrale Aspekte wie die Erschaffung des Menschen, die Rolle des Gartens Eden, die Schöpfung der Frau, das Gebot Gottes, den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies und das dargestellte Menschenbild. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Deutungsmöglichkeiten des Textes.
Die Verarbeitung der Paradieserzählung in „La Faute de l'Abbé Mouret“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Émile Zola und den Naturalismus, bevor es die Handlung und den Aufbau von Zolas Roman „La Faute de l'Abbé Mouret“ zusammenfasst. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der biblischen Mythologie im Roman. Es werden Parallelen und Unterschiede zwischen der biblischen Erzählung und Zolas Werk herausgearbeitet, insbesondere hinsichtlich der Figuren Serge und Albine als Gegenstücke zu Adam und Eva, der Darstellung des Paradieses und des Sündenfalls. Die Analyse befasst sich kritisch mit Zolas Intention und der gesellschaftlichen Perspektive seiner Interpretation der Paradieserzählung.
Schlüsselwörter
Paradieserzählung, Genesis, Émile Zola, La Faute de l'Abbé Mouret, Naturalismus, Adam, Eva, Schöpfung, Sündenfall, Menschenbild, Biblische Mythologie, Gesellschaftkritik, Interpretation, Exegese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die Verarbeitung der Paradieserzählung in Émile Zolas 'La Faute de l'Abbé Mouret'"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die biblische Paradieserzählung (Genesis 2,4b-3,24) und deren literarische Umsetzung in Émile Zolas Roman "La Faute de l'Abbé Mouret". Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Texte, der Analyse der Parallelen und Unterschiede, sowie einer eingehenden Betrachtung des Menschenbildes in beiden Werken.
Welche Aspekte der biblischen Paradieserzählung werden behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Exegese der Paradieserzählung. Analysiert werden die Entstehungsgeschichte, der erzählerische Aufbau, die Erschaffung Adams und Evas, der Garten Eden, der Sündenfall, die Folgen des Ungehorsams und das in der Erzählung vermittelte Menschenbild. Unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten des Textes werden beleuchtet.
Wie wird Zolas Roman "La Faute de l'Abbé Mouret" in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit analysiert Zolas Roman im Kontext des Naturalismus. Es wird die Handlung des Romans zusammengefasst und der Aufbau skizziert. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung biblischer Mythologie in Zolas Werk. Parallelen und Unterschiede zwischen der biblischen Erzählung und Zolas Interpretation werden herausgearbeitet, insbesondere im Hinblick auf die Figuren Serge und Albine, die Darstellung des Paradieses und des Sündenfalls. Zolas Intention und die gesellschaftliche Perspektive seiner Interpretation werden kritisch untersucht.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine exegetische Analyse der biblischen Paradieserzählung mit einer literaturwissenschaftlichen Analyse von Zolas Roman. Es wird ein vergleichender Ansatz verfolgt, um Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Texten aufzuzeigen und das jeweilige Menschenbild zu analysieren.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Paradieserzählung, Genesis, Émile Zola, "La Faute de l'Abbé Mouret", Naturalismus, Adam und Eva, Schöpfung, Sündenfall, Menschenbild, biblische Mythologie, Gesellschaftskritik, Interpretation und Exegese.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur biblischen Paradieserzählung, ein Kapitel zur Verarbeitung der Erzählung in Zolas Roman und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Parallelen und Unterschiede zwischen der biblischen Paradieserzählung und Zolas Interpretation herauszuarbeiten und das Menschenbild in beiden Texten zu analysieren. Sie untersucht die literarische Verarbeitung eines biblischen Mythos in einem naturalistischen Roman.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Theologie, Literaturwissenschaft und vergleichender Religionswissenschaft, die sich für die biblische Paradieserzählung, den Naturalismus und die literarische Verarbeitung religiöser Motive interessieren.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Shirin Tahmasebi (Auteur), 2014, Das Menschenpaar im Paradiesgarten. Genesis 2 und 3 und seine Verarbeitung in Zolas "La faute de l'abbé Mouret", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278661