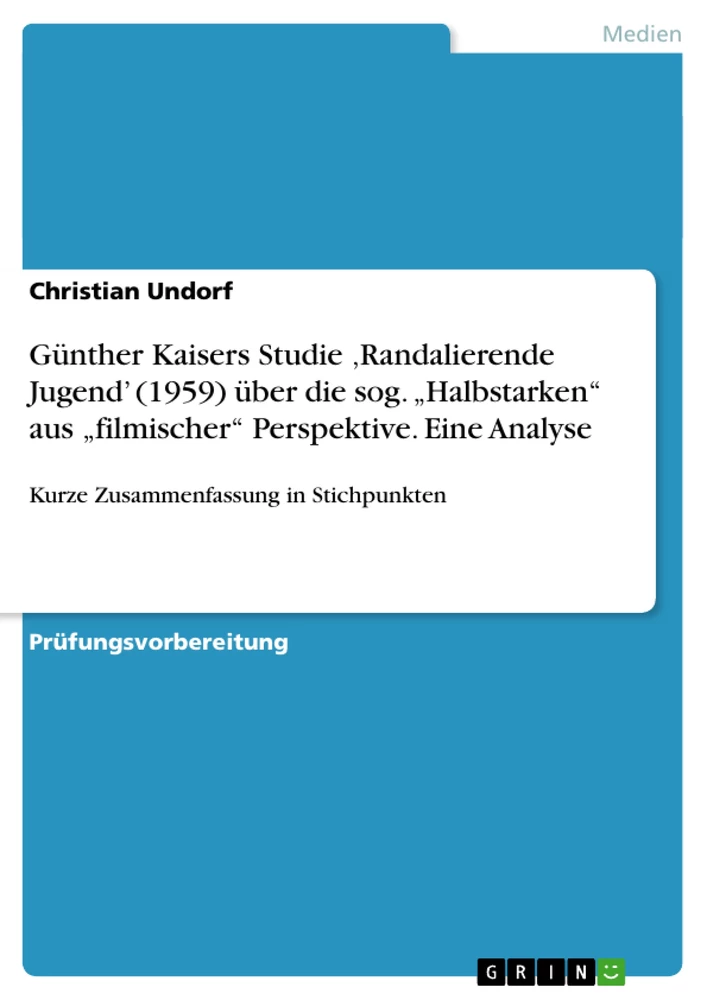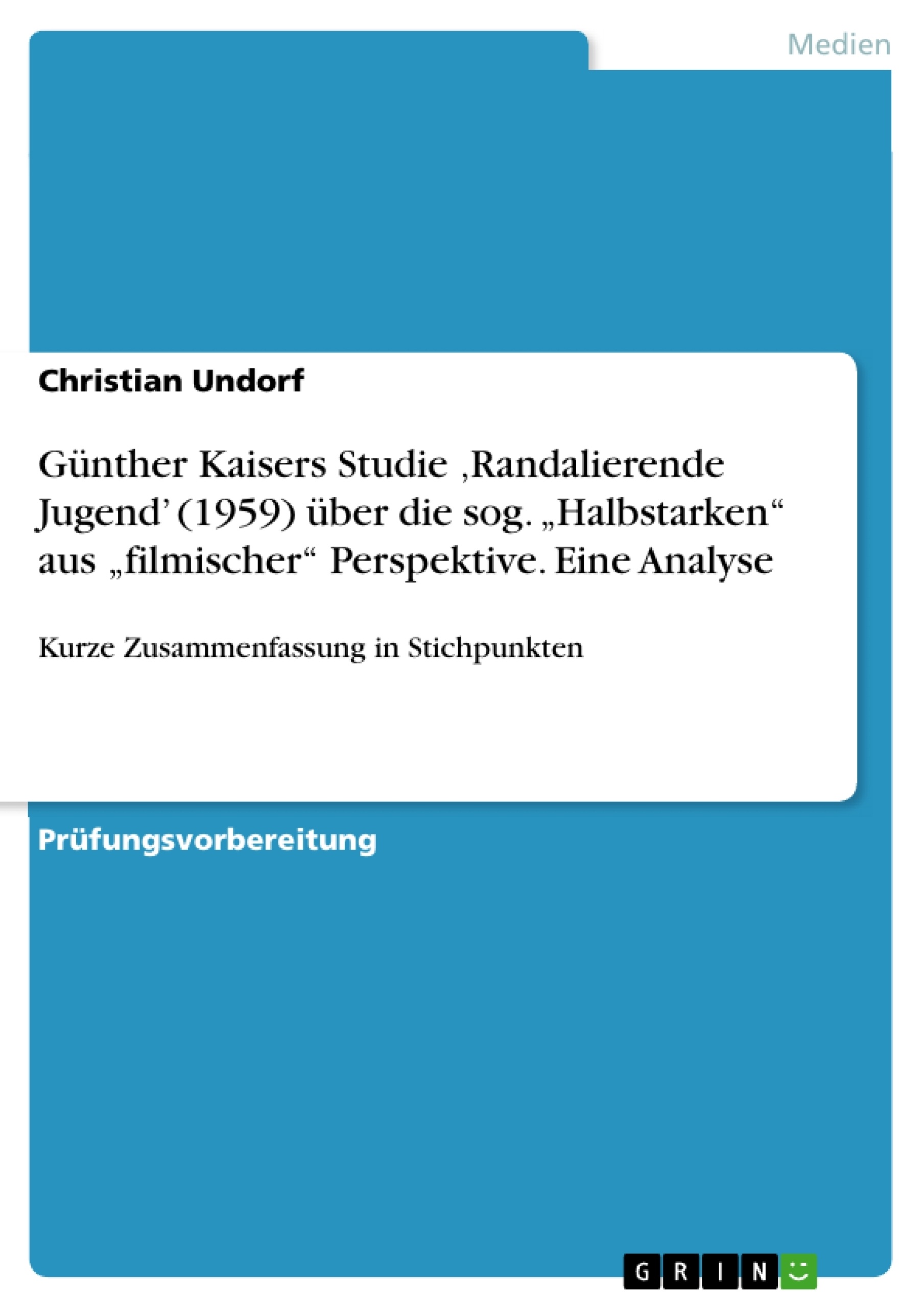Eine kurze Zusammenfassung in Stichpunkten der Analyse von Günther Kaisers Studie ‚Randalierende Jugend’ (1959) über die sog. „Halbstarken“ aus „filmischer“ Perspektive
Inhaltsverzeichnis
- Günther Kaisers, Einleitung' – die Eröffnungssequenz unseres ,,Films"
- Etymologische Bestimmung des Begriffs „halbstark"
- Ergebnisse der Untersuchung werden vorweggenommen und in 10 Thesen vorab behauptet
- Der Hauptteil – die „Story“ kommt ins Laufen
- Phänomenologischer Teil – direkter Einstieg in das Geschehen auf der Straße
- 21 konkrete Fallbeispiele erzeugen Plastizität und vermitteln ein scheinbar authentisches Bild „halbstarken“ Verhaltens
- ,,Halbstarke" Verhaltensweisen erfüllen laut Kaiser in meisten Fällen strafrechtliche Tatbestände
- schließlich: räumliche & zeitliche Einordnung der Problematik anhand empirischer Untersuchungen/Statistiken
- Anthropologischer Teil - der Protagonist erhält mehr „Tiefe"
- Meinungsbild der Öffentlichkeit (Presse, Film, Stellungnahmen von Politikern etc.)
- eigene Auswertung von 645 Ermittlungs- & Strafakten aus über 20 dt. Städten
- Ätiologischer Teil - wir lernen die,,Vorgeschichte“ kennen
- keine pathologischen Ursachen des „,Halbstarken“-Phänomens
- unmittelbare „Auslöser“: Rolle der Publizität/Berichterstattung
- Kaiser sieht aber vor allem die Familie/den Erzieher in der Pflicht, um der „inneren Verwaisung“ (S.207) entgegenzuwirken
- Wurzeln der „Halbstarken“-Erscheinung in Entstehung der Industriegesellschaft
- Abschließender Teil - doch noch ein, Happy End'?
- „Sozialgefährlichkeit“ der Halbstarken nicht erheblich; Bereich der Kleinkriminalität
- Vorschläge von Kaiser: schnelle Ahndung („Strafe auf dem Fuße“, S.222);
- Fazit/Abschließende Überlegungen
- Die Konstruktion des „Halbstarken“ als filmischer Protagonist
- Die Rolle der Quellen und Statistiken in der Darstellung der „Halbstarken“
- Die Verwendung von filmischen Erzähltechniken in der wissenschaftlichen Argumentation
- Die Frage nach der Objektivität und der kulturellen Prägung der Studie
- Die Bedeutung der Studie für das Verständnis der Jugendkultur der 1950er Jahre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Günther Kaisers Studie „Randalierende Jugend“ (1959) aus filmischer Perspektive. Ziel ist es, die Studie als narrative Struktur zu betrachten und die Darstellung der „Halbstarken“ als filmische Erzählung zu dekonstruieren. Dabei werden die verschiedenen Elemente der Studie, wie die Einleitung, der Hauptteil und das Fazit, als Sequenzen eines Films betrachtet, um die Dramaturgie der wissenschaftlichen Argumentation zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Studie dient als Eröffnungssequenz des „Films“, in der der Begriff „Halbstark“ etymologisch bestimmt und die Ergebnisse der Untersuchung in 10 Thesen vorweggenommen werden. Der Hauptteil der Studie, die „Story“ des Films, beginnt mit einem phänomenologischen Teil, der die „Halbstarken“ als Phänomen auf der Straße beschreibt. 21 konkrete Fallbeispiele erzeugen Plastizität und vermitteln ein scheinbar authentisches Bild „halbstarken“ Verhaltens. Kaiser argumentiert, dass „Halbstarken“ Verhaltensweisen in den meisten Fällen strafrechtliche Tatbestände erfüllen und somit Teilbereich der Jugendkriminalität sind. Der Hauptteil der Studie beinhaltet auch einen anthropologischen Teil, der die „Halbstarken“ als Protagonisten mit „Tiefe“ darstellt. Kaiser analysiert das Meinungsbild der Öffentlichkeit und führt eigene Auswertungen von Ermittlungsakten durch, um die sozialen und familiären Hintergründe der „Halbstarken“ zu beleuchten. Der ätiologische Teil der Studie, die „Vorgeschichte“ des Films, untersucht die Ursachen des „Halbstarken“-Phänomens. Kaiser argumentiert, dass die Publizität, der Rock'n'Roll und die Gruppen- & Massensituation als unmittelbare „Auslöser“ des Phänomens fungieren. Er sieht aber vor allem die Familie/den Erzieher in der Pflicht, um der „inneren Verwaisung“ entgegenzuwirken. Die Wurzeln des Phänomens sieht Kaiser in der Entstehung der Industriegesellschaft, die zu Unbefriedigung und Wunsch nach Selbstverwirklichung führt. Der abschließende Teil der Studie, das „Happy End“ des Films, stellt die „Sozialgefährlichkeit“ der Halbstarken in Frage und schlägt Maßnahmen zur Behandlung und Prävention vor. Kaiser plädiert für schnelle Ahndung, erzieherische Bewährungsaufsicht und Eingriffe in das Berufsleben. Er sieht jedoch nur „verhaltenen Optimismus“ hinsichtlich einer Lösung der Problematik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Halbstarken“, die Jugendkultur der 1950er Jahre, die Jugendkriminalität, die Rolle der Familie und der Erziehung, die Auswirkungen der Industriegesellschaft, die Medien und die Publizität, der Rock'n'Roll, die filmische Erzählweise und die Dramaturgie der Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die "Halbstarken" in den 1950er Jahren?
"Halbstarke" war ein Begriff für Jugendliche der 1950er Jahre, die durch auffälliges, teils randalierendes Verhalten in der Öffentlichkeit und eine Abkehr von traditionellen Werten auffielen.
Was ist der Kern von Günther Kaisers Studie "Randalierende Jugend"?
Kaiser analysierte empirisch das Phänomen der Halbstarken, untersuchte Ursachen wie die Industriegesellschaft und familiäre Probleme und ordnete ihr Verhalten meist der Kleinkriminalität zu.
Welche Rolle spielt der Rock 'n' Roll in Kaisers Analyse?
Kaiser sah im Rock 'n' Roll und der damit verbundenen Publizität unmittelbare Auslöser für die emotionalen Ausbrüche und Gruppenbildungen der Jugendlichen.
Was meint Kaiser mit dem Begriff der "inneren Verwaisung"?
Damit beschreibt er einen Mangel an Erziehung und emotionaler Bindung innerhalb der Familie, den er als eine der Hauptursachen für das Abgleiten in jugendliches Fehlverhalten ansieht.
Welche Maßnahmen schlug Kaiser zur Behandlung des Problems vor?
Er plädierte für eine "Strafe auf dem Fuße" (schnelle Ahndung), erzieherische Bewährungsaufsicht und eine stärkere Einbindung der Jugendlichen in das Berufsleben.
- Arbeit zitieren
- Christian Undorf (Autor:in), 2008, Günther Kaisers Studie ‚Randalierende Jugend’ (1959) über die sog. „Halbstarken“ aus „filmischer“ Perspektive. Eine Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278722