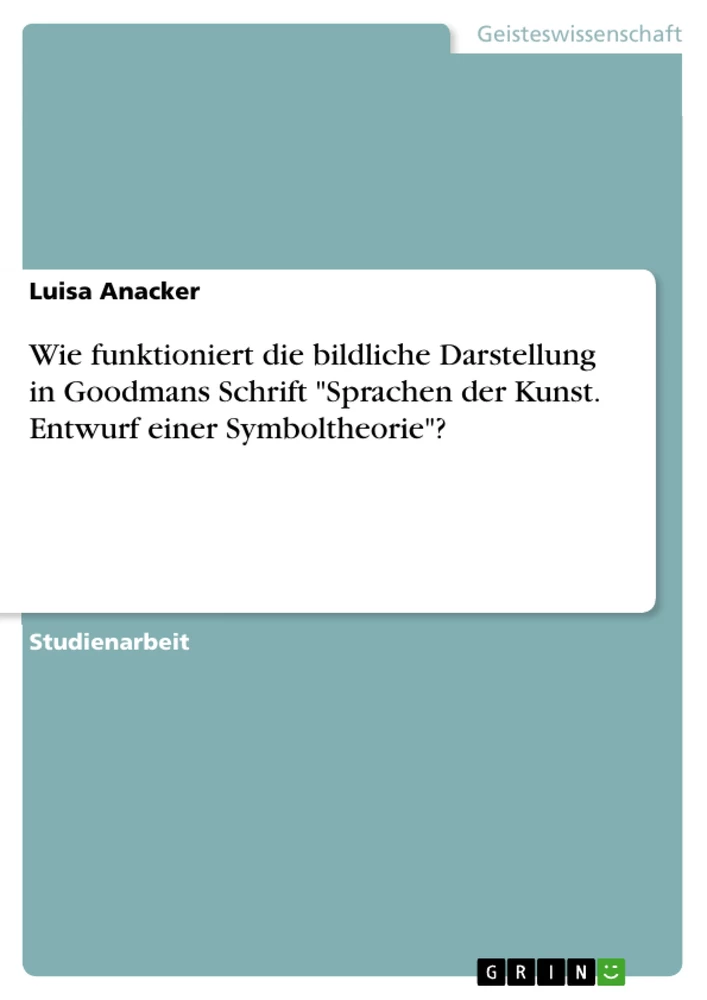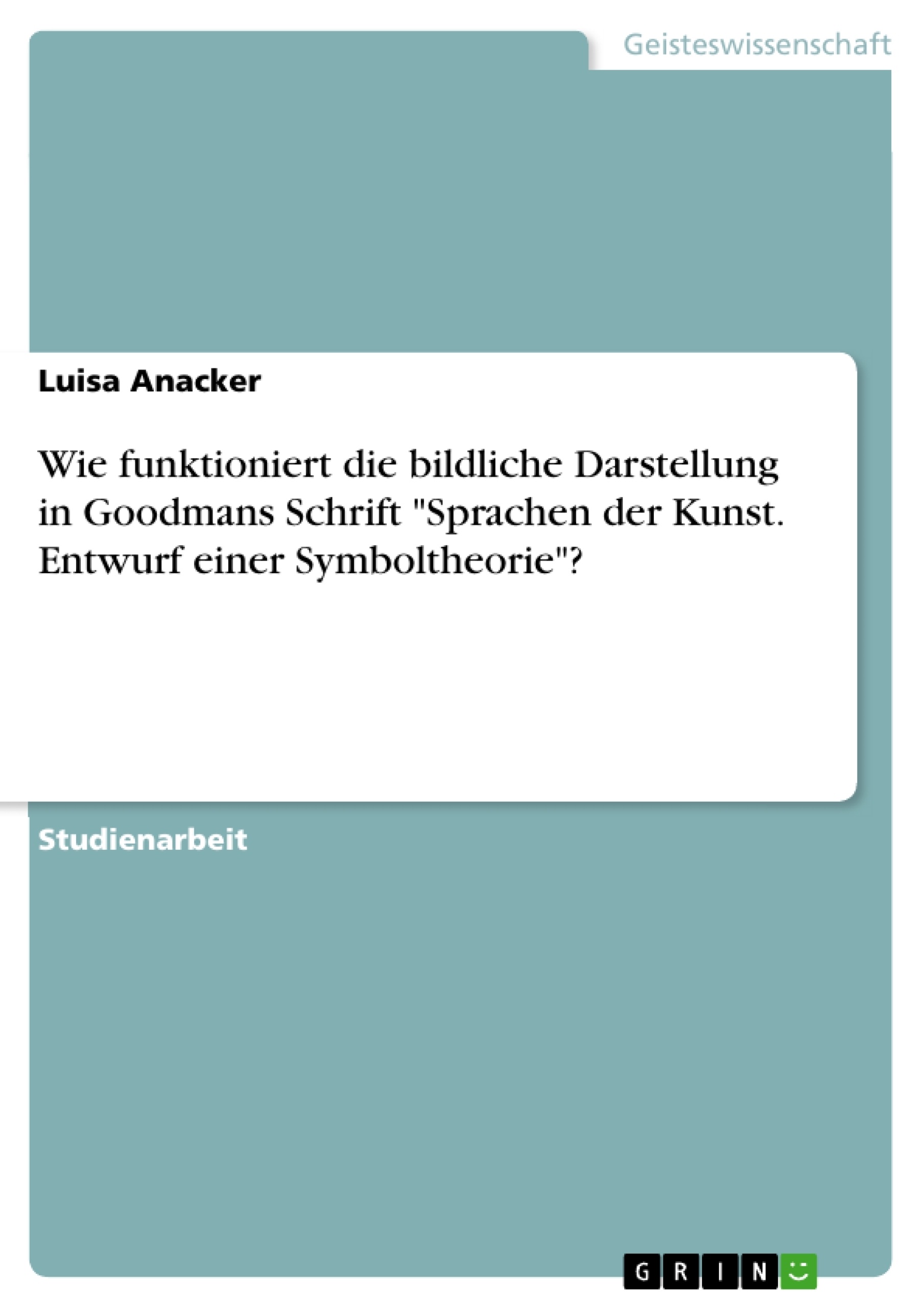Meine Arbeit bezieht sich auf das 1. Kapitel "Wiedererzeugte Wirklichkeit" von Nelson Goodman aus dem Werk „Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (Originalausgabe 1968)“ . Im ersten Kapitel analysiert Goodman die Repräsentationsweise von Bildern. Die bildliche Darstellung erklärt Goodman als eine Art der Repräsentationsweise in der Kunst. Bilder gestalten die „Welt“. Sie bestimmen unser gesamtes Umfeld und sie dienen neben der Sprache, als „zweitgrößte Kulturleistung“ . Bilder sind nach Goodman an der Schöpfung der Welt beteiligt und können neue Einsichten und Sichtweisen vermitteln in der Welt erzeugen.
Die Theorie des Bildes ist noch sehr unerforscht. Die Analyse Goodmans leistet hierfür einen bedeutenden Beitrag zur Klärung der Fragen „Was ist eine bildliche Darstellung?“ und „Wie funktionieren bildliche Darstellungen?“. In seinem Mittelpunkt steht dabei die Analyse der „Natur der Repräsentation“, mit ihrer untergeordneten Denotation. Goodman grenzt sich hierbei gegen die Annahme der traditionellen „Mimesistheorie“ ab, die Kunst als Nachahmung der Natur benannt hat, wonach Repräsentation über die Ähnlichkeit definiert wird. Goodman sieht sich gezwungen, nachdem die Ähnlichkeitstheorie erfolgreich von der bildlichen Darstellung verbannt wurde, auch Bilder zu berücksichtigen, die nicht existierende Gegenstände abbilden: Bilder, die Fiktionen darstellen und Bilder in denen „x- als“ etwas repräsentiert wird. Die Problematik der Denotation, dass sie keinen Bezugsgegenstand bei Bildern dieser Art hat, wird über das klassifizieren der Bilder gelöst. Auch wenn hier die vorherig bestimmte Bezugnahme, die dafür steht, dass etwas als ein Bild gilt, nicht mehr von Notwendigkeit ist, ist das, was ein Bild eines z. B. Zentauren ausmacht, nicht die Ähnlichkeit, sondern , nach Goodman die Einteilung in die Art des Bildes. Die Einteilung von Bildern in Arten unter Klassifizierung wird hierbei durch die Etikettierung vereinfacht. Die Etikettierung der Gegenstände ist damit an der Organisation der Welt beteiligt. Über die Neukombination von alten Etiketten mit neuen ist das Entstehen der Kunst gewährleistet. Das schließt an der Ausgangsfrage an, ab wann ein Bild die Wirklichkeit darstellt und wann ein Bild dem Realismus entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Repräsentation
- Denotation
- Nachahmungstheorie
- Repräsentation - als
- Die Etikettierung von bildlicher Darstellung
- Realismus
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Repräsentationsweise von Bildern im ersten Kapitel von Nelson Goodmans Werk "Sprachen der Kunst". Goodman untersucht die bildliche Darstellung als eine Form der Repräsentation in der Kunst und beleuchtet die Rolle von Bildern bei der Gestaltung unserer Welt und der Vermittlung neuer Perspektiven.
- Die Natur der Repräsentation und ihre Beziehung zur Denotation
- Kritik an der traditionellen Mimesistheorie und die Abgrenzung von der Ähnlichkeitstheorie
- Die Bedeutung der Klassifizierung und Etikettierung von Bildern für die Repräsentation
- Die Relativität des Realismus und die Rolle von Sehgewohnheiten, Kultur und Zeit
- Die Rolle von Bildern bei der Schöpfung der Welt und der Vermittlung neuer Einsichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Repräsentation von Bildern ein und stellt Goodmans Analyse des ersten Kapitels "Wiedererzeugte Wirklichkeit" aus dem Werk "Sprachen der Kunst" vor. Goodman argumentiert, dass Bilder eine wichtige Rolle bei der Gestaltung unserer Welt spielen und neben der Sprache als "zweitgrößte Kulturleistung" gelten. Die Theorie des Bildes ist noch weitgehend unerforscht, und Goodmans Analyse leistet einen wichtigen Beitrag zur Klärung der Fragen "Was ist eine bildliche Darstellung?" und "Wie funktionieren bildliche Darstellungen?".
Das Kapitel "Repräsentation" befasst sich mit der Kritik an der traditionellen Abbildtheorie, die Repräsentation über Ähnlichkeit definiert. Goodman argumentiert, dass Repräsentation nicht über Ähnlichkeit definiert werden kann, da sie unterschiedliche Relationen herstellt. Ein Bild kann ein Objekt repräsentieren, ohne ihm ähnlich zu sein, und umgekehrt kann ein Objekt einem Bild ähnlich sein, ohne von diesem repräsentiert zu werden. Die Ähnlichkeit ist weder hinreichende Bedingung für Repräsentation noch notwendig für Bezugnahme.
Häufig gestellte Fragen
Welche Theorie lehnt Nelson Goodman ab?
Goodman lehnt die traditionelle Mimesistheorie ab, die Repräsentation allein über Ähnlichkeit definiert.
Was ist "Denotation" bei Goodman?
Denotation ist der Kern der Repräsentation; sie beschreibt die Beziehung zwischen einem Symbol (Bild) und dem, worauf es sich bezieht.
Wie erklärt Goodman Bilder von fiktiven Objekten?
Fiktive Darstellungen (wie Zentauren) werden über die Klassifizierung und Etikettierung gelöst; es handelt sich um eine bestimmte Art von Bild, auch ohne realen Bezugsgegenstand.
Was bedeutet "Repräsentation-als"?
Es beschreibt die Weise, wie ein Gegenstand in einem Bild als etwas Bestimmtes dargestellt wird, was über die reine Abbildung hinausgeht.
Was sagt Goodman über den Realismus in der Kunst?
Realismus ist bei Goodman relativ und hängt von Sehgewohnheiten, Kultur und der Beherrschung des jeweiligen Symbolsystems ab.
- Arbeit zitieren
- Luisa Anacker (Autor:in), 2013, Wie funktioniert die bildliche Darstellung in Goodmans Schrift "Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie"?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278878