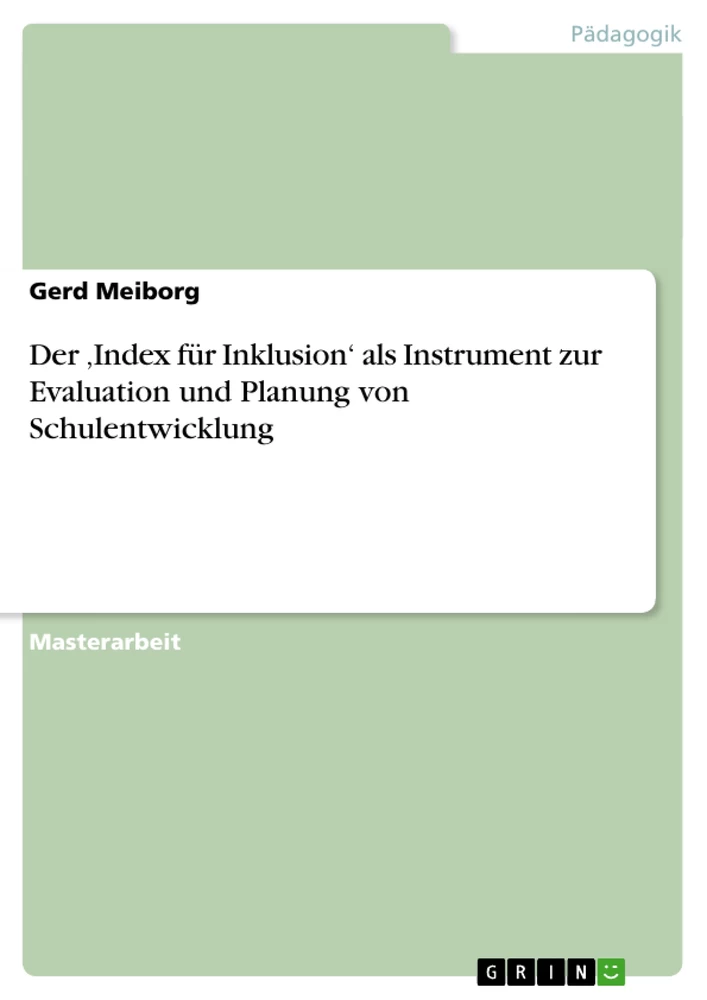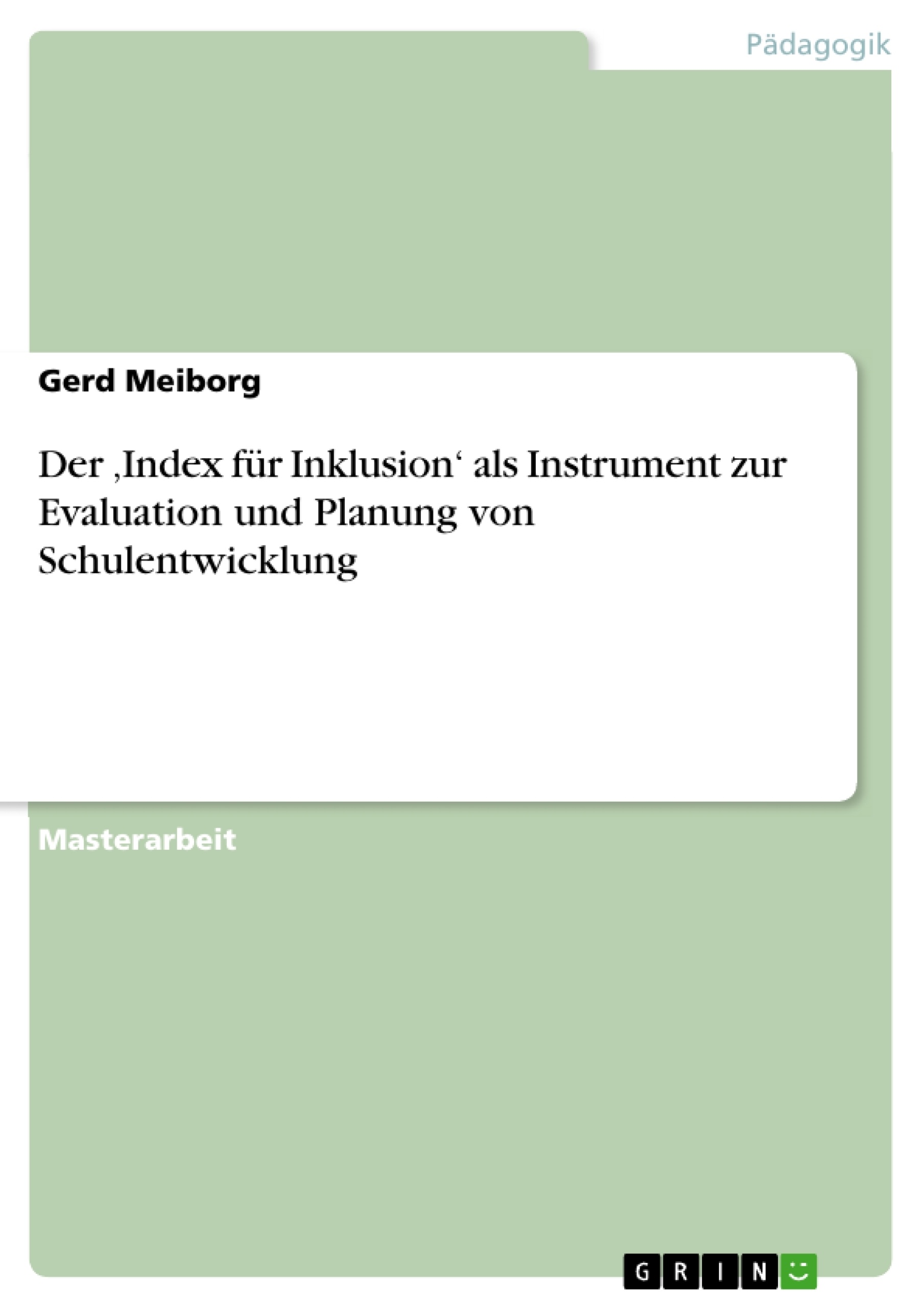Bereits einige Jahre vor Einsetzen der aktuellen Diskussion um das Thema Inklusion und dessen Umsetzung in Schule und Gesellschaft in Deutschland taucht der Begriff ‚inklusiv‘ 2006 im Konzept der damals neu zu gründenden evangelischen Grundschule, Heinrich-Albertz-Schule, auf. Profilbildendes Merkmal dieser Schule sollte – ganz im Sinne der ‚Pädagogik der Vielfalt‘ – die Einbeziehung aller Kinder in ihrer individuellen Unterschiedlichkeit als gleichwertige Mitglieder der Schulgemeinschaft sein, ohne dabei vordergründig Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen im Blick zu haben.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den ‚Index für Inklusion‘ als Instrument zur Planung und Evaluation für die Schulentwicklung am Beispiel der evangelischen Heinrich-Albertz-Grundschule vorzustellen. Dazu erfolgt in Kapitel 2 eine kurze Beschreibung der Heinrich-Albertz-Schule, an der der Index für Inklusion eingesetzt wird. Kapitel 3 widmet sich zunächst der Klärung und Eingrenzung des Begriffs Inklusion (3.1), um anschließend den ‚Index für Inklusion‘ (Index) vorzustellen (3.2). In Kapitel 4 wird ausführlich dargestellt, wie mit dem Index an der Schule gearbeitet und er als Instrument im Rahmen von Schulentwicklung genutzt wird. Dabei werden die Phasen bei der Arbeit mit dem Index mit ihren Ergebnissen dargestellt und diskutiert: Phase 1 – Mit dem Index beginnen (4.1), Phase 2 – Die Schulsituation beleuchten (4.2) und Phase 3 – Ein inklusives Schulprogramm entwerfen (4.3). Im Rahmen der Phase 2 wird in die Konzeption der empirischen Erhebung eingeführt, deren Ergebnisse (4.2.1) als beispielhaft und um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, auf die Darstellung der Schulkultur (Dimension A), die als „Herzstück einer inklusiven Schule" gilt, beschränkt wird. Der ‚Schulentwicklungstag‘ bildet den Übergang von Phase 2 zu Phase 3 bei der Arbeit mit dem ‚Index‘ und wird daher mit seinen Ergebnissen in Kapitel 4.2.2 ausführlich beschrieben.
Der Abschnitt ‚Fazit und Ausblick‘ (Kap. 5) geht der Frage nach, welche Vorteile aber auch welche Schwierigkeiten sich bei der Arbeit mit dem ‚Index für Inklusion‘ ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Heinrich-Albertz-Schule
- Inklusion
- Begriffsklärung
- Der „Index für Inklusion“
- Die Arbeit mit dem Index für Inklusion
- Phase 1: Mit dem Index beginnen
- Hintergrund
- Umsetzung an der Heinrich-Albertz-Schule
- Ergebnisse
- Konsequenzen und weitere Schritte
- Phase 2: Die Schulsituation beleuchten
- Empirische Bestandsaufnahme
- Methoden
- Fragebögen und Operationalisierung
- Datenerhebung, -erfassung und -auswertung
- Ergebnisse
- Diskussion
- Der Schulentwicklungstag
- Hintergrund
- Durchführung
- Ergebnisse
- Empirische Bestandsaufnahme
- Phase 3: Ein inklusives Schulprogramm entwerfen
- Hintergrund und Vorgehen
- SMARTE Ziele
- Umsetzungsplanung
- Ergebnisse des Schulentwicklungstages und Stand der Umsetzung
- Phase 1: Mit dem Index beginnen
- Die Arbeit mit dem Index für Inklusion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des „Index für Inklusion“ als Instrument zur Planung und Evaluation von Schulentwicklung an der evangelischen Heinrich-Albertz-Schule in Salzgitter. Das Hauptziel besteht darin, die Anwendung des Index in den verschiedenen Phasen der Schulentwicklung zu dokumentieren und zu analysieren.
- Der Einsatz des „Index für Inklusion“ als Schulentwicklungsinstrument
- Die empirische Erfassung der Schulsituation mittels des Index
- Die Entwicklung eines inklusiven Schulprogramms basierend auf den Index-Ergebnissen
- Die Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung inklusiven Denkens und Handelns
- Die Reflexion des Prozesses und Ausblick auf weitere Schritte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehungsgeschichte der Heinrich-Albertz-Schule mit ihrem frühen Fokus auf Inklusion und die Integration des „Index für Inklusion“ als Folge der UN-Behindertenrechtskonvention. Sie skizziert den Hintergrund des Autors, seine Erfahrungen mit Schulentwicklung und Evaluationsmethoden und seine Motivation, den Index an seiner Schule anzuwenden. Die Arbeit wird als Fallstudie vorgestellt, die den Einsatz des Index in den verschiedenen Phasen seiner Anwendung detailliert darstellt.
Die Heinrich-Albertz-Schule: Dieses Kapitel bietet eine kurze Beschreibung der Heinrich-Albertz-Schule, ihrer Struktur und ihres Kontextes, um das Verständnis der folgenden Kapitel zu erleichtern. Es stellt den Rahmen dar, in dem der "Index für Inklusion" angewandt wurde. Das Kapitel liefert relevante Hintergrundinformationen zur Schule und ihrer Ausrichtung im Hinblick auf inklusive Pädagogik.
Inklusion: Dieses Kapitel dient der Begriffsbestimmung von Inklusion. Es klärt die Bedeutung des Begriffs und grenzt ihn von anderen Konzepten ab. Die Klärung dieser Definition ist essentiell für das Verständnis der Anwendung des Index und dessen Bezug zu inklusiver Schulentwicklung.
Der „Index für Inklusion“: Dieses Kapitel stellt den „Index für Inklusion“ als Instrument vor und beschreibt seine Struktur und Funktionsweise. Es erläutert die verschiedenen Dimensionen und Indikatoren des Index und zeigt auf, wie er für die Planung und Evaluation von Schulentwicklungsprozessen eingesetzt werden kann. Die theoretischen Grundlagen des Index werden hier dargelegt und bilden die Basis für die anschließende Fallstudie.
Die Arbeit mit dem Index für Inklusion: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Anwendung des „Index für Inklusion“ an der Heinrich-Albertz-Schule. Es gliedert sich in drei Phasen: Phase 1 – der erste Kontakt und die Identifizierung relevanter Indikatoren; Phase 2 – die Bestandsaufnahme der Schulsituation mittels empirischer Methoden (Fragebögen an Eltern und Schüler) und die Stärken-Schwächen Analyse; und Phase 3 – die Entwicklung eines inklusiven Schulprogramms mit SMARTE-Zielen. Jede Phase wird anhand von Ergebnissen und Diskussionen analysiert, wodurch ein ganzheitlicher Überblick über die Implementierung des Index gegeben wird.
Schlüsselwörter
Inklusion, Index für Inklusion, Schulentwicklung, Evaluation, inklusive Pädagogik, empirische Forschung, Heinrich-Albertz-Schule, Schulprogramm, SMARTE Ziele, Schulkultur, Partizipation.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit "Der Index für Inklusion an der Heinrich-Albertz-Schule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert und analysiert den Einsatz des „Index für Inklusion“ als Instrument zur Planung und Evaluation von Schulentwicklung an der evangelischen Heinrich-Albertz-Schule in Salzgitter. Sie beschreibt die Anwendung des Index in den verschiedenen Phasen der Schulentwicklung und untersucht die Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung inklusiven Denkens und Handelns.
Welche Phasen der Index-Anwendung werden beschrieben?
Die Arbeit gliedert die Anwendung des „Index für Inklusion“ in drei Phasen: Phase 1 (Beginn mit dem Index, inklusive Hintergrund, Umsetzung an der Schule, Ergebnisse und Konsequenzen), Phase 2 (Bestandsaufnahme der Schulsituation mittels empirischer Methoden wie Fragebögen und einem Schulentwicklungstag) und Phase 3 (Entwurf eines inklusiven Schulprogramms mit SMARTE-Zielen).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Fallstudien-Methode. In Phase 2 wird eine empirische Bestandsaufnahme der Schulsituation durchgeführt, unter anderem mittels Fragebögen an Eltern und Schüler. Die erhobenen Daten werden erfasst und ausgewertet. Der Schulentwicklungstag wird als weitere Methode zur Datenerhebung eingesetzt.
Welche Ziele wurden verfolgt?
Das Hauptziel der Arbeit ist die Dokumentation und Analyse der Anwendung des „Index für Inklusion“ in den verschiedenen Phasen der Schulentwicklung. Weitere Ziele umfassen die empirische Erfassung der Schulsituation mittels des Index, die Entwicklung eines inklusiven Schulprogramms und die Reflexion des Prozesses.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einsatz des „Index für Inklusion“ als Schulentwicklungsinstrument, die empirische Erfassung der Schulsituation, die Entwicklung eines inklusiven Schulprogramms, die Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung inklusiven Denkens und Handelns sowie die Reflexion des Prozesses und Ausblick auf weitere Schritte.
Was ist der "Index für Inklusion"?
Der „Index für Inklusion“ ist ein Instrument zur Planung und Evaluation von Schulentwicklungsprozessen. Die Arbeit beschreibt seine Struktur, Funktionsweise, verschiedenen Dimensionen und Indikatoren und zeigt auf, wie er für die Planung und Evaluation eingesetzt werden kann.
Welche Rolle spielt die Heinrich-Albertz-Schule?
Die Heinrich-Albertz-Schule in Salzgitter bildet den Kontext der Fallstudie. Die Arbeit beschreibt die Schule, ihre Struktur und ihren Kontext, um das Verständnis der Anwendung des „Index für Inklusion“ zu erleichtern. Die Schule hatte bereits einen frühen Fokus auf Inklusion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Index für Inklusion, Schulentwicklung, Evaluation, inklusive Pädagogik, empirische Forschung, Heinrich-Albertz-Schule, Schulprogramm, SMARTE Ziele, Schulkultur, Partizipation.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Beschreibung der Heinrich-Albertz-Schule, Begriffsbestimmung von Inklusion, Vorstellung des „Index für Inklusion“, detaillierte Beschreibung der Arbeit mit dem Index in drei Phasen, Fazit und Ausblick.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulentwickler, Wissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema Inklusion und Schulentwicklung auseinandersetzen. Sie bietet einen praktischen Einblick in die Anwendung eines konkreten Instruments zur Förderung inklusiven Lernens.
- Citation du texte
- Gerd Meiborg (Auteur), 2013, Der ‚Index für Inklusion‘ als Instrument zur Evaluation und Planung von Schulentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278946