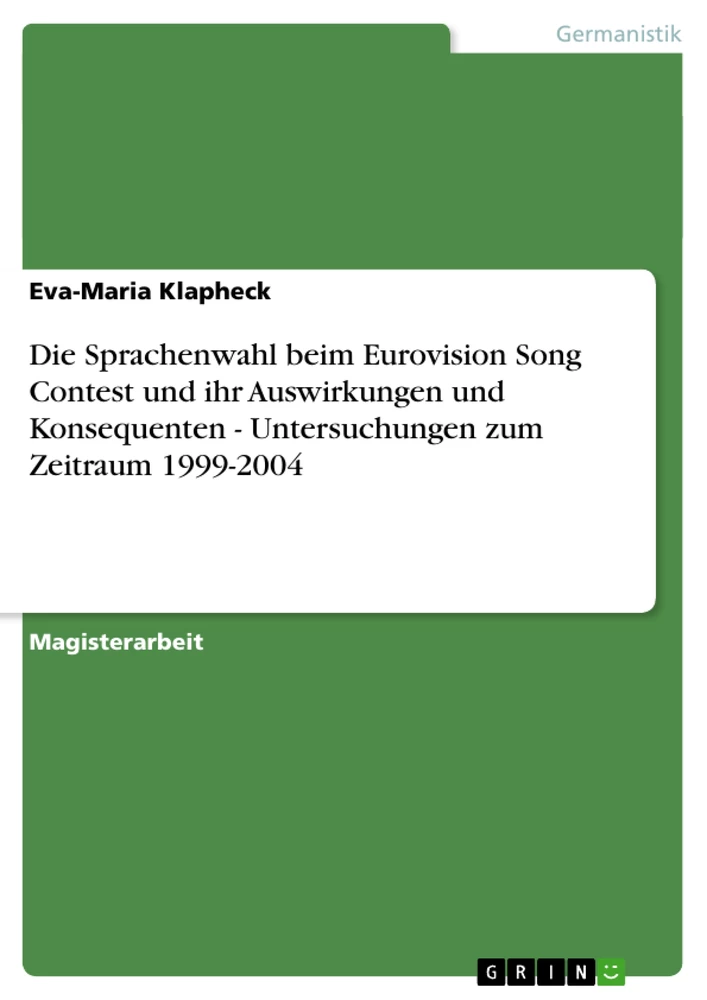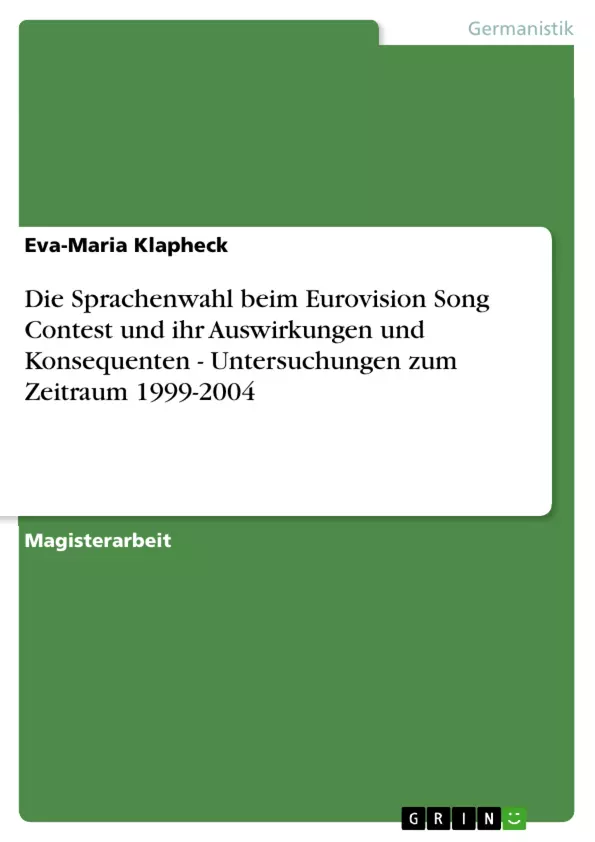„Ein Lied kann eine Brücke sein“, sang Joy Fleming im Jahre 1975 beim Eurovision Song Contest (ESC). Ebenso lautet auch der Titel eines der rar gesäten, deutschsprachigen Publikationen, die sich mit dem internationalen Sangeswettbewerb beschäftigen. Diese Parallele existiert nicht zufällig, denn ein besonders wertvolles Charakteristikum der Musik ist, dass sie eine völkerverbindende und grenzüberschreitende Kunst ist. Die Begegnung der europäischen und auch außer-europäischen Nationen zum Zweck der musikalischen Verständigung kann als Kernaspekt des Eurovision Song Contest verstanden werden. Ein Motiv für die Gründung des ESC im Jahre 1955 war zwar, das damals noch neue Medium Fernsehen der europäischen Bevölkerung näher zu bringen, jedoch war der Hauptgrund die Symbolisierung eines wachsenden Zusammengehörigkeitsgefühls (West-) Europas auf populärkultureller Ebene.
Vielleicht gerade deshalb erfreut sich der traditionsreiche Grand Prix Eurovision, wie er in Deutschland lange genannt wurde, heute mehr denn je einer großen Beliebtheit und Aktualität. Seine Teilnehmer betreffend war und ist der Grand Prix seiner Zeit immer schon ein Stück voraus. Dort fühlen sich - zumindest in musikalischer Hinsicht - Estland, Litauen, Polen, Ungarn und andere aktuelle Beitrittsländer der Europäischen Union vom 1. Mai 2004 schon seit 1994 als Teil der europäischen Gemeinschaft, oder treffen Griechenland, die Türkei und Zypern seit vielen Jahren im musikalischen Wettstreit friedlich aufeinander. Vor dem Hintergrund des europäischen Zusammenwachsens besitzt dieser Wettbewerb eine Symbolhaftigkeit, denn er bringt den jährlich circa 100 Millionen Zuschauern im Kontext des musikalischen Miteinander - und Gegeneinander - die ihnen noch unbekannten Nationen und deren musikalisches Verständnis von populärem Liedgut ein wenig näher. Wie klingt Popmusik auf Finnisch? Wovon singen Lettland, Polen und Malta?
Inhaltsverzeichnis
- A Fragestellung und Forschungsstand
- B Vorarbeiten
- 1.1 Die European Broadcasting Union: Geschichtlicher Überblick und zentrale Tätigkeitsfelder
- 1.2 Rechte und Pflichten der „Aktiven Mitglieder“ der EBU
- 2.1 Der Eurovision Song Contest: Entstehungsgeschichte und Teilnehmer des Wettbewerbes
- 2.2 Das Wertungssystem und der Abstimmungsmodus beim ESC
- 2.3 Die Sprachenregelung beim ESC in der Vergangenheit und heute
- 2.4 Die Modernisierung des ESC und des deutschen ESC-Vorentscheids
- C Möglichkeiten empirische Forschung
- 1 Zentrale Fragestellung und bisherige Sekundärforschung
- Exkurs: Lösungsvorschlag am Beispiel des „Conjoint-Measurments“
- D Analyse der ESC-Jahrgänge 1999-2004
- 1.1 Die nationalen Vorentscheide 1999
- 1.2 Das ESC-Finale 1999: Jerusalem
- 2.1 Die nationalen Vorentscheide 2000
- 2.2 Das ESC-Finale 2000: Stockholm
- 3.1 Die nationalen Vorentscheide 2001
- 3.2 Das ESC-Finale 2001: Kopenhagen
- 4.1 Die nationalen Vorentscheide 2002
- 4.2 Das ESC-Finale 2002: Tallinn
- 5.1 Die nationalen Vorentscheide 2003
- 5.2 Das ESC-Finale 2003: Riga
- 6.1 Die nationalen Vorentscheide 2004
- 6.2 Das ESC-Finale 2004: Istanbul
- E Zusammenfassung der Analyseergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Sprachenwahl beim Eurovision Song Contest (ESC) im Zeitraum von 1999 bis 2004 und deren Auswirkungen. Das Hauptziel besteht darin, die Folgen der Aufhebung der Sprachenregelung durch die European Broadcasting Union (EBU) zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des ESC, die Rolle der Sprache im Wettbewerb und den Einfluss nationaler und internationaler Faktoren auf die Sprachenwahl der Teilnehmer.
- Entwicklung des Eurovision Song Contest und seiner Sprachenregelung
- Einfluss der Sprachenwahl auf den Wettbewerbserfolg
- Nationale und internationale Faktoren bei der Sprachenentscheidung
- Die Rolle der EBU bei der Gestaltung des Wettbewerbs
- Bedeutung des ESC als Ausdruck europäischer Identität
Zusammenfassung der Kapitel
A Fragestellung und Forschungsstand: Dieses Kapitel legt die Forschungsfrage fest und beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zum Thema Sprachenwahl beim ESC. Es wird der Zusammenhang zwischen Musik, europäischer Identität und dem ESC herausgestellt. Die Aufhebung der Sprachenregelung im Jahr 1999 bildet den zentralen Fokus der Untersuchung, der die Fragestellung nach den Auswirkungen dieser Entscheidung auf den Wettbewerb leitet. Die Einleitung bettet die Arbeit in den Kontext des europäischen Zusammenwachsens und der Bedeutung des ESC als populärkulturelles Phänomen ein.
B Vorarbeiten: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die European Broadcasting Union (EBU), ihre Geschichte und Aufgaben. Es werden die Rechte und Pflichten der aktiven EBU-Mitglieder erläutert, um den institutionellen Rahmen des ESC zu verdeutlichen. Daraufhin wird die Entstehungsgeschichte des ESC detailliert beschrieben, das Wertungssystem und die Abstimmungsmodalitäten erklärt sowie die Entwicklung der Sprachenregelung nachgezeichnet und die Modernisierung des Wettbewerbs und des deutschen Vorentscheids diskutiert. Insgesamt liefert dieses Kapitel den notwendigen Hintergrund, um die spätere Analyse der ESC-Jahrgänge zu verstehen.
C Möglichkeiten empirische Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Forschung, die zur Beantwortung der Forschungsfrage angewandt wird. Es präsentiert die zentrale Forschungsfrage und die bereits vorhandene Sekundärforschung zu diesem Thema. Ein Exkurs behandelt die Methode des "Conjoint-Measurements" als ein mögliches Analyseinstrument zur Bewertung der Einflussfaktoren auf die Sprachenwahl.
D Analyse der ESC-Jahrgänge 1999-2004: Dieser Abschnitt analysiert detailliert die nationalen Vorentscheide und die Finalentscheide des ESC von 1999 bis 2004. Für jedes Jahr werden die beteiligten Länder und die gewählten Sprachen untersucht, um die Entwicklung der Sprachenwahl im Kontext der aufgehobenen Sprachenregelung zu verfolgen. Die Ergebnisse dieser Analyse bilden die Grundlage für die abschließende Bewertung im letzten Kapitel.
Schlüsselwörter
Eurovision Song Contest (ESC), European Broadcasting Union (EBU), Sprachenwahl, Sprachenregelung, nationale Identität, europäische Integration, populäre Musik, empirische Forschung, Sprachpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Sprachenwahl beim Eurovision Song Contest (1999-2004)
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Sprachenwahl beim Eurovision Song Contest (ESC) zwischen 1999 und 2004 und die Auswirkungen der Aufhebung der Sprachenregelung durch die European Broadcasting Union (EBU) auf den Wettbewerb. Sie analysiert die Entwicklung des ESC, die Rolle der Sprache im Wettbewerb und den Einfluss nationaler und internationaler Faktoren auf die Sprachenentscheidung der Teilnehmer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Eurovision Song Contest und seiner Sprachenregelung, den Einfluss der Sprachenwahl auf den Wettbewerbserfolg, nationale und internationale Faktoren bei der Sprachenentscheidung, die Rolle der EBU, und die Bedeutung des ESC als Ausdruck europäischer Identität. Die Analyse umfasst detaillierte Untersuchungen der nationalen Vorentscheide und Finalentscheide von 1999 bis 2004.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: A Fragestellung und Forschungsstand, B Vorarbeiten (inkl. Überblick über die EBU und die Geschichte des ESC), C Möglichkeiten empirischer Forschung (inkl. Methodik und einem Exkurs zum Conjoint-Measurement), D Analyse der ESC-Jahrgänge 1999-2004 und E Zusammenfassung der Analyseergebnisse.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Folgen der Aufhebung der Sprachenregelung durch die EBU für den ESC. Die Arbeit untersucht, wie sich diese Entscheidung auf die Sprachenwahl der Teilnehmer auswirkte und welche Faktoren die Sprachenentscheidung beeinflussten.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet empirische Forschungsmethoden. Kapitel C beschreibt die Methodik detailliert und diskutiert die Verwendung von Conjoint-Measurement als mögliches Analyseinstrument.
Welche Daten werden analysiert?
Die Analyse umfasst die detaillierte Untersuchung der nationalen Vorentscheide und Finalentscheide des ESC von 1999 bis 2004. Für jedes Jahr werden die beteiligten Länder und die gewählten Sprachen untersucht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Analyse werden im letzten Kapitel (E Zusammenfassung der Analyseergebnisse) präsentiert. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse über die Entwicklung der Sprachenwahl im Kontext der aufgehobenen Sprachenregelung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eurovision Song Contest (ESC), European Broadcasting Union (EBU), Sprachenwahl, Sprachenregelung, nationale Identität, europäische Integration, populäre Musik, empirische Forschung, Sprachpolitik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für den Eurovision Song Contest, die europäische Medienlandschaft, Sprachpolitik, populäre Kultur und empirische Forschungsmethoden interessieren. Sie ist insbesondere für Wissenschaftler und Studierende im Bereich der Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaften und Soziologie relevant.
- Quote paper
- Eva-Maria Klapheck (Author), 2004, Die Sprachenwahl beim Eurovision Song Contest und ihr Auswirkungen und Konsequenten - Untersuchungen zum Zeitraum 1999-2004, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27895