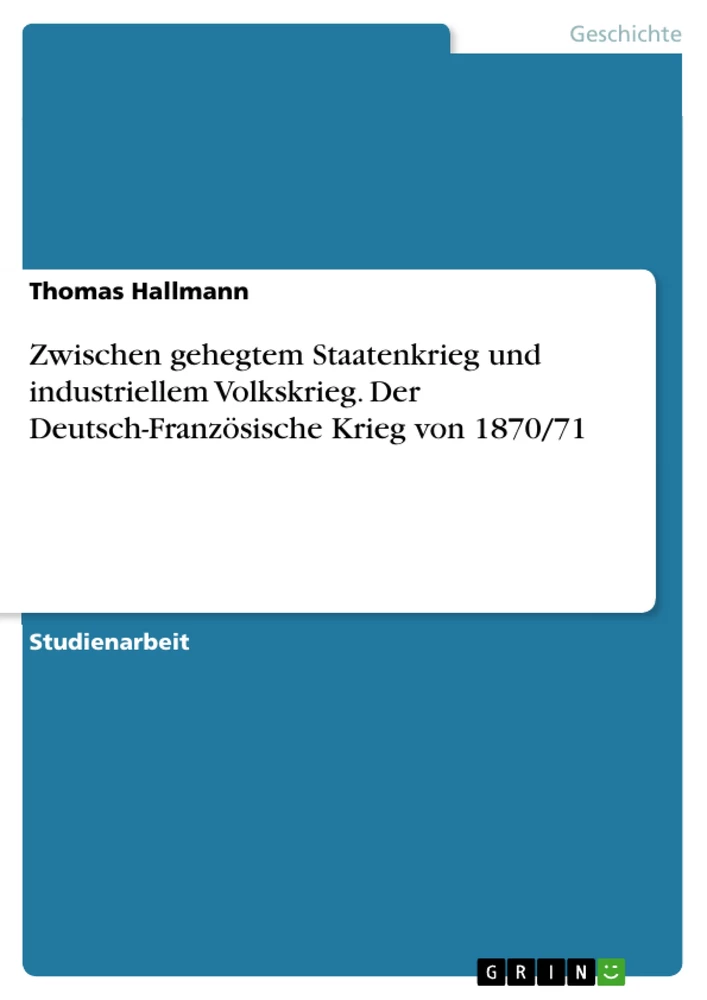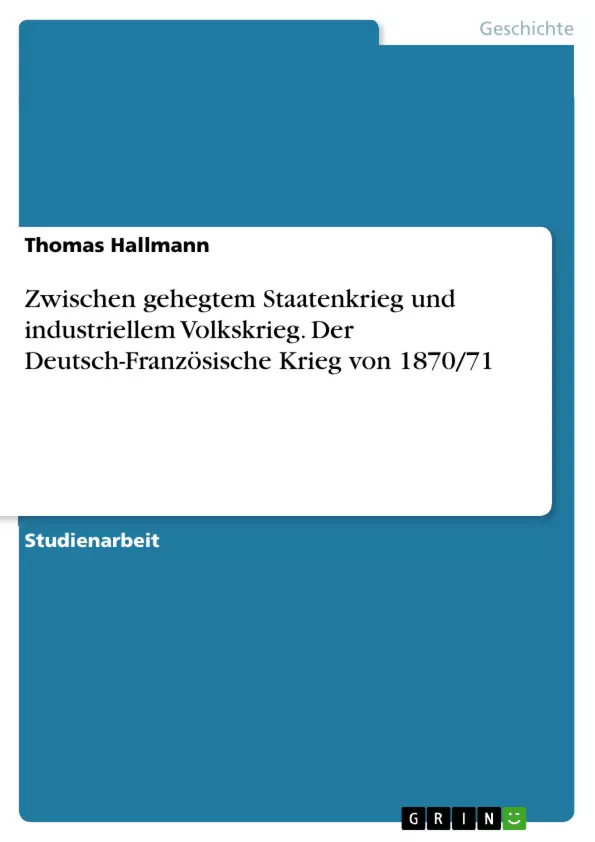Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 stellt ohne Frage eine herausragende Stellung in der Geschichte Deutschlands, aber auch ganz Europas dar und markiert einen für das 19. Jahrhundert grundlegenden Wendepunkt in der militärhistorischen Forschung. Wie so oft in der Geschichte hat sich das Erscheinungsbild des Krieges über die Epochen hinweg aufgrund immer wiederkehrender Einflüsse stetig gewandelt.
In der folgenden Arbeit wird der Versuch unternommen, die sowohl militärische als auch gesellschaftliche Entwicklung während des Deutsch-Französischen Krieges näher zu beleuchten, um so die Bedeutung dieses Krieges und dessen Einordnung in den Kontext eines sich wandelnden Kriegsbildes zu ergründen. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die Frage, welche Form der kriegerischen Auseinandersetzung der Deutsch-Französische Krieg vertritt, welche Parallelen er mit vorweg gegangenen Konflikten gemein hat, welche spezifischen Veränderungen sich ergeben haben und welche Signale er für spätere Konflikte vermittelt hat.
Um diesen Fragestellungen nachgehen zu können, ist es zunächst erforderlich, sich die Zeit und die Entwicklungen vorab des Deutsch-Französischen Krieges und den darin mit inbegriffenen Wandlungsprozess des damaligen Kriegsbildes anzuschauen, um ein Verständnis für die Vorstellungen zur Kriegführung jener Tage oder aber zur Auffassung des Krieges als Ganzes zu erhalten. Wichtig wird es hierbei sein, zu zeigen, welche Wechselwirkungen zwischen Militär und Gesellschaft bzw. Militär und Technik vorherrschten.
Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung des Kriegsverlaufs und der Entwicklung des Kampfes in den Jahren 1870 bis 1871, als auch eine kurze Untersuchung zur zeitgenössischen Wahrnehmung des Konfliktes. Dabei soll auch auf die Frage näher eingegangen werden, ob es sich bei den Kampfhandlungen von 1870/71 um einen gehegten Staatenkrieg oder doch um einen industriellen Volkskrieg bzw. einen Nationalkrieg oder gar um einen Vorläufer des totalen Krieges gehandelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Deutsch-Französische Krieg und seine Zeit: Ein Kriegsbild im Wandlungsprozess
- Militärische Bedürfnisse und gesellschaftliche Notwendigkeiten
- Die Rolle des technologischen Fortschritts
- Strategie und Taktik: Wandel des militärischen Operationsverfahrens
- Der Deutsch-Französische Krieg und dessen Einordnung
- Vom gehegten Staatenkrieg zum Bürgerkrieg
- Der „,imaginierte Volkskrieg“: Wahrheit und Wahrnehmung
- Schlussbetrachtung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und untersucht dessen Bedeutung und Einordnung in den Kontext eines sich wandelnden Kriegsbildes im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie analysiert die militärische und gesellschaftliche Entwicklung während des Krieges und beleuchtet die Frage, welche Form der kriegerischen Auseinandersetzung der Deutsch-Französische Krieg vertritt.
- Die Entwicklung des Kriegsbildes im 19. Jahrhundert
- Die Wechselwirkungen zwischen Militär, Gesellschaft und Technik
- Die Rolle des technologischen Fortschritts im Krieg
- Die Einordnung des Deutsch-Französischen Krieges in den Kontext von Staatenkrieg und Volkskrieg
- Die zeitgenössische Wahrnehmung des Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Deutsch-Französischen Krieges ein und erläutert die Relevanz des Krieges für die Geschichte Deutschlands und Europas. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung des Krieges in den Kontext eines sich wandelnden Kriegsbildes und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Deutsch-Französischen Krieg im Kontext der gesellschaftlichen, politischen und technischen Umbrüche des 19. Jahrhunderts. Es wird die Reorganisation der preußischen Armee als Beispiel für die Revolution der Streitkräfte in Europa betrachtet und die Wechselwirkungen zwischen Militär und Gesellschaft sowie Militär und Technik analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Einordnung des Deutsch-Französischen Krieges in den Kontext von Staatenkrieg und Volkskrieg. Es wird die Frage untersucht, ob es sich bei den Kampfhandlungen von 1870/71 um einen gehegten Staatenkrieg oder doch um einen industriellen Volkskrieg gehandelt hat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, das Kriegsbild im 19. Jahrhundert, die Reorganisation der preußischen Armee, die Wechselwirkungen zwischen Militär und Gesellschaft, die Rolle des technologischen Fortschritts im Krieg, die Einordnung des Krieges in den Kontext von Staatenkrieg und Volkskrieg sowie die zeitgenössische Wahrnehmung des Konflikts.
Häufig gestellte Fragen
War der Deutsch-Französische Krieg ein „gehegter Staatenkrieg“?
Die Arbeit untersucht, ob der Konflikt noch den Regeln klassischer Staatenkriege folgte oder bereits Züge eines industriellen Volkskrieges trug.
Welche Rolle spielte der technologische Fortschritt?
Neue Technologien veränderten das Kriegsbild grundlegend und beeinflussten sowohl die Strategie als auch die Taktik der militärischen Operationen.
Wie veränderte sich die preußische Armee in dieser Zeit?
Die Reorganisation der preußischen Armee gilt als Beispiel für eine Revolution der Streitkräfte, die militärische Bedürfnisse mit gesellschaftlichen Notwendigkeiten verband.
Gilt der Krieg von 1870/71 als Vorläufer des totalen Krieges?
In der Forschung wird diskutiert, ob die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung und die industrielle Dimension bereits Signale für spätere totale Konflikte waren.
Was versteht man unter dem „imaginierten Volkskrieg“?
Es beschreibt die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen militärischen Realität und der zeitgenössischen Wahrnehmung des Kampfes als nationales Ereignis.
- Quote paper
- Thomas Hallmann (Author), 2010, Zwischen gehegtem Staatenkrieg und industriellem Volkskrieg. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279038