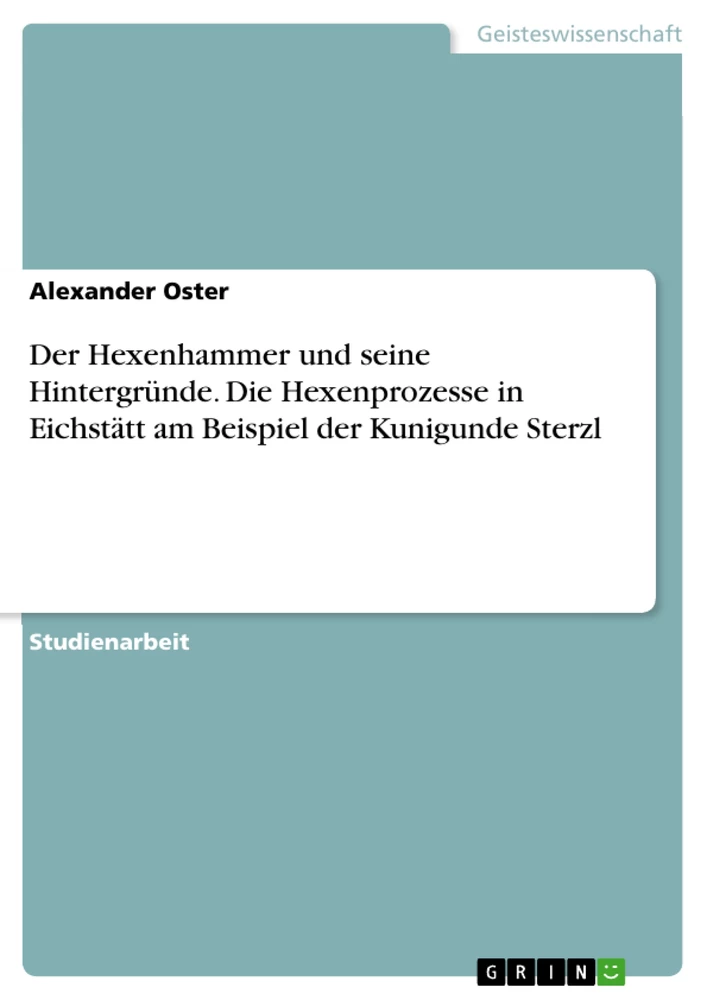Hexen üben seit jeher eine gewisse Faszination auf uns aus. Zur Zeit der Hexenverfolgung war diese Faszination eher durch Angst und Furcht geprägt und resultierte in einer grausamen Hetzjagd.
Ein Werk hat wie kein anderes Buch die Hexenverfolgung vorangetrieben : Der „Malleus maleficarum“, heute bekannt unter dem Titel „Hexenhammer“, welcher 1487 von Heinrich Kramer (Institoris) veröffentlicht wurde. In der vorliegenden Arbeit möchte ich den „Malleus maleficarum“ und seine Hintergründe unter die Lupe nehmen und die Fragen klären: Wer genau hat den Hexenhammer verfasst? Was wissen wir über den Verfasser? Worum geht es inhaltlich? Und welche Auswirkungen hatte dieses Werk? In der Stadt Eichstätt lebt das Thema Hexenverfolgung momentan dank Wolfram Kastner wieder auf. Laut Eichstätter Journal fordert die Initiative um den Münchner Künstler eine namentliche Rehabilitation der in Eichstätt hingerichteten Hexen und ein Denkmal in der Stadtmitte, ggf. nach eigenen Entwürfen. In einem zweiten Abschnitt wird folglich die Hochphase der Eichstätter Hexenverfolgung und hierbei besonders der Fall der Kurnigunde Sterzl beleuchtet und der Ablauf ihres Prozesses skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Hexenhammer und seine Hintergründe im Allgemeinen
- Zur Person des Verfassers
- Verfasser und Autorisierung des „Malleus maleficarum"
- Inhalt
- Auswirkung und Bedeutung
- Der konkrete Fall der Kunigunde Sterzl bei den Eichstätter Hexenprozessen
- Hexenprozesse in Eichstätt
- Der Fall der Kunigunde Sterzl
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem „Malleus maleficarum“, dem sogenannten „Hexenhammer“, und seinen Hintergründen. Sie analysiert die Entstehung des Werkes, die Person des Autors Heinrich Kramer (Institoris) und die Auswirkungen des Buches auf die Hexenverfolgung. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Hexenprozesse in Eichstätt am konkreten Beispiel der Kunigunde Sterzl.
- Die Entstehung und Autorisierung des „Malleus maleficarum“
- Die Person Heinrich Kramers (Institoris) und seine Rolle in der Hexenverfolgung
- Der Inhalt und die Bedeutung des „Malleus maleficarum“
- Die Hexenprozesse in Eichstätt
- Der Fall der Kunigunde Sterzl als Beispiel für die Eichstätter Hexenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Hexenverfolgung ein und stellt die Relevanz des „Malleus maleficarum“ heraus. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um die Rehabilitation von Hexenopfern und die Bedeutung des Werkes für die Geschichte der Hexenverfolgung.
Das zweite Kapitel widmet sich dem „Malleus maleficarum“ und seinen Hintergründen. Es beleuchtet die Person des Autors Heinrich Kramer (Institoris), seine Rolle als Inquisitor und seine Motivationen für die Veröffentlichung des Buches. Das Kapitel analysiert den Inhalt des Werkes und seine Auswirkungen auf die Hexenverfolgung.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Hexenprozesse in Eichstätt und den Fall der Kunigunde Sterzl. Es skizziert die Geschichte der Hexenverfolgung in Eichstätt und beleuchtet den Ablauf des Prozesses gegen Kunigunde Sterzl.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Malleus maleficarum“, Heinrich Kramer (Institoris), Hexenverfolgung, Hexenprozesse, Eichstätt, Kunigunde Sterzl, Mittelalter, Inquisition, Theologie, Geschichte, Rechtsgeschichte, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Hexenhammer“?
Der „Malleus Maleficarum“ oder Hexenhammer ist ein 1487 veröffentlichtes Werk, das als theoretische und rechtliche Grundlage für die systematische Hexenverfolgung in Europa diente.
Wer war Heinrich Kramer?
Heinrich Kramer (auch Institoris genannt) war ein Inquisitor und der Hauptverfasser des Hexenhammers. Er trieb die Verfolgung aus religiösem Eifer und persönlicher Überzeugung voran.
Was geschah bei den Hexenprozessen in Eichstätt?
Eichstätt war ein Zentrum der Hexenverfolgung. Die Prozesse zeichneten sich durch extreme Grausamkeit und eine hohe Zahl an Hinrichtungen aus, oft basierend auf Denunziation und Folter.
Wer war Kunigunde Sterzl?
Kunigunde Sterzl war ein Opfer der Eichstätter Hexenprozesse. Ihr Fall dient in der Arbeit als konkretes Beispiel für den Ablauf und die Willkür der damaligen Gerichtsverfahren.
Gibt es heute Bemühungen zur Rehabilitation der Opfer?
Ja, in Städten wie Eichstätt fordern Initiativen eine namentliche Rehabilitation der hingerichteten Personen und die Errichtung von Denkmalen zur Erinnerung an das Unrecht.
- Arbeit zitieren
- Alexander Oster (Autor:in), 2013, Der Hexenhammer und seine Hintergründe. Die Hexenprozesse in Eichstätt am Beispiel der Kunigunde Sterzl, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279142