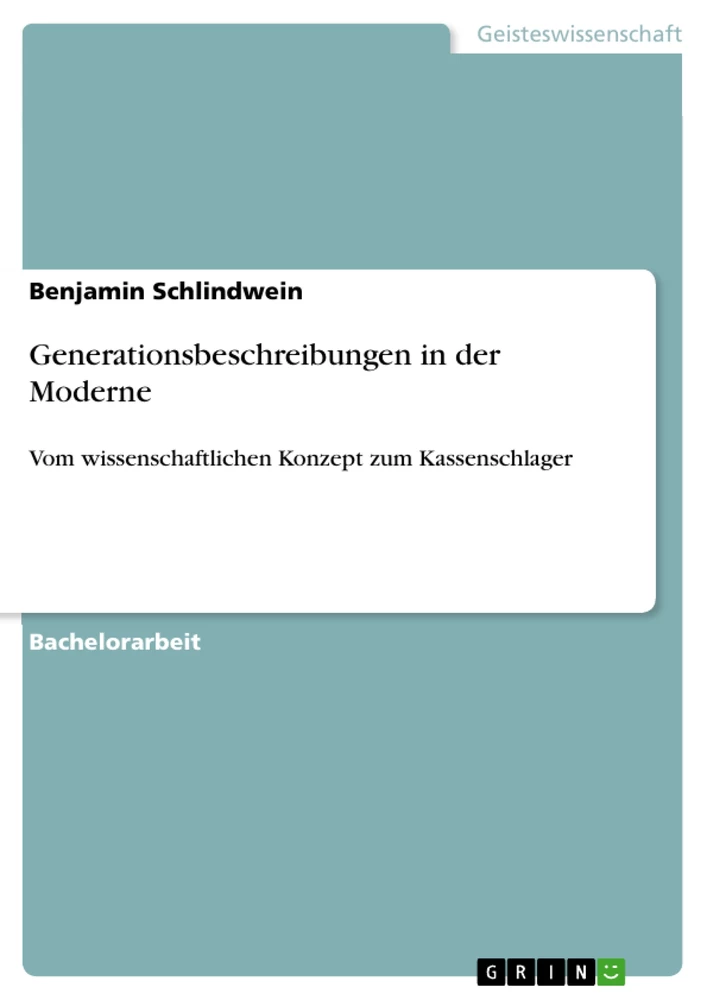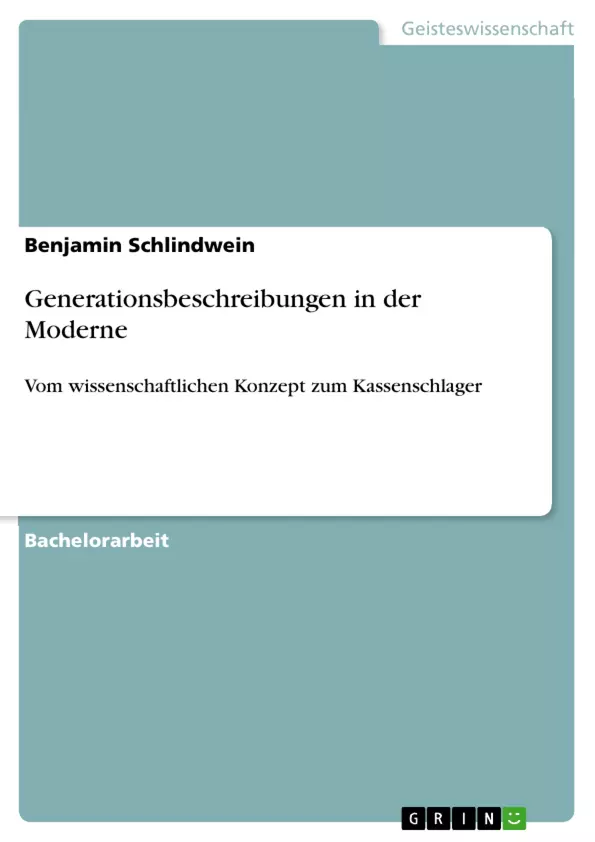In der beschleunigten Zeiterfahrung der Moderne avancieren Generationen zu einem wirkmächtigen Schlagwort der Sinnzuschreibung. Sie erlauben es, dass sich die Individuen in den Prozess des sozialen Wandels verorten und ihre persönliche Biographie mit dem gesellschaftlichen Zeitablauf verbinden können. Vor dem Hintergrund der Vielzahl an Generationsbeschreibungen in den Massenmedien drängt sich die Frage nach dem Sinn und Unsinn solcher Etikettierungen auf. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Bedeutungszuwachs des Generationsbegriffs und stellt dabei die Frage, inwiefern makro-strukturelle Veränderungen auch auf das wissenschaftliche Konzept der Generationenforschung einwirken. Exemplarisch werden hier die „Generation Golf“ sowie die „Mediengeneration“ hinsichtlich ihrer Übereinstimmungen und Differenzen mit Karl Mannheims Paradigma überprüft, um anschließend Implikationen für die Generationenforschung aufzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Generation - ein facettenreicher Begriff
- Klassiker der Generationenforschung
- Karl Mannheim
- Shmuel Eisenstadt
- Norman Ryder
- Kohorte, Altersgruppe, Generation
- Moderne
- Sozialer Wandel
- Technischer Wandel
- Generationen der Moderne
- Generation Golf
- Eine Trendwende in der Generationenforschung
- Die Informationsgesellschaft
- Mediengeneration
- Gibt es die Mediengeneration?
- Synthese
- Implikationen für die Generationenforschung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Bedeutungszuwachs des Generationsbegriffs in der Moderne und untersucht, inwiefern makro-strukturelle Veränderungen auch auf das wissenschaftliche Konzept der Generationenforschung einwirken. Die Arbeit analysiert exemplarisch die „Generation Golf“ und die „Mediengeneration“ hinsichtlich ihrer Übereinstimmungen und Differenzen mit Karl Mannheims Paradigma und stellt anschließend Implikationen für die Generationenforschung auf.
- Bedeutung des Generationsbegriffs in der Moderne
- Einfluss von makro-strukturellen Veränderungen auf die Generationenforschung
- Analyse der „Generation Golf“ und der „Mediengeneration“
- Vergleich mit Karl Mannheims Paradigma
- Implikationen für die Generationenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Generationsbeschreibungen in der Moderne ein und beleuchtet die inflationäre Verwendung des Generationsbegriffs in den Medien. Sie stellt die Frage nach dem Sinn und Unsinn solcher Etikettierungen und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem facettenreichen Begriff der Generation und beleuchtet die zentralen Theoretiker der Generationenforschung, darunter Karl Mannheim, Shmuel Eisenstadt und Norman Ryder. Es werden die begrifflichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kohorte, Altersgruppe und Generation diskutiert.
Das dritte Kapitel analysiert die zentralen Folgen des sozialen Wandels des 20. Jahrhunderts, insbesondere den Einfluss von Sozialem und Technischem Wandel auf die Entstehung von Generationen. Es werden die wichtigsten Merkmale der modernen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Generationenforschung beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich den Generationen der Moderne, mit einem Schwerpunkt auf der „Generation Golf“. Es werden die spezifischen Merkmale dieser Generation und ihre Abgrenzung von früheren Generationen untersucht. Zudem wird die Frage nach einer möglichen Trendwende in der Generationenforschung diskutiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Informationsgesellschaft und der „Mediengeneration“. Es werden die charakteristischen Merkmale dieser Generation und ihre Beziehung zu den neuen Medien analysiert. Die Frage, ob es sich bei der „Mediengeneration“ tatsächlich um eine eigenständige Generation im wissenschaftlichen Sinne handelt, wird kritisch beleuchtet.
Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse dar. Es werden die Implikationen für die Generationenforschung und die zukünftige Forschung in diesem Bereich aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Generationenbeschreibungen in der Moderne, den Generationsbegriff, die Generationenforschung, Karl Mannheim, die „Generation Golf“, die „Mediengeneration“, die Informationsgesellschaft, sozialer Wandel, technischer Wandel und die Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Begriff „Generation“ in der Moderne so präsent?
In einer beschleunigten Welt helfen Generationsbegriffe Individuen dabei, ihre eigene Biografie in den sozialen Wandel einzuordnen und Sinn zu stiften.
Wer sind die Klassiker der Generationenforschung?
Zu den bedeutendsten Theoretikern gehören Karl Mannheim, Shmuel Eisenstadt und Norman Ryder.
Was charakterisiert die „Generation Golf“?
Sie steht exemplarisch für eine moderne Generationsbeschreibung, die stark durch Konsum und spezifische kulturelle Merkmale geprägt ist.
Gibt es wissenschaftlich gesehen eine „Mediengeneration“?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die durch die Informationsgesellschaft geprägte Gruppe tatsächlich die Kriterien einer eigenständigen Generation nach Mannheims Paradigma erfüllt.
Wie beeinflusst technischer Wandel die Generationenbildung?
Schneller technischer Fortschritt schafft neue Erfahrungsräume, die zur Abgrenzung von Altersgruppen und zur Entstehung neuer Generationsidentitäten führen.
- Citar trabajo
- Benjamin Schlindwein (Autor), 2014, Generationsbeschreibungen in der Moderne, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279182