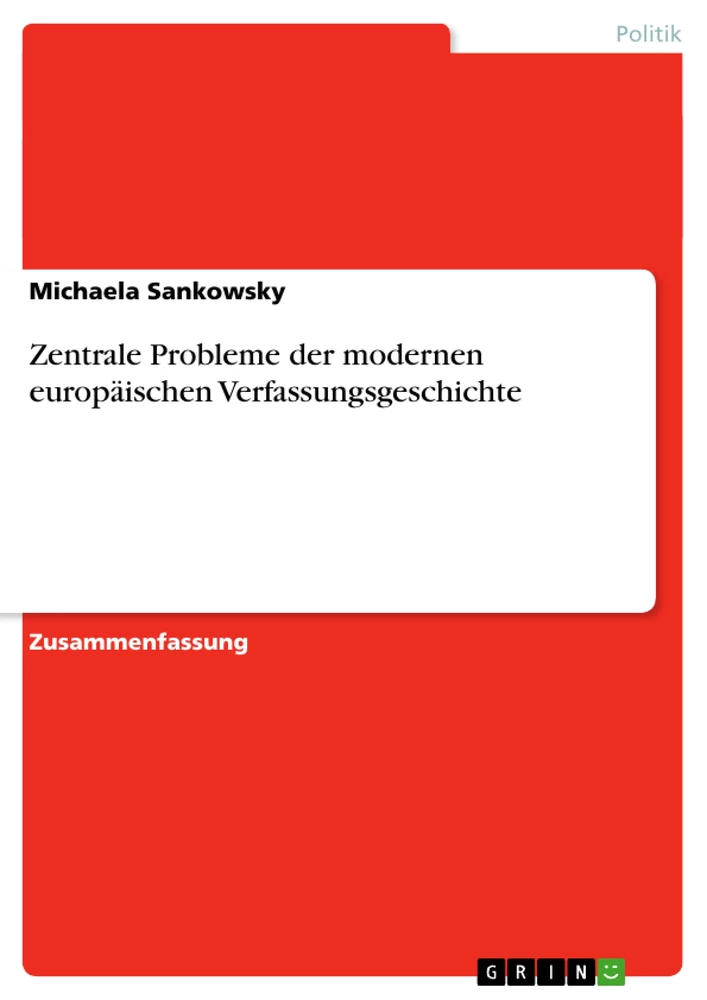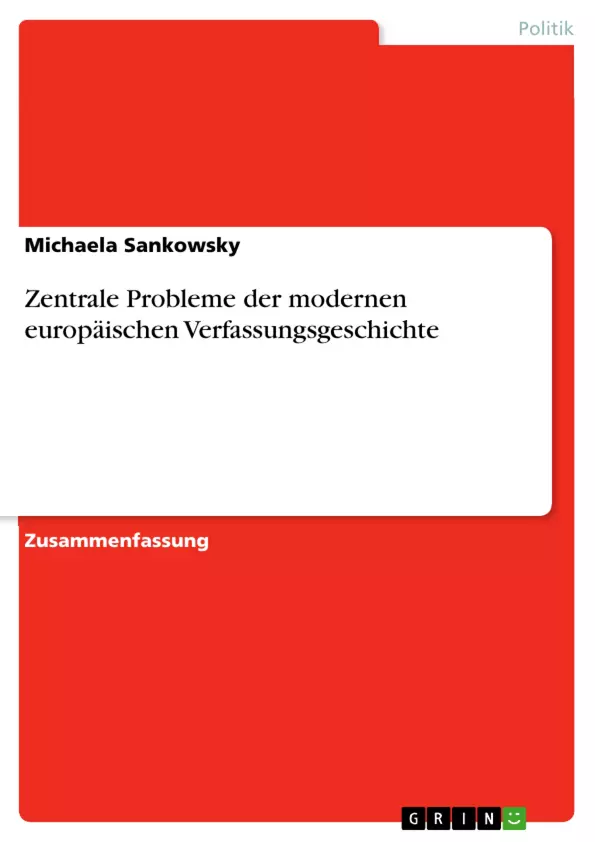Das Modul vermittelt Kenntnisse zur Grundlegung moderner europäischer Staatlichkeit und Politik seit dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Dabei geht es auch um die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Kräften und den jeweiligen Formen politischer Steuerung. Durch Typenbildung und Vergleich sowie durch historisch-exemplarische Einzelfallstudien soll das Verständnis der Studierenden für die historische Wandelbarkeit dieser Formen politischer Steuerung und gesellschaftlicher Koordination in Europa gefördert werden sowie ihre Fähigkeit zur Analyse solcher Prozesse.
Ausführliche Zusammenfassung ohne Literaturangaben.
Inhaltsverzeichnis
- Kurseinheit 1: Souveränität - Legitimität - Verfassungswandel
- 1. Vom "Aufgeklärten Absolutismus" zur Konstitutionellen Monarchie?
- 2. Der Legitimationsbruch zw. Abs. u. konst. Monarchie: Frankreich 1789 u. d. Entwicklung in Europa im 19. Jhd.
- 3. Die allmähliche Parlamentarisierung der Staaten Europas - vom Beispiel Polens 1791 bis zu den Problemen d. Zwischenkriegszeit des 20. Jhds.
- 4. Konstitutionalismus zw. "monarchischem Prinzip" u. Parlamentarismus. Die "Zabern-Affäre" vom Herbst 1913 u. d. Problem d. Reformierbarkeit d. Verfassung d. Deutschen Kaiserreichs
- 5. Parlamentarismus - Rätesystem - revolutionäre Parteidiktatur. Russland u. Deutschland am Ende des 1. Weltkriegs
- 6. Zwischen Parlamentarismus u. Volksdemokratie. Die Entstehung der "Verfassung von Berlin"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Kurseinheit "Souveränität - Legitimität - Verfassungswandel" befasst sich mit der Entwicklung des europäischen Verfassungsstaates vom Absolutismus zur Konstitutionellen Monarchie und weiter zum parlamentarischen System. Sie analysiert die Herausforderungen und Probleme, die mit diesen Transformationsprozessen verbunden waren, und beleuchtet die Rolle von Schlüsselereignissen wie der Französischen Revolution und der Zabern-Affäre.
- Die Entwicklung des europäischen Verfassungsstaates vom Absolutismus zur Konstitutionellen Monarchie und zum parlamentarischen System
- Die Rolle von Schlüsselereignissen wie der Französischen Revolution und der Zabern-Affäre
- Die Herausforderungen und Probleme, die mit diesen Transformationsprozessen verbunden waren
- Die Bedeutung von Legitimität und Souveränität im Wandel der europäischen Verfassungsgeschichte
- Die verschiedenen Modelle des Verfassungswandels und ihre Auswirkungen auf die politische Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die erste Kurseinheit beginnt mit der Frage, ob der "Aufgeklärte Absolutismus" eine Transformationsfähigkeit in Richtung Konstitutionelle Monarchie besaß. Sie analysiert die Entwicklung in Österreich, wo Leopold II. 1787 einen Verfassungsentwurf plante, der jedoch nie umgesetzt wurde. Joseph II. hingegen strebte 1781 eine zentrale Staatsadministration an, die als Keimzelle der konstitutionellen Entwicklung angesehen werden kann.
Das zweite Kapitel behandelt den Legitimationsbruch zwischen Absolutismus und Konstitutioneller Monarchie im Kontext der Französischen Revolution. Die Einberufung der Generalstände im Jahr 1788 und die anschließenden sozialen Unruhen führten zur Erklärung der "Assemblee nationale" am 17. Juni 1789. Dieser Tag markierte den Bruch mit den alten Regierungsprinzipien und die Etablierung der absoluten Souveränität der Nation.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der allmählichen Parlamentarisierung der europäischen Staaten. Es wird die polnische Maiverfassung von 1791 als erste geschriebene Verfassung Europas vorgestellt, die jedoch aufgrund russischer Intervention kaum zur Anwendung kam. England entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum ersten europäischen Land mit einem dauerhaften parlamentarischen System. Norwegen hingegen erlebte eine Parlamentarisierung aus einem verfassungsrechtlichen Verfahren heraus.
Das vierte Kapitel analysiert den Konstitutionalismus zwischen "monarchischem Prinzip" und Parlamentarismus anhand der "Zabern-Affäre" von 1913. Die Affäre verdeutlichte die Reformunfähigkeit des Deutschen Kaiserreichs und die fortdauernde extra-konst. Stellung des Militärs. Der Reichstag und der Reichskanzler konnten die Armee zwar in gewissem Maße begrenzen, doch das System blieb bestehen.
Das fünfte Kapitel behandelt die Entwicklung in Russland und Deutschland am Ende des Ersten Weltkriegs. Die "Februarrevolution" von 1917 in Russland führte zum Sturz der Zarenmonarchie und zum Beginn eines revolutionären Prozesses. Die Radikalisierung in Russland kulminierte in der bolschewistischen "Oktoberrevolution" und dem anschließenden Bürgerkrieg. In Deutschland kam es im Oktober 1918 zur vollen Parlamentarisierung der Monarchie, jedoch zu spät, um die Revolution zu stoppen. Deutschland wurde vorübergehend eine Räterepublik, bevor die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung 1919 die Weimarer Republik ausrief.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Entstehung der "Verfassung von Berlin" in der Nachkriegszeit. Die drei Verfassungsentwürfe der Berliner Fraktionen CDU, SPD und SED basierten auf dem parlamentarischen System und enthielten weitreichende Grundrechte. Die Verfassungspolitischen Hauptproblemfelder waren die staatsrechtliche Stellung Berlins, die Beziehung zu den Besatzungsmächten, die Organisation der Verfassungsgewalten und die Einbeziehung grundrechtlicher, wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Grundsätze. Letztlich war es nicht der Inhalt der Verfassungsentwürfe, sondern die Interessen der Besatzungsmächte und Parteien, die zum Scheitern eines großen Verfassungskompromisses führten. Die sozialdemokratische Verfassung von 1948 wurde schließlich zur Grundlage der "Verfassung von Berlin", die am 1. Oktober 1950 in Kraft trat.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Absolutismus, die Konstitutionelle Monarchie, den Parlamentarismus, die Französische Revolution, die Zabern-Affäre, die Weimarer Republik, die Räterepublik, die "Verfassung von Berlin" und die Entwicklung des europäischen Verfassungsstaates. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, die mit den Transformationsprozessen von der absolutistischen zur konstitutionellen und parlamentarischen Ordnung verbunden waren, sowie die Rolle von Legitimität und Souveränität im Wandel der europäischen Verfassungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der europäische Verfassungsstaat?
Die Entwicklung verlief vom Absolutismus über die Konstitutionelle Monarchie bis hin zu modernen parlamentarischen Systemen, geprägt durch Brüche wie die Französische Revolution.
Was war die Bedeutung der Französischen Revolution von 1789?
Sie markierte den radikalen Bruch mit dem absolutistischen Legitimationsprinzip und etablierte die Souveränität der Nation als Grundlage der Verfassung.
Was zeigt die „Zabern-Affäre“ von 1913?
Die Affäre verdeutlichte die mangelnde Reformfähigkeit des Deutschen Kaiserreichs und die übermächtige Stellung des Militärs gegenüber dem Parlament.
Welches Land gilt als Vorreiter des Parlamentarismus?
England entwickelte im 19. Jahrhundert als erstes europäisches Land ein dauerhaft funktionierendes parlamentarisches System.
Was ist das „monarchische Prinzip“?
Es besagt, dass die gesamte Staatsgewalt im Monarchen vereint bleibt und dieser das Parlament nur an der Ausübung bestimmter Rechte beteiligt, statt ihm untergeordnet zu sein.
Wie entstand die „Verfassung von Berlin“?
Sie entstand in der Nachkriegszeit aus Entwürfen der Berliner Parteien und trat 1950 in Kraft, nachdem ein gesamtberliner Kompromiss an den Interessen der Besatzungsmächte scheiterte.
- Quote paper
- Michaela Sankowsky (Author), 2011, Zentrale Probleme der modernen europäischen Verfassungsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279187