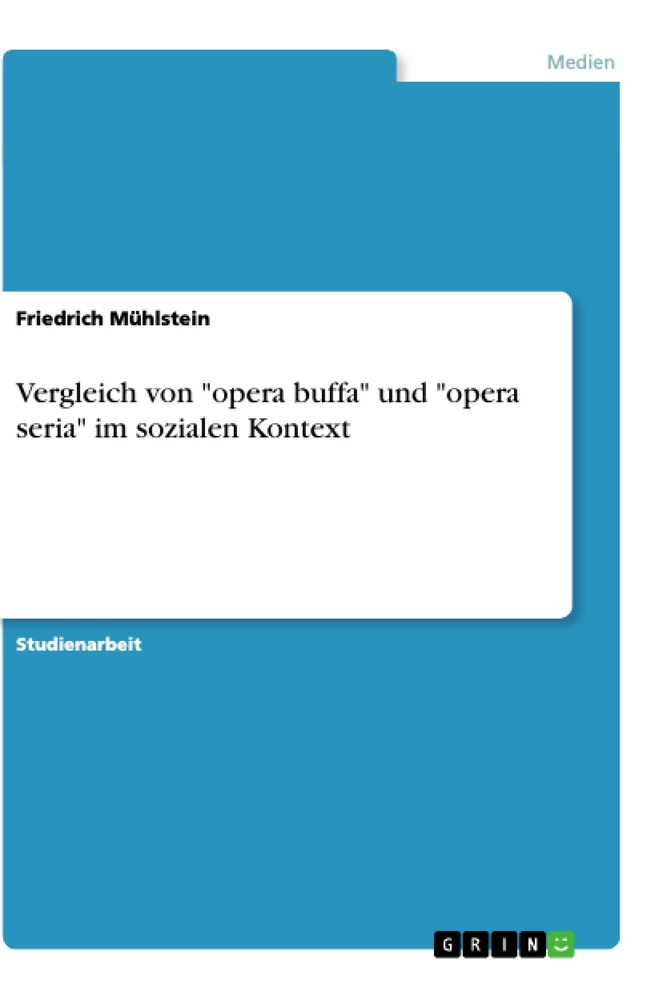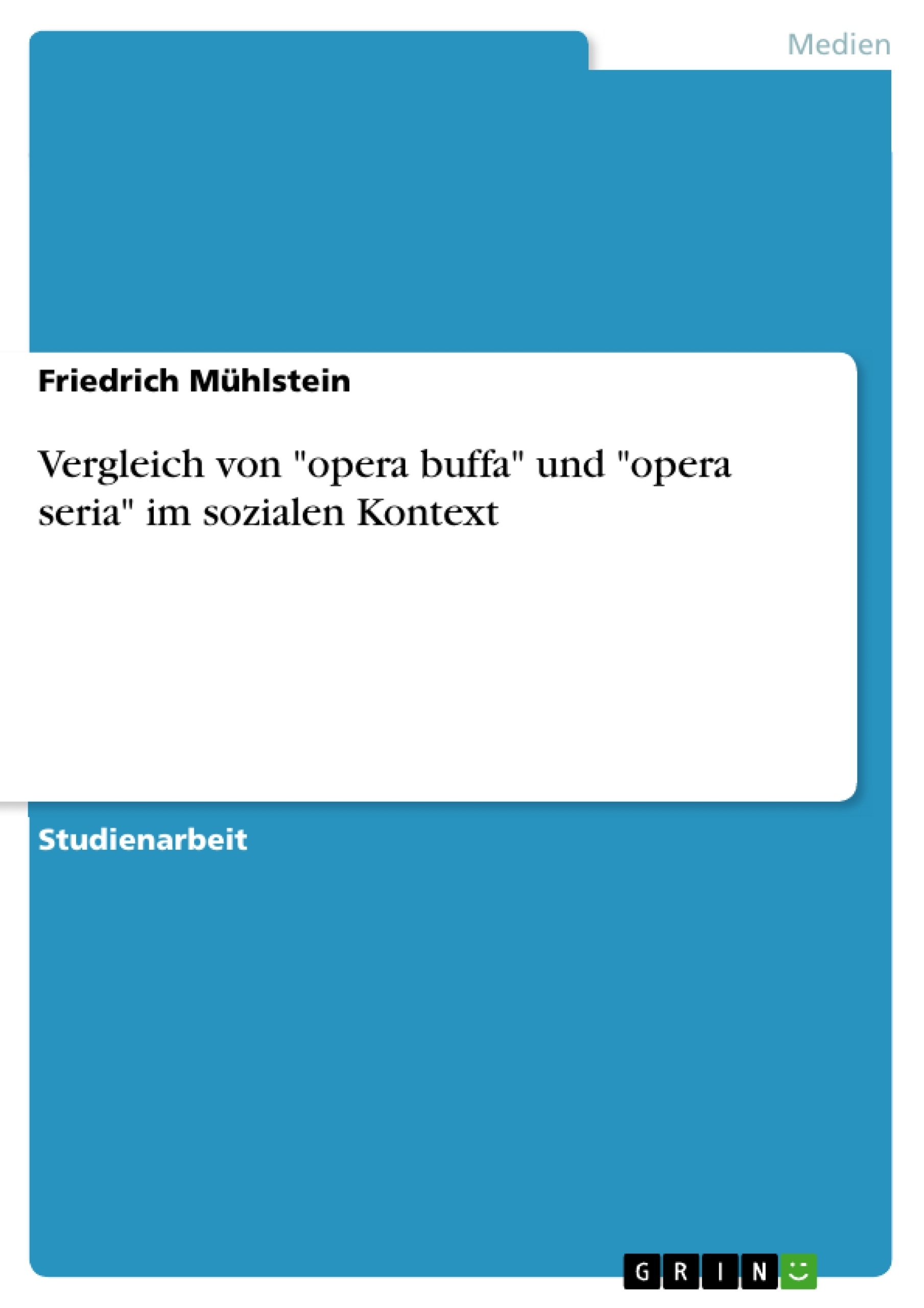Im Rahmen des Moduls „Musik im kulturgeschichtlichen Kontext“ sollen in der vorliegenden Hausarbeit zwei italienische Operntypen verglichen werden. Auf der einen Seite die opera seria und auf der anderen die opera buffa, dabei soll bei diesem Vergleich insbesondere auf den sozialen Kontext der jeweiligen Oper eingegangen werden, also inwieweit sich die Besucher der jeweiligen Opern und die Aufführungsort unterschieden haben. Um diesen Vergleich bearbeiten zu können, sollen zuerst beide Opernarten einzeln betrachtet werden und in dem Zusammenhang auch ein Beispiel vorgestellt werden. Hier soll für die opera buffa, das frühe Werk von Wolfgang Amadeus Mozart, „La finta semplice“, und für die opera seria die letzte Oper von Mozart, „La clemenza di Tito“ vorgestellt werden. Bei der Recherche wurde insbesondere mit dem Sammelband „Operngeschichte in einem Band“ und der Monografie „Eine Geschichte der Oper. Die letzten 400 Jahre“ von Carolyn Abbate und Roger Parker gearbeitet. Zur Bearbeitung der Oper „La finta semlice“ stand ein Band aus den „Kritischen Berichten“ über die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zur Verfügung, dieser ist auch online verfügbar. Der Bericht wirft viele verschiedene neue Fragen auf, insbesondere zu den Konflikten und Intrigen, welche die Ausführung der Oper in Wien verhinderten, hier könnte in Zukunft noch genauer versucht werden zu forschen. Auch für die Ausarbeitung zu „La clemenza di Tito“ wurde ein Band aus den „Kritischen Berichten“ zu den Werken von Mozart herangezogen. Alle italienischen Übersetzungen in der vorliegenden Arbeit wurden von dem Schreiber eigenständig vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Opera seria
- 2.1 Charakterisierung
- 2.2 Beispiel: „La clemenza di Tito“
- 3 Opera buffa
- 3.1 Charakterisierung
- 3.2 Beispiel: „La finta semplice“
- 4 Diskussion der zwei Opern Typen im sozialen Kontext
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit vergleicht die italienischen Operntypen „Opera seria“ und „Opera buffa“ im Hinblick auf ihren sozialen Kontext. Ziel ist es, die Unterschiede in Bezug auf Publikum, Aufführungsort und gesellschaftliche Relevanz zu untersuchen. Die Analyse basiert auf einer Betrachtung der charakteristischen Merkmale beider Opernformen und wird anhand der Beispiele „La clemenza di Tito“ und „La finta semplice“ von Wolfgang Amadeus Mozart illustriert.
- Charakterisierung der Opera seria und Opera buffa
- Vergleich der musikalischen Merkmale beider Opernformen
- Untersuchung des sozialen Kontextes der Opernaufführungen
- Analyse der Beispiele „La clemenza di Tito“ und „La finta semplice“
- Differenzierung der Aufführungsorte und des Publikums
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit: einen Vergleich der Opernformen „Opera seria“ und „Opera buffa“ unter Berücksichtigung ihres sozialen Kontextes. Es wird die Methodik erläutert, die auf der Einzelbetrachtung beider Opernformen und der Präsentation von Beispielen („La clemenza di Tito“ und „La finta semplice“) basiert. Die verwendeten Quellen, darunter der Sammelband „Operngeschichte in einem Band“ und die Monografie „Eine Geschichte der Oper“, werden genannt. Die Eigenständigkeit der italienischen Übersetzungen wird betont.
2 Opera seria: Dieses Kapitel charakterisiert die „Opera seria“ als eine um 1700 entstandene Reform der italienischen Oper, die sich durch Vereinfachung und Fokussierung auf ernste Themen auszeichnet. Im Gegensatz zur vorherigen Vielfalt wurden die Anzahl der Akteure und Nebenhandlungen begrenzt, komische Elemente verbannt. Inhaltlich orientierte sich die „Opera seria“ an der antiken Mythologie und Geschichte. Musikalische Merkmale sind die dreiteilige Ouvertüre, der Wechsel zwischen Rezitativ und Arie, wobei das Rezitativ handlungsorientiert und die Arie affektiert ist. Es wird zwischen „recitativo secco“ und „recitativo accompagnato“ unterschieden.
3 Opera buffa: Dieses Kapitel beschreibt die „Opera buffa“ (hier fehlt im Ausgangstext eine zusammenfassende Beschreibung). Es wird in diesem Kapitel die Charakterisierung der Opera buffa und das Beispiel „La finta semplice“ besprochen.
Schlüsselwörter
Opera seria, Opera buffa, Wolfgang Amadeus Mozart, La clemenza di Tito, La finta semplice, sozialer Kontext, italienische Oper, Musikgeschichte, Klassik, Romantik, Opernreform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Vergleich von Opera seria und Opera buffa
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die italienischen Opernformen „Opera seria“ und „Opera buffa“ hinsichtlich ihres sozialen Kontextes. Im Fokus stehen die Unterschiede in Bezug auf Publikum, Aufführungsort und gesellschaftliche Relevanz.
Welche Opern werden als Beispiele verwendet?
Die Analyse wird anhand der Opern „La clemenza di Tito“ und „La finta semplice“ von Wolfgang Amadeus Mozart illustriert.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Charakterisierung von Opera seria und Opera buffa, einen Vergleich ihrer musikalischen Merkmale, die Untersuchung des sozialen Kontextes der Opernaufführungen, die Analyse der Beispielopern und die Differenzierung der Aufführungsorte und des Publikums.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Opera seria, einem Kapitel zur Opera buffa, einem Kapitel zur Diskussion der beiden Opernformen im sozialen Kontext und einem Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Wie wird die Opera seria charakterisiert?
Die Opera seria wird als eine um 1700 entstandene Reform der italienischen Oper charakterisiert, die sich durch Vereinfachung und Fokussierung auf ernste Themen auszeichnet. Sie zeichnet sich durch begrenzte Anzahl der Akteure und Nebenhandlungen, Verzicht auf komische Elemente, die Orientierung an antiker Mythologie und Geschichte sowie musikalische Merkmale wie dreiteilige Ouvertüre, Wechsel zwischen Rezitativ und Arie (recitativo secco und recitativo accompagnato) aus.
Wie wird die Opera buffa charakterisiert?
Die Hausarbeit enthält eine Charakterisierung der Opera buffa, jedoch fehlt im Ausgangstext eine zusammenfassende Beschreibung dieses Kapitels. Das Kapitel behandelt die Charakterisierung der Opera buffa und das Beispiel „La finta semplice“.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich auf den Sammelband „Operngeschichte in einem Band“ und die Monografie „Eine Geschichte der Oper“. Die Eigenständigkeit der italienischen Übersetzungen wird betont.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Opera seria, Opera buffa, Wolfgang Amadeus Mozart, La clemenza di Tito, La finta semplice, sozialer Kontext, italienische Oper, Musikgeschichte, Klassik, Romantik, Opernreform.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist der Vergleich der Opernformen „Opera seria“ und „Opera buffa“ unter Berücksichtigung ihres sozialen Kontextes, um die Unterschiede in Bezug auf Publikum, Aufführungsort und gesellschaftliche Relevanz zu untersuchen.
- Quote paper
- Friedrich Mühlstein (Author), 2013, Vergleich von "opera buffa" und "opera seria" im sozialen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279225