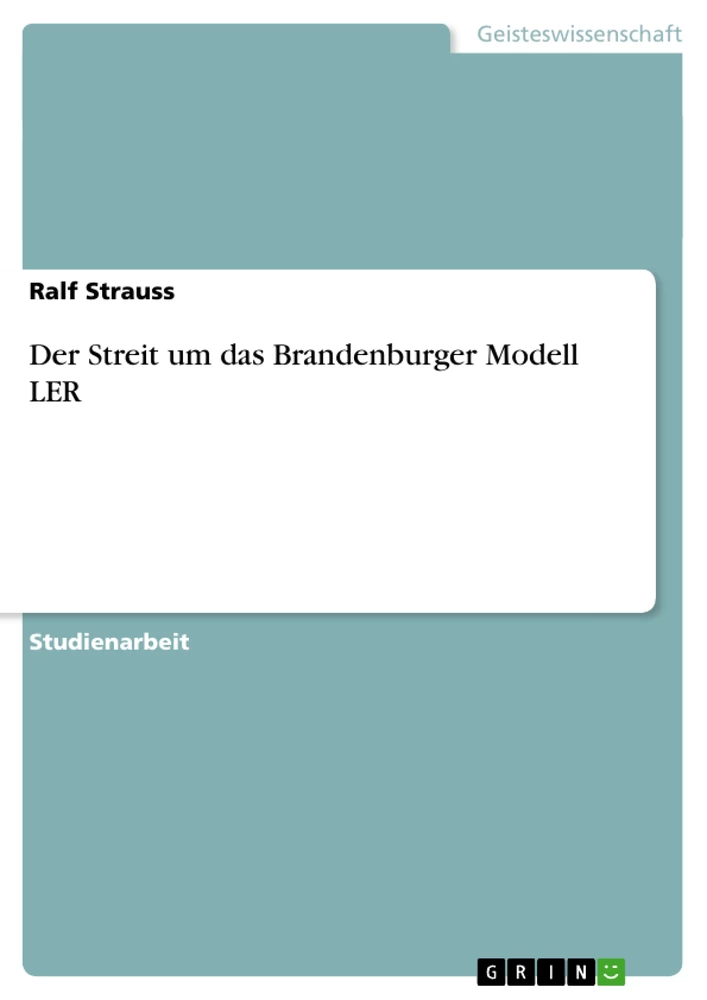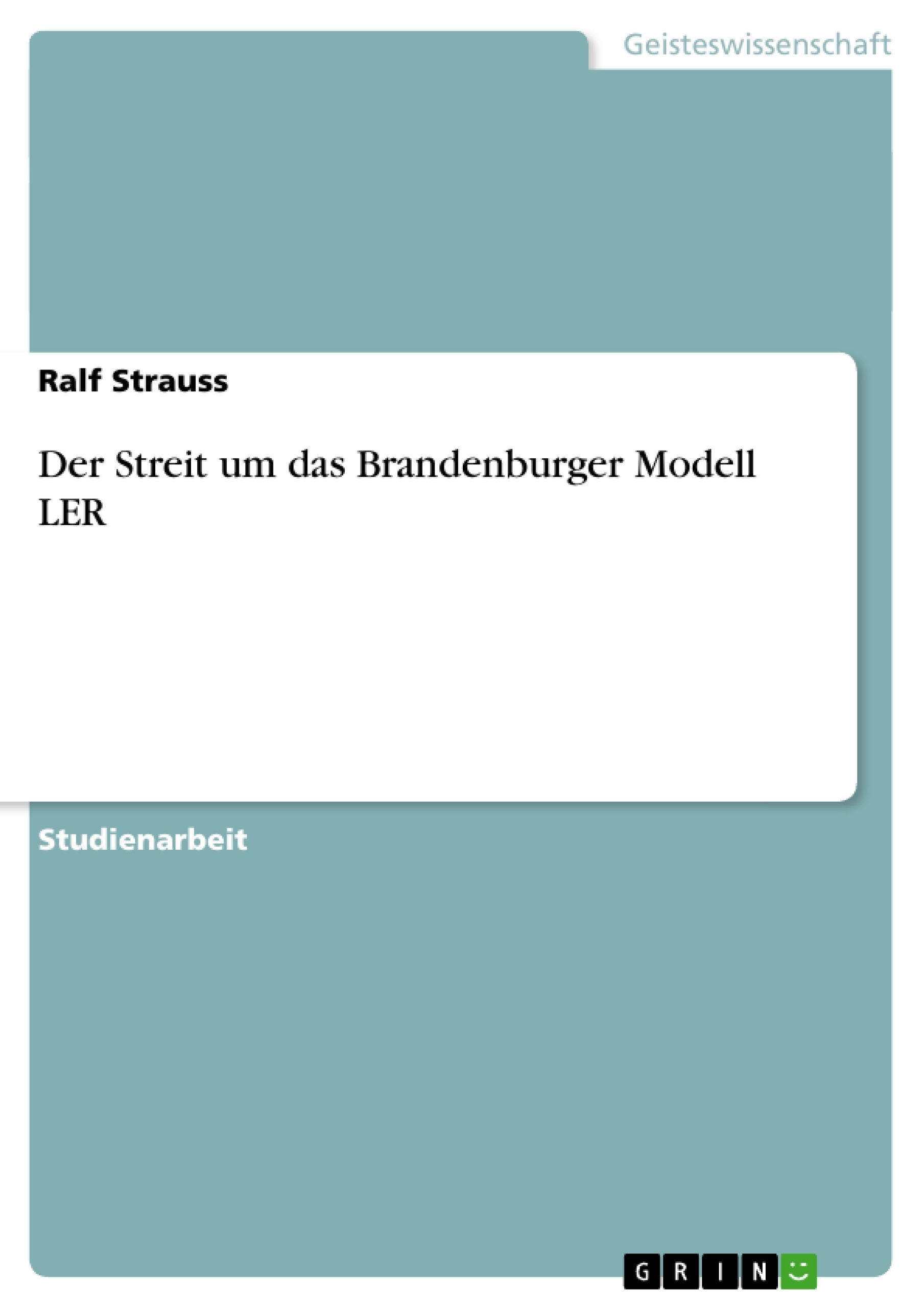Einleitung
Der Religionsunterricht (RU) ist das einzige Schulfach, das im Grundgesetz ausdrücklich genannt wird. Allein daran läßt sich erkennen, daß seine Stellung eine besondere ist, die ihn von allen andern Fächern unterscheidet. Diese Regelung ist eine Besonderheit gegenüber anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich, das in seiner Verfassung die Laizität der Schule1 verankert hat. In Berlin- Brandenburg wiederum ist das, was aus westdeutscher Sicht eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich daß die Schüler2 am Religionsunterricht teilnehmen oder sich befreien lassen, ein Wunschtraum, der möglicherweise wie eine Seifenblase zu platzen droht oder – die Hoffnung der Kirchen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu diesem Thema außen vor gelassen – längst geplatzt ist.
Selbst die Evangelische und die Katholische Kirche in Berlin-Brandenburg planen längst Modelle3, die anders aussehen, als die grundgesetzliche Vorgabe eines RU als ordentliches Lehrfach, obschon es diese Kirchen selbst sind, die in Karlsruhe eine Entscheidung im Sinne des Grundgesetzes herbeiführen wollen. Diese juristische Urteilsbildung wurde angestrengt nicht aus freiem Entschluß, sondern aus der Ablehnung eines alternativen Modells heraus, welches das Land Brandenburg nach der Wende entwickelt und peu à peu auf den Stundenplan gesetzt hat. Das Kürzel LER steht längst für mehr als für Lebenskunde-Ethik-Religion. Das mag zum einem daran liegen, daß die Bedeutung der einzelnen Buchstaben des Sigles einer schleichenden Erosion unterlagen, zum anderen an der gewaltigen Diskussion, die mit ideologischen, theologischen, politischen und pädagogischen Einwürfen geführt wurde und immer noch geführt wird. Während für manche die Einführung von LER scheinbar den Untergang des christlichen Abendlandes einläutet, bedeutet es für andere die Anerkennung der Verhältnisse in den sogenannten neuen Bundesländern.
Erfahrungen aus einem Assistentenjahr in Frankreich und aus Praktika in Schulen im Berliner Ostteil scheinen mir zu verdeutlichen, daß das konventionelle, „heile“ Modell des RU, wie während meiner Schulzeit in Baden-Württemberg erlebt, für die Kirche eine angenehme Lösung ist, da es ihre gesellschaftliche Bedeutung auch in der staatlichen Institution Schule unterstreicht. Dort jedoch, wo volkskirchliche Strukturen nicht oder nicht mehr zu finden sind, droht es an der Realität vorbeizugehen, da die Lebenswirklichkeit der Menschen und damit auch der Kirchen eine andere ist...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der Entstehung von LER
- Die einzelnen Phasen von LER
- Die Vorbereitungsphase
- Der Modellversuch
- Die Abschlußberichte
- Erörterung
- Was will LER?
- Jetzige Situation
- Zur Verfassungsmäßigkeit von LER
- Abwägung
- Schluß
- Anhang
- Chronologie von LER
- Entstehung und Entwicklung des alternativen Lehrfachs LER
- Vergleich von LER und Religionsunterricht
- Ziele und Intentionen von LER
- Verfassungsmäßigkeit von LER
- Aktuelle Situation und Perspektiven von LER
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und den Chancen und Risiken des alternativen Lehrfachs Lebensgestaltung-Ethik-Religion (LER) im Vergleich zum Religionsunterricht (RU) in Brandenburg. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Entstehung von LER, die verschiedenen Phasen seiner Entwicklung und die damit verbundenen Debatten. Sie setzt sich kritisch mit den Zielen und der Verfassungsmäßigkeit von LER auseinander und untersucht die aktuelle Situation des Faches.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Religionsunterricht (RU) als ein im Grundgesetz verankertes Schulfach vor und kontrastiert die Situation in Deutschland mit der in Frankreich, wo die Laizität der Schule verfassungsrechtlich verankert ist. Die Arbeit stellt die Besonderheiten des Brandenburger Modells LER vor, das ein alternatives Lehrfach zum traditionellen RU bietet.
Der Abschnitt "Geschichte der Entstehung von LER" beschreibt die Entstehung des Lehrfachs LER in den späten 1980er Jahren im Kontext der Umbrüche in der DDR. Das Forum „Bildungsnotstand“ im Jahr 1989, an dem verschiedene gesellschaftliche Gruppen teilnahmen, lieferte den Impuls für die Entwicklung von LER. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Standpunkte der Beteiligten und die Bedeutung des Themas „Lebensgestaltung“ im Kontext der DDR-Vergangenheit.
Der Abschnitt "Erörterung" setzt sich mit den Zielen und der Intention von LER auseinander. Die Arbeit verdeutlicht, dass LER nicht religionsfeindlich konzipiert wurde, sondern die Begegnung mit Religion und religiösen Denk- und Lebensformen für alle Schüler ermöglichen soll. Die Arbeit stellt die Unterschiede zwischen LER und dem traditionellen RU in Bezug auf die Rolle der Kirche und die Vermittlung von Werten dar.
Der Abschnitt "Jetzige Situation" beleuchtet die aktuelle Situation des Lehrfachs LER in Brandenburg. Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Chancen von LER im Vergleich zum RU und setzt sich mit der Verfassungsmäßigkeit des Modells auseinander.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Lebensgestaltung-Ethik-Religion (LER), Brandenburger Modell, Verfassungsmäßigkeit, Laizität, Wertevermittlung, Pluralismus, Kirche und Schule, Bildung, Ostdeutschland, DDR.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung LER?
LER steht für das Schulfach „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“, das in Brandenburg als Pflichtfach (mit Abmeldemöglichkeit) eingeführt wurde.
Wie unterscheidet sich LER vom herkömmlichen Religionsunterricht (RU)?
Während der RU konfessionell gebunden ist und von den Kirchen verantwortet wird, ist LER ein staatliches, weltanschaulich neutrales Fach, das verschiedene Religionen und Ethikmodelle vergleichend behandelt.
Warum gab es einen Rechtsstreit um LER?
Die Kirchen sahen durch LER das im Grundgesetz verankerte Recht auf Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach gefährdet und klagten vor dem Bundesverfassungsgericht.
Ist LER religionsfeindlich?
Nein, Ziel des Faches ist die Begegnung mit religiösen Denk- und Lebensformen für alle Schüler, unabhängig von ihrer Konfession, um Pluralismus und Wertevermittlung zu fördern.
Warum ist das Modell besonders für Ostdeutschland relevant?
Aufgrund der geringeren Kirchenbindung in den neuen Bundesländern suchte man nach einem integrativen Modell, das der Lebenswirklichkeit der Menschen ohne volkskirchliche Strukturen entspricht.
- Quote paper
- Ralf Strauss (Author), 2000, Der Streit um das Brandenburger Modell LER, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27926