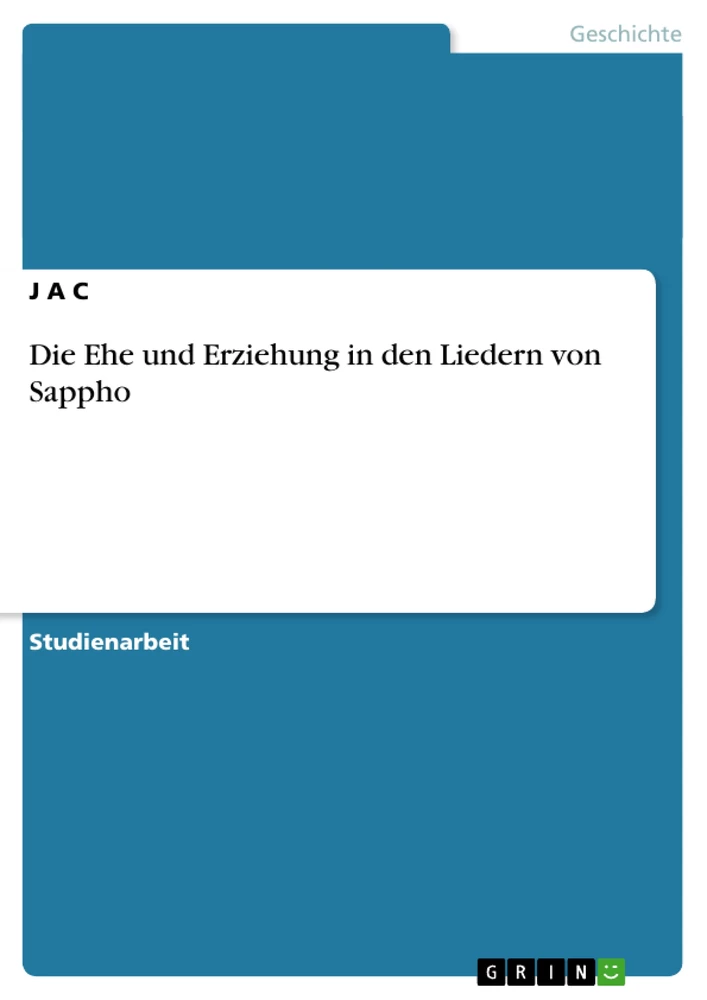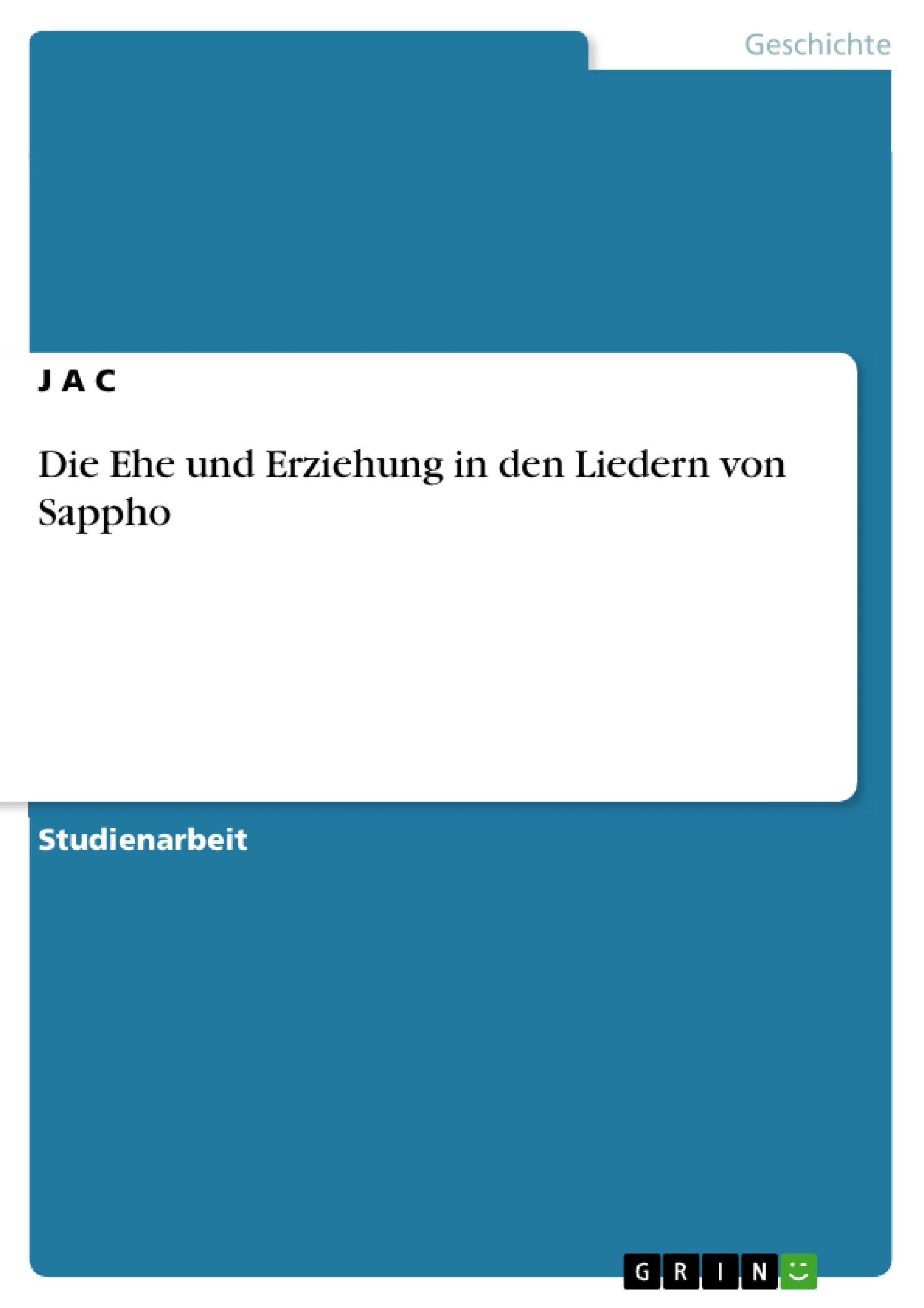"Ich heiße Sappho. Ich ragte im Singen so hoch über die Frauen wie Homer über die Männer."
Sappho war eine der bedeutenden Dichterinnen der Antike. Sie wurde zwischen 612 und 617 v. Chr. in Eressos auf der griechischen Insel Lesbos geboren und lebte somit zur archaischen Zeit, welche sich auf den Zeitraum von ca. 700 – 500 v. Chr. beschränkt. Diese Zeit war eine Krisenzeit, die sich durch die Konkurrenz zwischen den Adligen und der Not der Bauern äußerte und in welcher sich ebenfalls das Gemeinschaftsgefühl der Griechen entwickelte. Sappho wurde in eine aristokratische Familie geboren, die aus dem Vater Skámandros, der Mutter Kléis und drei Brüdern bestand. Wahrscheinlich ist, dass sie mit einem wohlhabenden Mann namens Kerkýlas verheiratet war und eine Tochter bekam, die sie nach ihrer Mutter Kléis benannte. Aufgrund politischer Spannungen, wurde Sappho um 600 v. Chr. vom damaligen Tyrannen ins Exil nach Sizilien verbannt.
Durch ihr Leben als Frau, in der archaischen Zeit, und deren begleitenden Krisen sind Sapphos Lieder und Gedichte bis heute bedeutend. Sapphos Lieder und Gedichte sind heute nur noch fragmentarisch erhalten, da sie u.a. im Mittelalter zu größten Teilen, aufgrund ihres Inhalts, vernichtet wurden. Somit ist es schwierig "verlässliche Informationen von spekulativen Behauptungen" zu unterscheiden. Sapphos Werke waren in der Antike darüberhinaus weitläufig bekannt und berühmt. Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil gründete Sappho einen Mädchenkreis, in welchem sie als Lehrerin fungierte und junge Mädchen auf das gesellschaftliche Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitete.
Die vorliegende Referatsverschriftlichung erläutert die Frage, wie die Erziehung junger Mädchen der Ehe durch Sappho, im antiken Griechenland, ausgesehen hat. Hierzu wird zunächst der Mädchenkreis Sapphos, sowie die Frau und die Ehe im antiken Griechenland allgemein beschrieben, um dann speziell auf Sapphos Lyrik und Werke einzugehen. Anhand eines Beispiels, nämlich der Quelle: Fragment 31, wird veranschaulicht, wie Sapphos Lyrik in der damaligen Zeit gewirkt hat und was sich aus dieser Überlieferung schließen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1,2. Sapphos Mädchenkreis
- 2,3. Die Frau und die Ehe im antiken Griechenland
- 4. Lyrik und Werke Sapphos
- 5. Fragment 31
- 6. Inhalt: Fragment 31
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Referatsverschriftlichung befasst sich mit der Erziehung junger Mädchen zur Ehe im antiken Griechenland, insbesondere im Kontext des Mädchenkreises, den Sappho gründete. Die Arbeit analysiert Sapphos Lyrik und Werke, um Einblicke in ihre pädagogischen Ansätze und die gesellschaftlichen Normen der Zeit zu gewinnen.
- Sapphos Mädchenkreis und seine Bedeutung für die Erziehung junger Frauen
- Die Rolle der Frau und die Bedeutung der Ehe im antiken Griechenland
- Analyse von Sapphos Lyrik und ihre Relevanz für die damalige Zeit
- Die Darstellung von Homosexualität in Sapphos Werken
- Die Bedeutung von Fragment 31 als Beispiel für Sapphos Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Sappho als eine der bedeutendsten Dichterinnen der Antike vor und beleuchtet ihre Lebensgeschichte, die von politischer Verfolgung und Exil geprägt war. Sapphos Werke sind nur fragmentarisch erhalten, da sie im Mittelalter aufgrund ihres Inhalts größtenteils vernichtet wurden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie Sappho junge Mädchen auf die Ehe vorbereitete.
Das Kapitel "Sapphos Mädchenkreis" beschreibt die Gründung und den Zweck des Kreises, in dem Sappho junge Mädchen aus wohlhabenden Familien unterrichtete. Die Erziehung umfasste Musik, Tanz, Riten und Regeln, sowie die Entwicklung von Anmut und Schönheit. Der Mädchenkreis diente als Initiation, bei der die Mädchen zum Erwachsenen wurden und sich einen Platz in der Gesellschaft schafften.
Das Kapitel "Die Frau und die Ehe im antiken Griechenland" beleuchtet die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die Ehe diente der Fortsetzung des Familienbandes und war eine Arbeitsgemeinschaft, die weder Liebe noch Zuneigung in den Vordergrund stellte. Die Frau war für den Haushalt und die Familie zuständig und politisch und juristisch rechtlos.
Das Kapitel "Lyrik und Werke Sapphos" analysiert Sapphos Werke, die auf Papyrus überliefert wurden und größtenteils auf der Mülldeponie der griechischen Verwaltungsstadt Oxyrhynchos gefunden wurden. Sapphos Themen spiegeln ihre Erziehung im Mädchenkreis wider, insbesondere die Bedeutung von Anmut und Schönheit sowie die Darstellung von Homosexualität. Die Interpretation ihrer Werke ist umstritten, doch einige Fragmente deuten auf weibliche Homoerotik hin.
Das Kapitel "Fragment 31" analysiert das berühmteste Lied Sapphos, das ihre Reaktion auf ein Mädchen im Gespräch mit einem Mann beschreibt. Sapphos körperliche Symptome, die durch unerfüllte Liebesleidenschaft entstehen, zeigen die Intensität ihrer Gefühle.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sappho, Mädchenkreis, antikes Griechenland, Erziehung, Ehe, Lyrik, Homosexualität, Fragment 31, Schönheit, Anmut, Liebe, Leidenschaft, Gesellschaft, Frauenrolle.
- Citar trabajo
- J A C (Autor), 2014, Die Ehe und Erziehung in den Liedern von Sappho, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279419