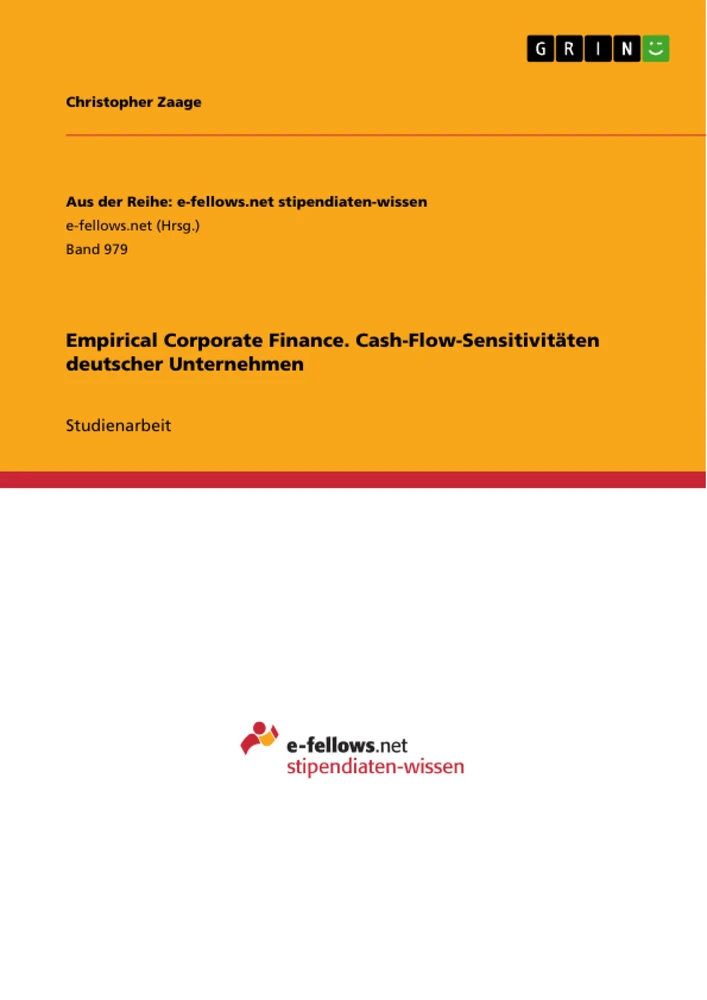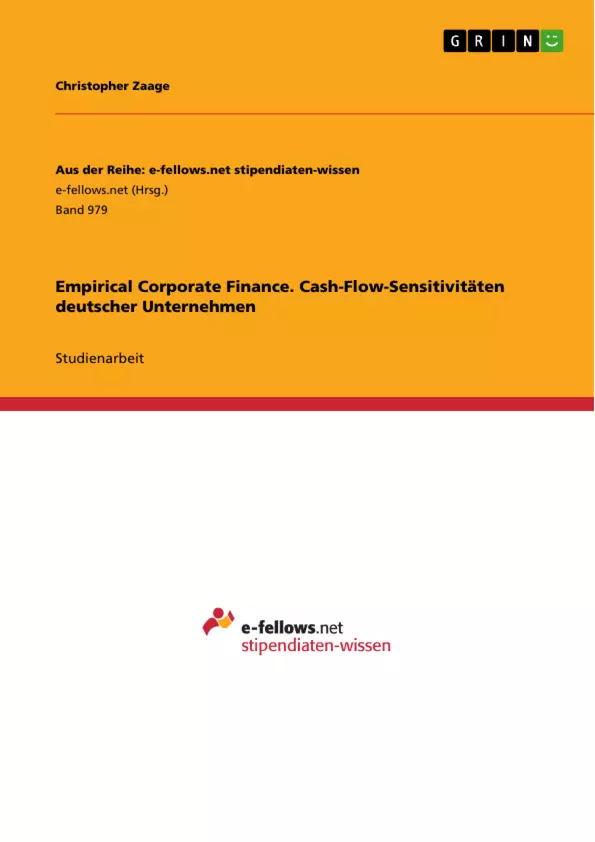Wie werden Investitionsentscheidungen von Unternehmen getroffen? In der Theorie ist
dies eine einfach zu beantwortende Frage, da alle Projekte mit positivem Nettobarwert
realisiert werden sollten, um den Unternehmenswert zu maximieren. Dagegen ist es eine
wesentliche Aufgabe der (theoretischen) Corporate Finance, zu untersuchen, ob es bei
gegebenem Investitionsprogramm eine optimale Struktur der Passivseite der Bilanz gibt,
und falls ja, wie diese aussieht.
In der Realität müssen diese beiden Seiten jedoch nicht zwangsläufig voneinander unabhängig sein, und so berücksichtigt und untersucht die empirische Forschung auch Zusammenhänge zwischen beiden Seiten und hinterfragt die in der grundlegenden Theorie
postulierte Unabhängigkeit. In dieser Arbeit soll speziell der Frage nachgegangen werden,
ob Investitionsentscheidungen abhängig vom Cashflow des Unternehmens sind.
Im Gegensatz zu einem Modell von perfekten und kompletten Kapitalmärkten (Modigliani,
Miller, 1958), in dem gezeigt werden kann, dass der Finanzstatus eines Unternehmens
irrelevant für dessen Investitionsentscheidungen sein sollte, muss dies in der
Realität nicht der Fall sein. Wenn Unternehmen keinen oder nur eingeschränkten Zugang
zum Kapitalmarkt haben, oder aus anderen Gründen externe (Re-)Finanzierung kostenintensiver
als interne ist, so würde dies darauf hindeuten, dass Unternehmen mit einem
hohen Cashflow auch in der Lage sind, mehr Investitionen zu tätigen, und Unternehmen
mit geringem Cahsflow dazu gezwungen sein können, Investitionsprojekte trotz eigentlich
positivem Nettobarwert nicht zu realisieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Hintergrund
- A Theorie
- B Empirie
- III Untersuchungsaufbau
- A Daten, Variablen und Regressionmodell
- B Adjustierung und Klassifikation
- IV Ergebnisdikussion
- A Resultate
- B Analyse
- C Interpretation
- V Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Cashflow-Sensitivität und Investitionsentscheidungen deutscher Unternehmen. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob Unternehmen mit einem hohen Cashflow mehr investieren und ob Unternehmen mit einem niedrigen Cashflow aufgrund von Finanzierungsbeschränkungen in ihren Investitionsentscheidungen eingeschränkt sind.
- Einfluss von Cashflows auf Investitionsentscheidungen
- Pecking Order Theorie und ihre empirische Evidenz
- Bedeutung von Finanzierungsbeschränkungen für Unternehmen
- Analyse von Daten aus der deutschen Wirtschaft
- Verbindung von Theorie und empirischer Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Cashflow-Sensitivität und Investitionsentscheidungen ein. Sie stellt die Frage nach der Abhängigkeit von Investitionsentscheidungen vom Cashflow und erklärt die Bedeutung dieser Frage im Kontext der theoretischen und empirischen Corporate Finance. Die Einleitung zeigt, dass die gängige Annahme der Unabhängigkeit von Investitionsentscheidungen vom Finanzstatus in der Realität nicht immer zutrifft, insbesondere wenn Unternehmen eingeschränkten Zugang zum Kapitalmarkt haben.
II Hintergrund
A Theorie
Dieser Abschnitt behandelt die Pecking Order Theorie, die einen theoretischen Rahmen zur Erklärung der möglichen Einflussnahme von Cashflows auf Investitionsentscheidungen bietet. Die Theorie basiert auf dem Konzept asymmetrischer Informationen und postuliert, dass Unternehmen interne Mittel gegenüber externen Finanzierungsquellen bevorzugen. Die Pecking Order Theorie argumentiert, dass Unternehmen selbst bei eingeschränktem Zugang zum Kapitalmarkt interne Mittel zur Finanzierung von Investitionen bevorzugen und erst als letztes Mittel auf Eigenkapital zurückgreifen würden. Hohe Cashflows erhöhen somit das Investitionspotenzial für Unternehmen.
B Empirie
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über bisherige empirische Studien zur Pecking Order Theorie. Er zeigt, dass verschiedene Studien Ergebnisse hervorgebracht haben, die die Theorie unterstützen. Der Abschnitt diskutiert die Ergebnisse wichtiger empirischer Arbeiten und stellt ihre Relevanz für die vorliegende Untersuchung dar.
III Untersuchungsaufbau
A Daten, Variablen und Regressionmodell
Dieser Abschnitt erläutert die Daten, Variablen und das Regressionsmodell, das in der Studie verwendet wird. Er beschreibt die Datenquellen und die spezifischen Variablen, die zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Cashflow und Investitionen herangezogen werden. Der Abschnitt erklärt die Wahl des Regressionsmodells und die dahinterstehende Methodik.
B Adjustierung und Klassifikation
Dieser Abschnitt geht auf die Adjustierung und Klassifizierung der Daten ein. Er beschreibt die angewandten Verfahren zur Bereinigung und Gruppierung der Daten, um sie für die Analyse vorzubereiten. Der Abschnitt erklärt die Kriterien, die für die Klassifizierung der Unternehmen verwendet werden.
IV Ergebnisdikussion
A Resultate
Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse. Er zeigt die Ergebnisse der Regressionsanalysen und stellt die wichtigsten statistischen Kennzahlen und deren Interpretation dar. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die quantitative Auswertung der Daten und die Darstellung der empirischen Befunde.
B Analyse
Dieser Abschnitt analysiert die in Abschnitt A präsentierten Ergebnisse. Er interpretiert die Ergebnisse im Kontext der theoretischen Annahmen und diskutiert mögliche Ursachen und Implikationen. Dieser Abschnitt stellt die Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang und versucht, die beobachteten Muster zu erklären.
C Interpretation
Dieser Abschnitt interpretiert die Ergebnisse der Analyse. Er diskutiert die Relevanz der Ergebnisse für die Theorie und die Praxis. Der Abschnitt geht auf die Einschränkungen der Studie ein und formuliert Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen.
Schlüsselwörter
Investitionen, Cashflow, Cashflow-Sensitivität, Pecking Order Theorie, Finanzierungsbeschränkungen, Kapitalmarkt, Unternehmen, empirische Forschung, Regressionsanalyse, deutsche Unternehmen.
- Quote paper
- Christopher Zaage (Author), 2012, Empirical Corporate Finance. Cash-Flow-Sensitivitäten deutscher Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279445