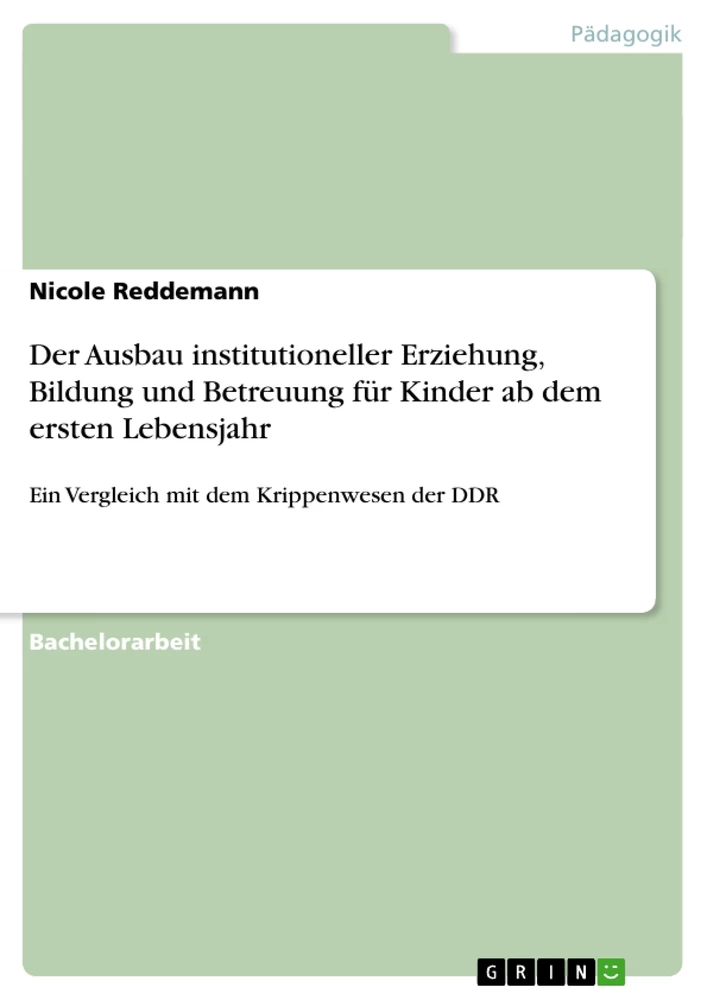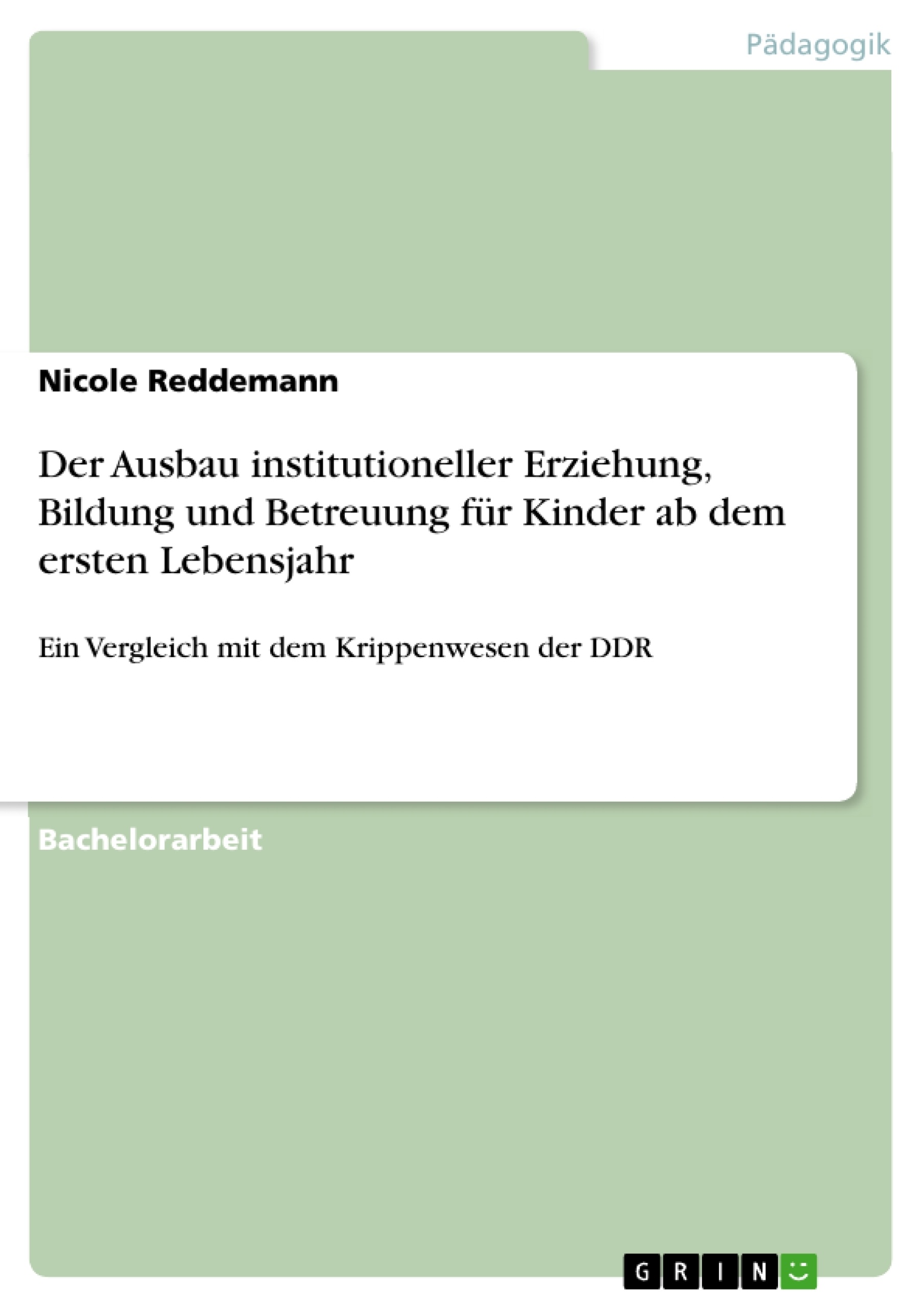Mit dem Stichtag des 01.08. 2013 haben deutschlandweit alle Eltern, deren Kind das erste Lebensjahr vollendet hat, einen rechtlichen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder innerhalb der Kindertagespflege. Mit Hilfe des flächendeckenden Ausbaus soll für insgesamt 39 Prozent aller Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen, wobei jedes Jugendamt, beziehungsweise Kommune, ihren individuellen Betreuungsbedarf selbst ermittelt (Statistisches Bundesamt, 2012).
Dieser Rechtsspruch resultiert zu einem großen Teil aus den Ergebnissen und anschließenden Diskussionen der ersten PISA-Studie im Jahr 2000, wonach sich Deutschland im Gesamtfazit innerhalb des Bereiches einer unterdurchschnittlich erfolgreichen Gruppe wiederfand. Besonders erschreckend wirkte dabei das Ergebnis, dass deutsche Schulsystem benachteilige Kinder aus bildungsfernen Schichten. Auf der Suche nach Gründen für das schlechte Abschneiden der Schüler im Sekundarbereich I stieg das öffentliche Interesse an vorschulischen Institutionen, wo, neben der Familie, die Grundlagen für gute oder schlechte schulische Leistungen gelegt werden. Auch die Ergebnisse der Starting Strong Studien von 2001 und 2004 bestätigten u. a., dass die Bildung der Jüngsten in den Kindertageseinrichtungen einen zu geringen Stellenwert einnimmt und die Startchancen eines Kindes abhängig von seiner sozialen und regionalen Herkunft sind.
Die Politiker Deutschlands erkannten, dass neben den Bildungschancen der Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten, der seit jeher als eine familienergänzende Institution akzeptiert wird, auch das Bildungspotenzial der Kinder im Alter von null bis drei Jahren nicht ungenutzt bleiben darf. Deutschland tat es dem europäischen Ausland gleich und widmete sich fortan der Frage, welchen Beitrag bereits Kindertageseinrichtungen zur frühkindlichen Bildung und Kompetenzentwicklung leisten können. Die Bestrebungen des Staates rühren auch vor dem Hintergrund der aktuellen demografischen Entwicklungen, in denen Kinder als eine knapp gewordene Ressource begriffen werden und wo es gilt, dass jede einzelne Bildungschance mobilisiert werden muss.
Bezüglich des Ausbaus wurden aber auch Gegenstimmen laut, die das Vorhaben der Familienpolitik als einen gesellschaftspolitischen Skandal beschrieben, da es „nicht an der Stärkung der Familie und am Kindeswohl orientiert, ja sogar, kinderfeindlich sei“ (Süddeutsche, 2010). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die institutionelle Betreuung von Kindern unter drei Jahren von Beginn des 19. Jh. bis zur Wiedervereinigung Deutschlands
- Der Beginn der institutionellen Betreuung
- Das Krippenwesen der DDR innerhalb des kulturellen sowie sozialpolitischen Kontextes
- Begriffliche Grundlage: Kinderkrippe
- Das Krippenwesen der DDR innerhalb des kulturellen sowie sozialpolitischen Kontextes
- Die institutionelle Erziehung und Betreuung in Westdeutschland
- Die institutionelle Erziehung, Bildung und Betreuung im wiedervereinigten Deutschland
- Begriffliche Grundlage: Tageseinrichtungen für Kinder
- Die institutionelle Erziehung, Bildung und Betreuung im wiedervereinigten Deutschland innerhalb des kulturellen sowie sozialpolitischen Kontextes
- Zwischenfazit
- Die institutionelle Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der gegenwärtigen Betrachtung
- Gesetzliche Verankerung der Grundwerte zum Schutz der Familie und des Kindes
- Der bildungspolitische Kontext des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen
- Der quantitative Ausbau in den ost- und westdeutschen Bundesländern
- Möglichkeiten zur Bestimmung von Qualitätskriterien
- Zwischenfazit
- Gegenwärtige pädagogische Orientierungen in der Gegenüberstellung mit der DDR
- Begriffliche Grundlage und Eingrenzung: Pädagogische Orientierung
- Grundbedürfnisse von Kindern unter drei Jahren
- Das Bild vom Kind
- Das Bild vom Kind in der aktuellen Betrachtung
- Das Bild vom Kind in der DDR
- Pädagogische Arbeitsweisen und Handlungskonzepte
- Bildungspläne und Bildungsgrundsätze
- Das Erziehungsprogramm in der DDR
- Zwischenfazit
- Pädagogisches Personal in der aktuellen Betrachtung
- Gegenwärtige pädagogische Strukturen institutioneller Betreuungseinrichtungen für Unterdreijährige in der Gegenüberstellung mit der DDR
- Begriffliche Grundlage und Eingrenzung: Pädagogische Strukturen
- Personale Dimension
- Pädagogisches Personal in den Kinderkrippen der DDR
- Soziale Dimension
- Die aktuelle Betreuungsrelation
- Die Betreuungsrelation in der DDR
- Räumlich-materiale Dimension
- Größe und Ausstattung der Räumlichkeiten in der aktuellen Betrachtung
- Größe und Ausstattung der Räumlichkeiten in der DDR
- Zwischenfazit
- Pädagogische Prozesse in der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Gegenüberstellung mit der DDR
- Begriffliche Grundlage und Eingrenzung: Pädagogische Prozesse
- Eingewöhnung
- Die Eingewöhnungszeit in der aktuellen Betrachtung
- Die Eingewöhnung in der DDR
- Umgang mit Körperhygiene
- Die ,,Sauberkeitserziehung“ in der aktuellen Betrachtung
- Die Sauberkeitserziehung in der DDR
- Spiel
- Das Spiel in der aktuellen Betrachtung
- Das Spiel in der DDR
- Einbezug der Familie
- Der Einbezug der Familie in der aktuellen Betrachtung
- Der Einbezug der Familie in der DDR
- Zwischenfazit
- Gesamtfazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Ausbau der institutionellen Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr in Deutschland und setzt dies in Beziehung zum Krippenwesen der DDR. Ziel ist es, die Entwicklung der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren von ihren Anfängen bis zur Gegenwart zu beleuchten und dabei die Besonderheiten der DDR in den Blick zu nehmen.
- Die historische Entwicklung der institutionellen Kinderbetreuung in Deutschland und der DDR
- Der bildungspolitische Kontext des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen
- Die pädagogischen Orientierungen und Strukturen der Kinderbetreuung in der Gegenwart und der DDR
- Die pädagogischen Prozesse in der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren
- Die Bedeutung des Einbezugs der Familien in die Betreuung ihrer Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der institutionellen Kinderbetreuung in Deutschland und der DDR. Dabei wird der Beginn der institutionellen Betreuung, das Krippenwesen der DDR im kulturellen und sozialpolitischen Kontext sowie die institutionelle Erziehung und Betreuung in Westdeutschland und im wiedervereinigten Deutschland dargestellt. Kapitel 3 widmet sich der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der gegenwärtigen Betrachtung. Hier werden die gesetzliche Verankerung der Grundwerte zum Schutz der Familie und des Kindes, der bildungspolitische Kontext des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, der quantitative Ausbau in den ost- und westdeutschen Bundesländern sowie Möglichkeiten zur Bestimmung von Qualitätskriterien behandelt. Kapitel 4 befasst sich mit den gegenwärtigen pädagogischen Orientierungen in der Gegenüberstellung mit der DDR. Hier werden die Grundbedürfnisse von Kindern unter drei Jahren, das Bild vom Kind in der aktuellen Betrachtung und in der DDR sowie pädagogische Arbeitsweisen und Handlungskonzepte beleuchtet. Kapitel 5 analysiert das pädagogische Personal in der aktuellen Betrachtung und stellt dies in Beziehung zu den pädagogischen Strukturen institutioneller Betreuungseinrichtungen für Unterdreijährige in der DDR. Kapitel 6 untersucht die pädagogischen Prozesse in der institutionellen Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der Gegenüberstellung mit der DDR. Hier werden die Eingewöhnungszeit, der Umgang mit Körperhygiene, das Spiel und der Einbezug der Familie betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern institutionelle Kinderbetreuung, Krippenwesen, Bildung, Erziehung, Betreuung, frühkindliche Bildung, pädagogische Orientierungen, Bildungspläne, Personalstrukturen, Betreuungsrelation, pädagogische Prozesse, Eingewöhnung, Sauberkeitserziehung, Spiel, Einbezug der Familie, Deutschland, DDR.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann gibt es den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab einem Jahr?
In Deutschland haben Eltern seit dem 1. August 2013 einen rechtlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben.
Wie unterschied sich das Krippenwesen der DDR von Westdeutschland?
In der DDR war die Krippenbetreuung flächendeckend und staatlich organisiert, um die Berufstätigkeit der Mütter zu sichern. In Westdeutschland galt die Betreuung unter Dreijähriger lange Zeit primär als Familienaufgabe.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf die Kitas?
Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler im Jahr 2000 rückte vorschulische Institutionen in den Fokus, da dort die Grundlagen für Bildungschancen gelegt werden.
Was versteht man unter "Sauberkeitserziehung" im Vergleich?
In der DDR war die Sauberkeitserziehung oft kollektiv und zeitlich getaktet, während die heutige Pädagogik stärker auf die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsphasen des Kindes eingeht.
Warum werden Kinder heute als "knappe Ressource" bezeichnet?
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gilt es, jede einzelne Bildungschance zu nutzen, um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern.
- Citar trabajo
- Nicole Reddemann (Autor), 2013, Der Ausbau institutioneller Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279542