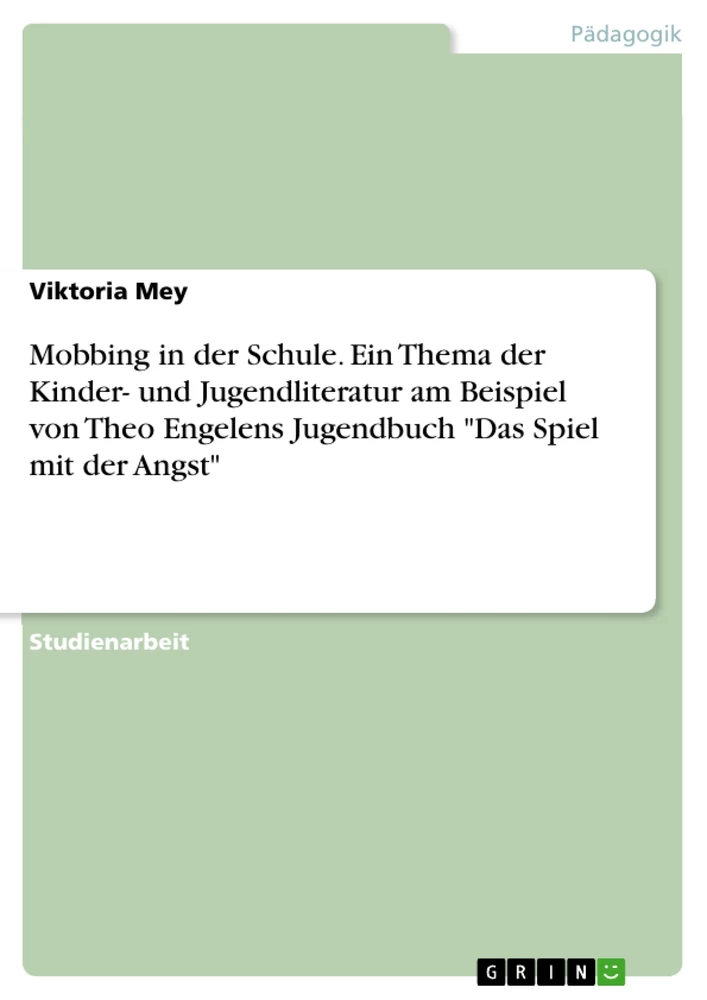„Mobbing in der Schule ist eine Realität. Es kommt überall vor, in kleinen Land- und großen Stadtschulen, in allen Schularten und allen Bundesländern. Es kann jeden einmal treffen.“ (Kasper) Die in Kaspers Zitat deutlich gewordene Problematik von Mobbing an Schulen sollte uns als angehende Lehrkräfte alarmieren und dafür sorgen, dass wir uns damit beschäftigen, wie eine Sensibilisierung in den Schulen und damit explizit in unserem eigenen Unterricht gestaltet werden kann.
Es ist laut dem Kerncurriculum des Niedersächsischen Kultusministeriums Ziel des Deutsch- und insbesondere des Literaturunterrichts, soziale Kompetenzen als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Schülern/-innen auszubilden. Wir sollen ihnen vermitteln, wie man verantwortungsbewusst handelt und Kooperations- und Konfliktfähigkeit entwickelt. Darüber hinaus ist es wichtig, bei der Auswahl von Literatur für den Schulunterricht zu bedenken, dass das Thema eine Relevanz für die Lebenswelt der Schüler/-innen beinhalten sollte. Die Aktualität dieser Problematik zeigt auf, dass diese Parallele zur Welt der heutigen Schülerschaft – an welcher Schulform wir später auch unterrichten mögen – gegeben ist. Zudem ist es unsere Aufgabe als Lehrer/-innen des Faches Deutsch zumindest zu versuchen, Kinder und Jugendliche für Literatur zu begeistern und sie zum Lesen zu motivieren.
Diese Hausarbeit möchte am Beispiel von Theo Engelens "Das Spiel mit der Angst" demonstrieren, wie man diese Thematik in den Deutschunterricht einbauen kann. Die Arbeit befasst sich mit einer Definition von Mobbing und den unterschiedlichen Erscheinungsformen, dem "Tatort Schule" sowie eventuellen Maßnahmen gegen Mobbing. Darüber hinaus wird das Thema "Mobbing" in der Kinder- und Jugendliteratur thematisiert sowie seine Form einer Grenzüberschreitung innerhalb des Literaturunterrichts. Übertragen wird dies auf die Behandlung des Buches "Das Spiel mit der Angst" im Schulunterricht.
- Citar trabajo
- Viktoria Mey (Autor), 2013, Mobbing in der Schule. Ein Thema der Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel von Theo Engelens Jugendbuch "Das Spiel mit der Angst", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279586