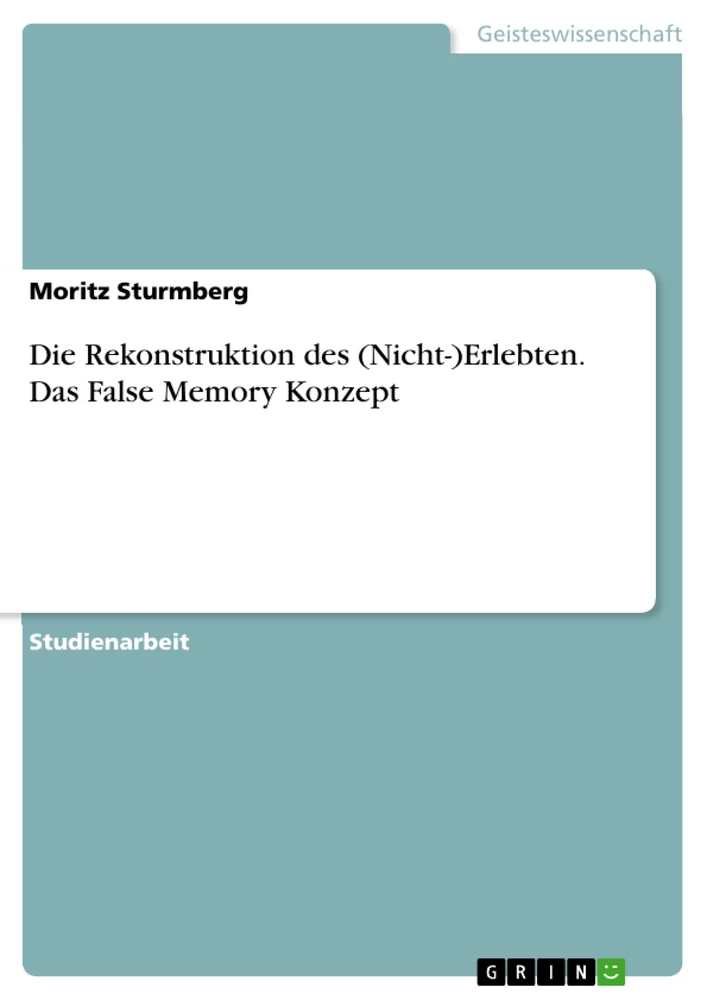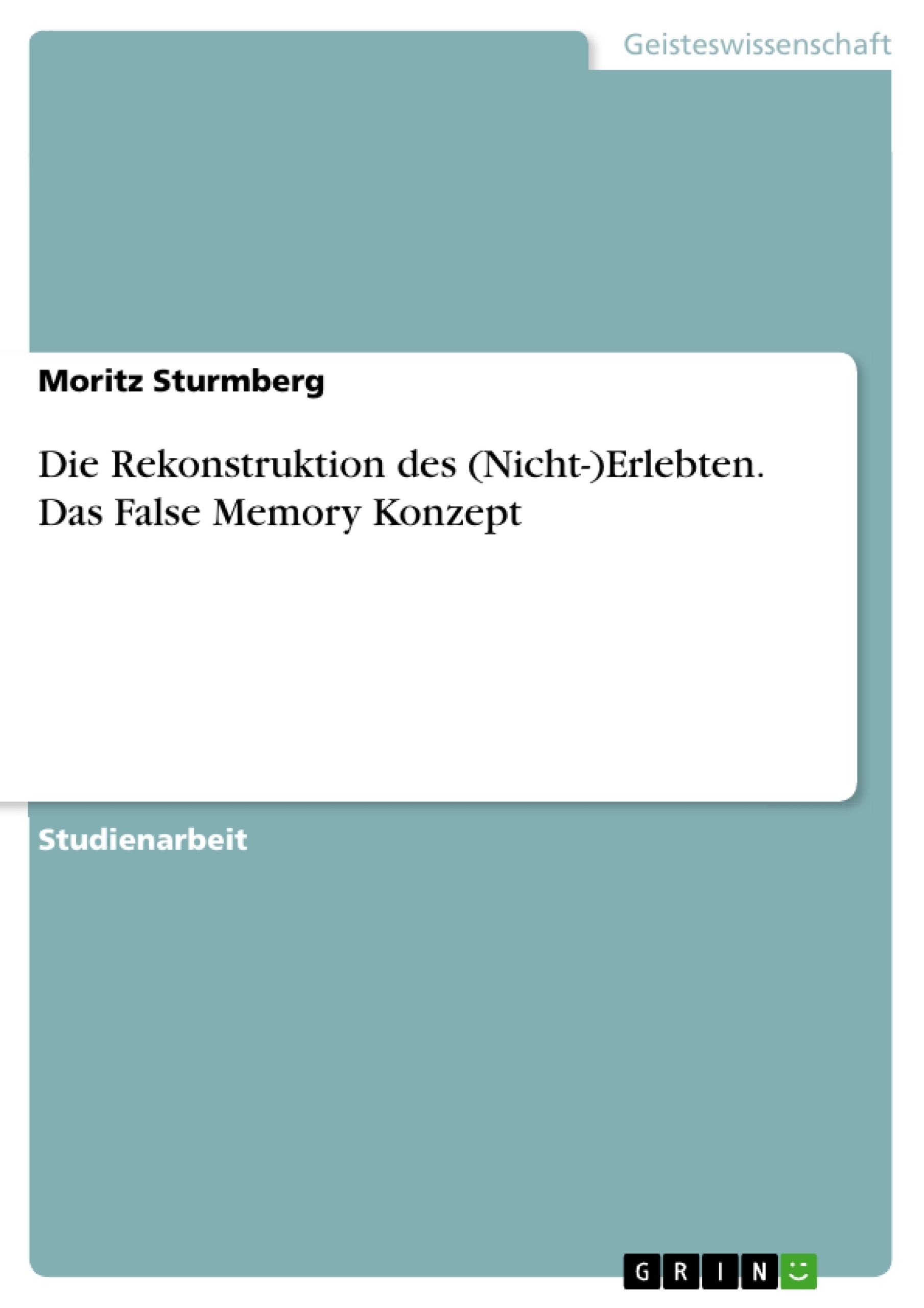Die Funktionalität des Gehirns ist für den Menschen schon immer ein sowohl faszinierendes als auch schwer greifbares Phänomen gewesen. Aus historischer Sicht ist die Darstellung häufig angelehnt an technische Errungenschaften der jeweiligen Zeit. Sigmund Freud sprach von einem „psychischen Apparat“, der Verhaltensforscher Konrad Lorenz empfand hinsichtlich des Instinktverhaltens den Vergleich zum Dampfkesselmodell als besonders sinnvoll und die amerikanischen Behavioristen sahen im Gehirn Analogien zu einer selbstständig arbeitenden Telefonschaltzentrale. [...]
Eine entscheidende Rolle für menschliche Gedächtnisleistungen spielt das autobiographische Gedächtnis. Es ist das einzig dem Menschen vorbehaltene Privileg, „ ‚ich’ sagen zu können und damit eine einzigartige Person zu meinen, die eine besondere Lebensgeschichte, eine bewusste Gegenwart und eine erwartbare Zukunft hat“. Allerdings ist das autobiographische Gedächtnis, wie man erkannt hat, anfällig für Verwechselungen der Umstände von Geschehnissen sowie der Quelle von Ereignissen. Es ist daher möglich, im Extremfall Erinnerungen an komplette Ereignisse bildlich und detailliert vor Augen zu haben, die nie geschehen sind.
Zunächst wird in dieser Arbeit der Versuch unternommen, in die Thematik von „false memory“ einzuführen und einen Eindruck der Bedeutsamkeit von Gedächtnis und Erinnerung für die lebensweltliche Orientierung des Menschen zu vermitteln.
Kern dieser Arbeit wird im drauf folgenden Abschnitt die Betrachtung einiger unterschiedlicher Gedächtnisphänomene, die ursächlich mit der Entstehung falscher Erinnerungen in Verbindung gebracht werden. Es ist dabei beabsichtigt, die einzelnen Punkte durch Beispiele aus dem Alltag oder aus dazu existierenden Studien zu veranschaulichen. Eine Abgrenzung der einzelnen Teile erfolgt in erster Linie zum Zweck einer deutlicheren Illustration. Gerade im Bereich von Quellenverwechslungen und -amnesien, für die viele Beispiele aufgeführt werden, erweisen sich klare Abgrenzungen als schwierig. Eine Trennung erfolgt hier häufig nur, wenn sich der Schwerpunkt der Betrachtung verlagert, wie zum Beispiel hinsichtlich der Konzentration auf Schemata und Kategorienbildung. Es wird in den aufgeführten Punkten außerdem auf verschiedene Bereiche des Gedächtnisprozesses konzentriert, bei denen es zu falschen Erinnerungen kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Falsche Erinnerungen – Einführung und Grundlagen
- 3 „Sünden“ des Gedächtnisses - Wie entstehen falsche Erinnerungen?
- 3.1 Verblassen von Erinnerungen
- 3.2 Die Selektivität der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
- 3.3 Das „tip of the tongue“ Phänomen
- 3.4 Fehlzuordnungen und Fehlinformationen
- 3.5 Quellen-Überwachung, Quellenverwechselungen und Quellenamnesien im Kontext der menschlichen Vorstellungsgabe
- 3.6 Suggestibilität und induzierte Fehlinformationen
- 3.7 (kulturelle) Schemata und die soziale Dimension
- 3.8 Die Persistenz von Erinnerungen
- 4 Fazit/Ausblick
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „false memory“ (falsche Erinnerungen) und beleuchtet verschiedene Aspekte seiner Entstehung. Das Hauptziel besteht darin, einen Überblick über die relevanten Gedächtnisphänomene zu geben, die zu falschen Erinnerungen führen können, und diese durch alltägliche Beispiele und Forschungsergebnisse zu illustrieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rekonstruktion des (Nicht-)Erlebten und die damit verbundenen Forschungsaspekte.
- Die Entstehung falscher Erinnerungen
- Verschiedene Gedächtnisphänomene (z.B. Verblassen, Fehlzuordnungen)
- Der Einfluss von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Suggestion
- Die Rolle von Schemata und der sozialen Dimension
- Die Bedeutung des autobiographischen Gedächtnisses
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des „false memory“ ein und betont die Bedeutung von Gedächtnis und Erinnerung für die menschliche Lebensweltorientierung. Sie verweist auf die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit evolutionsbedingten Gedächtnisentwicklungen und -prozessen, die im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise behandelt werden können. Der Fokus liegt auf der Einführung in das Thema und der Ankündigung der folgenden Kapitel, die sich detaillierter mit verschiedenen Aspekten des „false memory“ befassen.
2 Falsche Erinnerungen – Einführung und Grundlagen: Dieses Kapitel hinterfragt den scheinbaren Widerspruch im Begriff „falsche Erinnerungen“ und stellt heraus, dass falsche Erinnerungen trotz ihrer Irreführung im Alltag weit verbreitet sind. Es werden Beispiele aus alltäglichen Gesprächen über vergangene Ereignisse angeführt, die unterschiedliche Erinnerungen bei Beteiligten offenbaren. Das Kapitel betont die Individualität der Wahrnehmung und die damit verbundene Subjektivität von Erinnerungen. Der Prozess der Entstehung sowohl wahrer als auch falscher Erinnerungen wird als mehrstufiger Prozess beschrieben, der von der Wahrnehmung über die Verarbeitung und Speicherung bis zum Abruf reicht. Fehler können in jeder dieser Stufen auftreten und zu falschen Erinnerungen führen.
Schlüsselwörter
Falsche Erinnerungen, False Memory, Gedächtnis, Erinnerung, Autobiographisches Gedächtnis, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Suggestion, Fehlinformationen, Quellenüberwachung, Quellenverwechselung, Quellenamnesie, Schemata, soziale Dimension, Gedächtnisphänomene, Erinnerungsverfälschung.
Häufig gestellte Fragen: Falsche Erinnerungen - Ein Überblick
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Phänomen der „falschen Erinnerungen“ (false memory). Sie untersucht die Entstehung falscher Erinnerungen und beleuchtet verschiedene Aspekte, die dazu beitragen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung falscher Erinnerungen, verschiedene Gedächtnisphänomene wie Verblassen, Fehlzuordnungen und die Rolle von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Suggestion. Der Einfluss von Schemata, der sozialen Dimension und die Bedeutung des autobiographischen Gedächtnisses werden ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen falscher Erinnerungen, ein Kapitel zu den "Sünden" des Gedächtnisses (detaillierte Analyse der Entstehung falscher Erinnerungen), ein Fazit/Ausblick und ein Literaturverzeichnis. Das Kapitel zu den "Sünden" des Gedächtnisses unterteilt sich in Unterkapitel zu verschiedenen Aspekten wie dem Verblassen von Erinnerungen, der Selektivität der Wahrnehmung, dem "tip of the tongue" Phänomen, Fehlzuordnungen, Quellenüberwachung, Suggestibilität und dem Einfluss kultureller Schemata.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, einen Überblick über die relevanten Gedächtnisphänomene zu geben, die zu falschen Erinnerungen führen können. Alltägliche Beispiele und Forschungsergebnisse sollen diese Phänomene illustrieren. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion des (Nicht-)Erlebten und den damit verbundenen Forschungsaspekten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Falsche Erinnerungen, False Memory, Gedächtnis, Erinnerung, Autobiographisches Gedächtnis, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Suggestion, Fehlinformationen, Quellenüberwachung, Quellenverwechselung, Quellenamnesie, Schemata, soziale Dimension, Gedächtnisphänomene, Erinnerungsverfälschung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik des „false memory“ ein, betont die Bedeutung von Gedächtnis und Erinnerung und weist auf die Komplexität des Themas hin. Sie gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel.
Was wird im Kapitel "Falsche Erinnerungen – Einführung und Grundlagen" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „falsche Erinnerungen“, zeigt die Verbreitung falscher Erinnerungen im Alltag auf und beschreibt den mehrstufigen Prozess der Entstehung von Erinnerungen (Wahrnehmung, Verarbeitung, Speicherung, Abruf), wobei Fehler in jeder Stufe zu falschen Erinnerungen führen können.
Was ist das Fazit/der Ausblick?
Der Inhalt des Fazit/Ausblick Kapitels wird in der gegebenen Textvorlage nicht näher beschrieben.
- Citation du texte
- Moritz Sturmberg (Auteur), 2012, Die Rekonstruktion des (Nicht-)Erlebten. Das False Memory Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279658