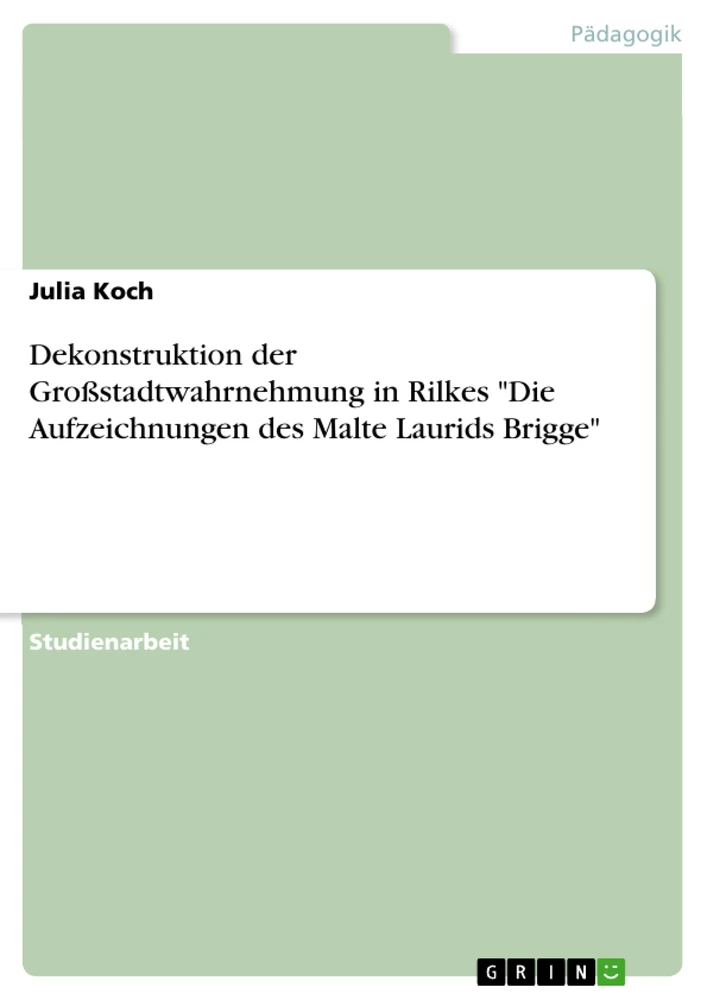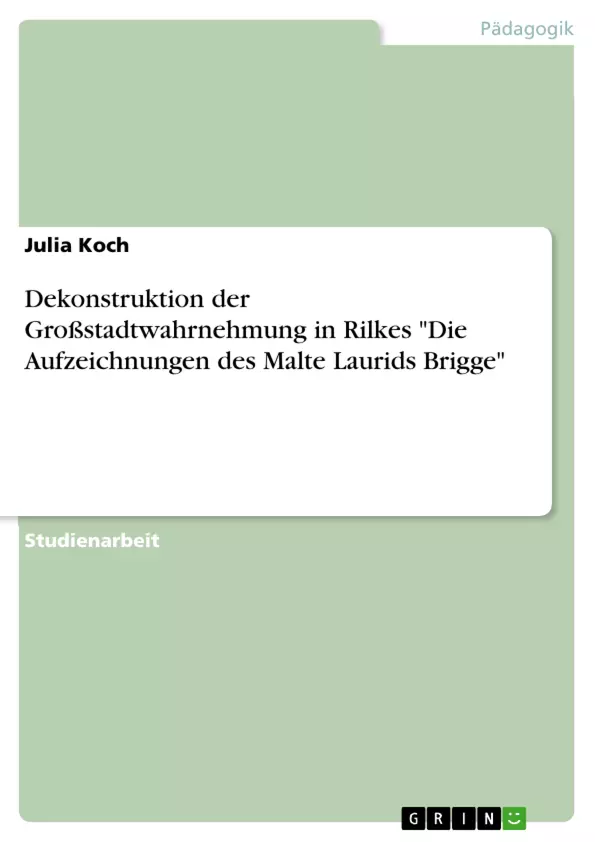Die Zeit der Jahrhundertwende konfrontiert das Individuum mit einem großstädtischen Leben, das sich grundlegend von den Erfahrungen früherer Generationen unterscheidet. Im Zuge der industriellen Revolution verändert sich die wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit nachhaltig. Der veränderte Lebens- und Erfahrungsraum hat einen großen Einfluss auf das Individuum, welches sich einer enormen Beschleunigung des Lebens gegenübergestellt sieht. Die Großstadt ist ein Ort der Reizüberflutung, die das Subjekt zwingt, seine Wahrnehmung den veränderten Bedingungen seiner Umwelt anzupassen.
Diese Veränderung der Perzeption geht mit einer Infragestellung der traditionellen Erzählform einher, da diese an der Darstellung dieser neuen Wirklichkeit zu scheitern scheint. Rilkes Werk „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ zeigt den Versuch, der neuen großstädtischen Lebensform in der Darstellung des Textes gerecht zu werden. Die Unmöglichkeit des Erzählens einer sich kontinuierlich entwickelnden Handlung wird im einzigen Prosawerk Rilkes nicht nur durch die Hauptfigur selbst thematisiert, sondern zeigt sich auch in der Zerstückelung des Textes, der sich als eine Sammlung verschiedener Textfragmente präsentiert.
Die Destruktion nimmt den ursprünglichen Sinn und damit die kausale Kohärenz, gleichzeitig wird durch die Konstruktion des neuen Textgefüges ein anderer Sinnhorizont eröffnet.In der Untersuchung der Darstellungsweise des Textes soll herausgearbeitet werden, dass die Aufzeichnungen eine Dekonstruktion tradierter Erzählformen repräsentieren, deren Konzept darin besteht, der großstädtischen Wirklichkeit adäquat zu begegnen. Dabei sollen jene Elemente hervorgehoben werden, die die Komponenten dieses Dekonstruktionsvorhabens darstellen. Betont werden hierbei die Wahrnehmungsveränderungen, insbesondere das Motiv des „Sehen Lernens“, die Unmöglichkeit der erzählerischen Darstellung großstädtischer Wahrnehmungen und die Verwendung impressionistischer Verfahren, die die Aufzeichnungen prägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung Dekonstruktion
- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
- Die Struktur der Aufzeichnungen
- Veränderung der Wahrnehmung
- Impressionistische Darstellungsweise
- Erzählproblematik
- Der Leser als Souverän
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ die traditionelle Erzählform dekonstruiert, um der neuen großstädtischen Lebensform gerecht zu werden. Dabei wird die Darstellung des Textes als ein Versuch interpretiert, die Unmöglichkeit einer kontinuierlichen Handlung in der modernen Großstadt zu reflektieren.
- Dekonstruktion der traditionellen Erzählform
- Veränderung der Wahrnehmung in der Großstadt
- Impressionistische Darstellungsweise
- Erzählproblematik in der Darstellung großstädtischer Erfahrung
- Der Leser als aktiver Rezipient
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der Dekonstruktion der Großstadtwahrnehmung ein. Kapitel 2 erläutert den Begriff der Dekonstruktion anhand der Ansätze von Jacques Derrida und Paul de Man. Kapitel 3 analysiert die „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ als Beispiel einer dekonstruktiven Erzählform. Es untersucht die Struktur des Textes, die Veränderung der Wahrnehmung, die impressionistische Darstellungsweise, die Erzählproblematik und die Rolle des Lesers.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Dekonstruktion der Großstadtwahrnehmung, die Veränderungen der Wahrnehmung, impressionistische Erzählformen, die Erzählproblematik in der modernen Großstadt und die Rolle des Lesers in der Rezeption dekonstruktiver Texte. Zu den zentralen Begriffen gehören Dekonstruktion, Großstadt, Wahrnehmung, Impressionismus, Erzählform und Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Rilkes "Malte Laurids Brigge"?
Der Roman thematisiert die radikale Veränderung der Wahrnehmung eines Individuums in der modernen, reizüberfluteten Großstadt Paris um 1900.
Was bedeutet das Motiv des "Sehen Lernens"?
Es beschreibt den Versuch der Hauptfigur, die Zersplitterung der modernen Welt wahrzunehmen, ohne sie sofort in alte, ordnende Denkmuster zu pressen.
Warum ist der Text so fragmentarisch aufgebaut?
Die Zerstückelung spiegelt die Unmöglichkeit wider, eine kontinuierliche, kausale Handlung in einer chaotischen großstädtischen Wirklichkeit zu erzählen.
Welche Rolle spielt der Impressionismus im Werk?
Rilke nutzt impressionistische Verfahren, um flüchtige Sinneseindrücke und die subjektive Wahrnehmung der Realität unmittelbar darzustellen.
Was versteht man unter der "Dekonstruktion der Erzählform"?
Es ist das Aufbrechen traditioneller Erzählstrukturen, um einer neuen, komplexen Wirklichkeit gerecht zu werden, die mit klassischen Mitteln nicht mehr darstellbar ist.
- Citar trabajo
- Julia Koch (Autor), 2013, Dekonstruktion der Großstadtwahrnehmung in Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279847