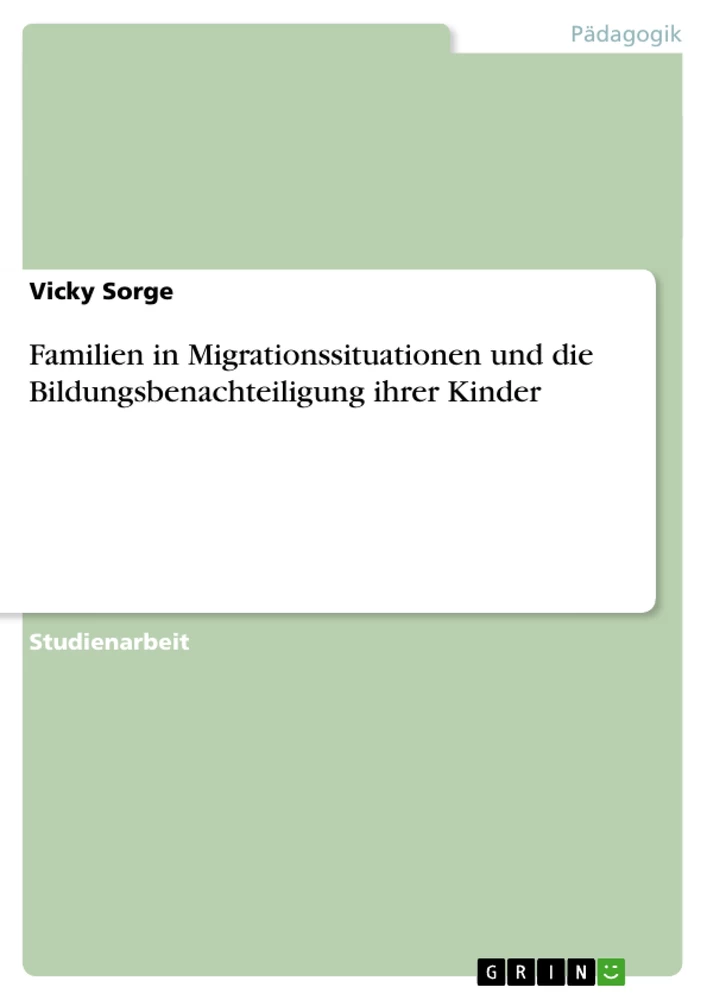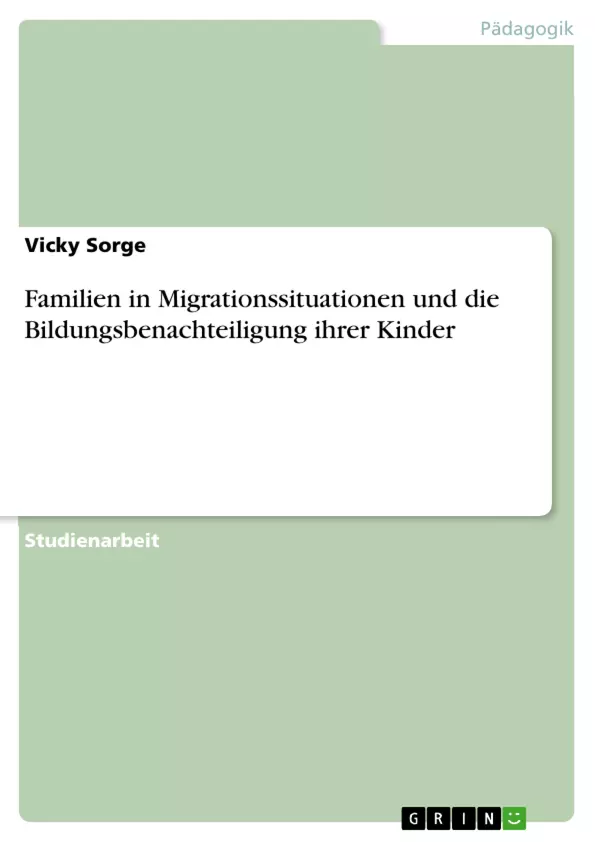Im Jahr 2008 gab es in Deutschland circa vier Millionen Familien, bei denen mindestens ein Familienmitglied Migrationshintergrund hat. Aber diese Familien haben neben der Gemeinsamkeit nach Deutschland eingewandert zu sein auch viele Faktoren in denen sie sich voneinander unterscheiden. Die Erfahrungen mit Migration und deren nationale sowie ethnische Zusammensetzung ist der erste Punkt in dem sie sich voneinander abgrenzen. Ein weiterer Faktor, der die Familien voneinander unterscheiden lässt, sind die Ressourcen und Motivationen mit denen die jeweiligen Familien ausgewandert sind. Es kommt dann auch noch deren aufenthaltsrechtlicher Status dazu sowie die soziale Integration, was wiederrum die Platzierung in der gesellschaftlichen Struktur des Einwanderungslandes beeinflusst (Herwartz-Emden; Schurt; Waburg 2010, S.23). Was sich allerdings zum größten Teil verallgemeinern lässt, ist, dass die meisten Migrantenfamilien aus ärmeren Ländern stammen und in westliche Staaten einwandern, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Deren Ressourcen sind auf allen Ebenen eher geringfügig. Das heißt sie besitzen wenig ökonomisches Kapital, was auf deren finanzielle Rücklagen bezogen ist und auch wenig kulturelles sowie soziales Kapital. Um zu verstehen, welche Leistungen die Einwanderer erbringen müssen, kommt der Begriff der Akkulturation zum Tragen (vgl. ebd., S. 24). [...]
Die erste Strategie ist die Assimilation, bei der sich die Einwanderer der Kultur des Aufnahmelandes ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen. Eine weitere Art sich zu akkulturieren, ist die Segregation. Hier wird die Aufnahmekultur völlig abgelehnt, um die eigene Kultur aufrechterhalten zu können. Die Integration ist die nächste Strategie, die angewendet werden kann, um beide Kulturen zu verbinden und so ein gutes Mittelmaß zu finden. Die vierte Akkulturationsstrategie ist die Ignoranz beider Kulturen, [...]
In der folgenden Ausarbeitung wird im Einzelnen darauf eingegangen, wie Familien in Migrationssituationen agieren und mit der Veränderung umgehen. Der Schwerpunkt dieser Seminararbeit liegt dabei auf den Kindern und Jugendlichen im Migrationskontext und deren Bildungsbenachteiligung. Ebenso wird abschließend eine Zusammenfassung gegeben, wie sich die Integration der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Schule und Ausbildung vollzieht und wie sie sich vollziehen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familien in Migrationssituationen
- Kinder und Jugendliche im Migrationskontext
- Bildungsbenachteiligung
- Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Situation von Familien in Migrationssituationen in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Auswirkungen der Migration auf Kinder und Jugendliche. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Integration, die Bildungsbenachteiligung, die Rolle der Familie und die verschiedenen Akkulturationsstrategien, die Migrantenfamilien anwenden.
- Die Herausforderungen der Integration von Migrantenfamilien
- Die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Die Bedeutung der Familie als Schutzraum und Ressource für Migranten
- Die verschiedenen Akkulturationsstrategien von Migrantenfamilien
- Die Rolle der Bildung und des gesellschaftlichen Umfelds für die Integration von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Themas Familien in Migrationssituationen dar, beleuchtet die aktuelle Situation in Deutschland und führt den Begriff des Migrationshintergrunds ein.
- Familien in Migrationssituationen: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von Migrantenfamilien in Deutschland, den Einfluss der Migration auf Familienstrukturen und die Rolle des Familialismus. Es wird die Bedeutung der Familie als Schutzraum und Ressource für Migranten hervorgehoben.
- Kinder und Jugendliche im Migrationskontext: Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen, denen Kinder und Jugendliche in Migrationssituationen begegnen. Es werden Themen wie Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und Diskriminierung behandelt.
- Bildungsbenachteiligung: Dieses Kapitel analysiert die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es werden die Ursachen der Benachteiligung und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Familien in Migrationssituationen, Integration, Bildungsbenachteiligung, Akkulturation, Familialismus, interkulturelle Bildung, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, gesellschaftliche Integration, Ressourcen, Motivation und Anpassungsprozesse.
- Citation du texte
- Vicky Sorge (Auteur), 2011, Familien in Migrationssituationen und die Bildungsbenachteiligung ihrer Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280173