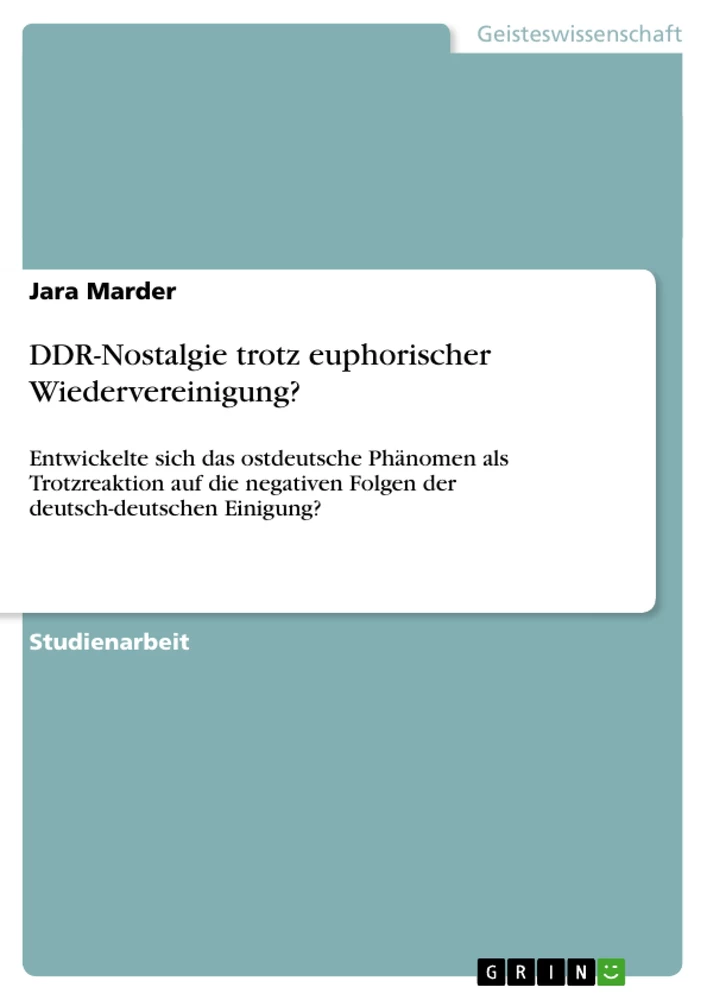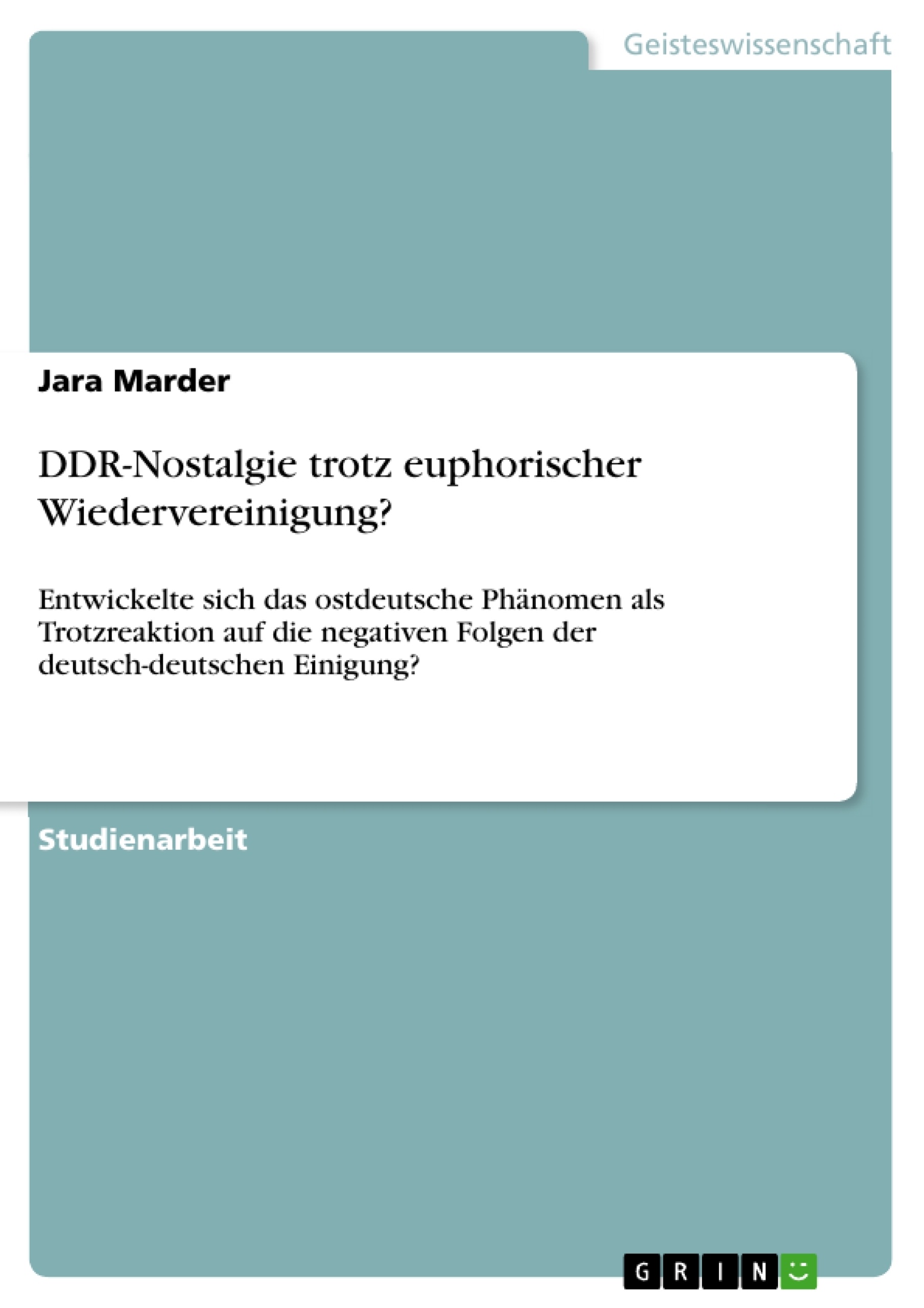Ein westdeutscher Beobachter beschrieb die begeisterten DDR-Bürger am Abend des Mauerfalls in Berlin mit diesen Worten: „Ihre Augen glänzten, manche brachten es fertig, zeitgleich zu lachen und zu weinen. “. Rund zwanzig Jahre später erklärt ein offensichtlich enttäuschter ostdeutscher Herr in einem kritischen Brief an den Politikwissenschaftler Klaus Schroeder, Autor einiger Arbeiten über das vereinte Deutschland nach der Wende, dass er rückblickend „[...] mit dem Mauerfall aus dem Paradies vertrieben [...] “ worden sei. Natürlich handelt es sich hier um zwei subjektive Eindrücke, die die Diskrepanz in der Beurteilung der deutsch-deutschen Einheit im zeitlichen Verlauf dennoch hervorragend zum Ausdruck bringen.Wie der Titel dieser Arbeit bereits vermuten lässt, werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob nostalgische Empfindungen als Trotzreaktion derjenigen DDR-Bürger zu werten sind, deren Hoffnungen sich in den Jahren nach 1989-90 nicht erfüllten. Der salopp anmutende Begriff der Trotzreaktion ist dabei an eine Darstellung der Soziologin und DDR-Nostalgie-Forscherin Katja Neller angelehnt, die die sogenannte „Trotzhypothese “ als ein mögliches Deutungsmuster für ostdeutsche Nostalgie nennt. Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um eine in der Forschung vertretene Meinung, sondern auch um ein westdeutsches Vorurteil gegenüber nostalgischer Empfindungen, das immer wieder gerne medial wirksam aufgebauscht und vermarktet wird. Aus den eben genannten Gründen möchte ich mich in den folgenden Seiten dieser These widmen, wozu es zunächst notwendig ist, den DDR-Nostalgie-Begriff an sich zu klären, um dann einen Blick auf die sich daraus ergebenden Ausprägungen zu werfen. Von grundlegender Bedeutung für die kritische Auseinandersetzung mit meiner These ist die Darlegung des wirtschaftlichen und sozialen Einigungsprozesses nach der euphorischen Wiedervereinigung in den 1990er-Jahren, da die Unzufriedenheit darüber oftmals als Grund für die vermeintliche Trotzreaktion gewertet wird. Letztlich werde ich mich ausführlich mit dieser Hypothese auseinandersetzen und im Anschluss einige andere Erklärungsansätze zum Entstehen der DDR-Nostalgie hinzufügen, um der eben vorgestellten Behauptung auf den Grund zu gehen und letztlich eine Beurteilung zu verfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen der DDR-Nostalgie
- 2.1 Definitionsansätze
- 2.2 Ausprägungen
- 3. Der Vereinigungsprozess: Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, ob nostalgische Empfindungen gegenüber der DDR als Trotzreaktion ehemaliger DDR-Bürger zu werten sind, deren Hoffnungen nach der Wiedervereinigung nicht erfüllt wurden. Der Fokus liegt dabei auf der ostdeutschen Perspektive und der kritischen Auseinandersetzung mit der „Trotzhypothese“. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Ausprägungen der DDR-Nostalgie und setzt diese in den Kontext des wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungsprozesses.
- Definition und Ausprägungen der DDR-Nostalgie
- Die „Trotzhypothese“ als Erklärungsansatz für DDR-Nostalgie
- Der wirtschaftliche und soziale Vereinigungsprozess der 1990er Jahre
- Analyse der Auswirkungen der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf die ostdeutsche Bevölkerung
- Alternative Erklärungsansätze für DDR-Nostalgie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert zwei gegensätzliche Perspektiven auf den Mauerfall und die deutsche Einheit – Euphorie im Westen und Enttäuschung im Osten. Diese Diskrepanz bildet die Grundlage der Arbeit, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die DDR-Nostalgie als Trotzreaktion auf unerfüllte Hoffnungen interpretiert werden kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die ostdeutsche Sichtweise und untersucht die „Trotzhypothese“ als ein mögliches Deutungsmuster, wobei sie auch auf die mediale Vermarktung dieses Vorurteils eingeht. Die Einleitung kündigt die Klärung des Begriffs DDR-Nostalgie und die Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und sozialen Aspekten des Einigungsprozesses an.
2. Das Phänomen der DDR-Nostalgie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Ausprägungen von DDR-Nostalgie. Es wird zwischen Total- und Partialnostalgie unterschieden, wobei der Fokus auf der letzteren liegt, da sie als gesellschaftliches Phänomen relevant ist. Das Kapitel diskutiert verschiedene Definitionsansätze und stützt sich hauptsächlich auf Katja Nellers Definition von DDR-Nostalgie als positive Orientierung gegenüber der ehemaligen DDR, die einen rationalen Vergleich mit der BRD und eine emotionale Idealisierung beinhaltet. Die vielfältigen Ausprägungen der DDR-Nostalgie werden anhand von Beispielen wie dem Verkauf von DDR-Produkten, Fernsehsendungen und Ostalgie-Partys illustriert, wobei die Entwicklung von der anfänglichen Entsorgung von DDR-Gegenständen bis hin zur heutigen Kommerzialisierung der Ostalgie nachgezeichnet wird.
3. Der Vereinigungsprozess: Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der 1990er Jahre im Kontext der Wiedervereinigung. Die Währungsunion, die mit der Einführung der D-Mark einherging, wird als riskantes Unterfangen dargestellt, das zu einem Schock für die ostdeutsche Bevölkerung führte, da Subventionen wegfielen und die Preise stiegen. Der 1:1 Umtauschkurs, obwohl zugunsten der Ostdeutschen entschieden, stellte eine große wirtschaftliche Belastung für Westdeutschland dar. Das Kapitel beschreibt außerdem die Rolle der Treuhandanstalt bei der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft und die Herausforderungen bei der Sanierung der maroden Infrastruktur und des Wohnungsbestands. Die finanziellen Belastungen für die vereinte Republik werden ebenfalls hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: DDR-Nostalgie als Trotzreaktion?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die These, ob nostalgische Gefühle gegenüber der DDR als Trotzreaktion ehemaliger DDR-Bürger auf unerfüllte Hoffnungen nach der Wiedervereinigung interpretiert werden können. Der Fokus liegt dabei auf der ostdeutschen Perspektive und einer kritischen Auseinandersetzung mit der „Trotzhypothese“.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Ausprägungen der DDR-Nostalgie, die „Trotzhypothese“ als Erklärungsansatz, den wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungsprozess der 1990er Jahre, die Auswirkungen der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf die ostdeutsche Bevölkerung und alternative Erklärungsansätze für DDR-Nostalgie.
Wie wird DDR-Nostalgie definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen Total- und Partialnostalgie, wobei der Fokus auf der Partialnostalgie liegt. Sie stützt sich auf Katja Nellers Definition von DDR-Nostalgie als positive Orientierung gegenüber der ehemaligen DDR, die einen rationalen Vergleich mit der BRD und eine emotionale Idealisierung beinhaltet.
Welche Ausprägungen der DDR-Nostalgie werden beschrieben?
Die Arbeit illustriert die vielfältigen Ausprägungen der DDR-Nostalgie anhand von Beispielen wie dem Verkauf von DDR-Produkten, Fernsehsendungen und Ostalgie-Partys. Sie verfolgt die Entwicklung von der anfänglichen Entsorgung von DDR-Gegenständen bis hin zur heutigen Kommerzialisierung der Ostalgie.
Welche Rolle spielt der Vereinigungsprozess?
Das Kapitel zum Vereinigungsprozess analysiert die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen der 1990er Jahre. Besonders die Währungsunion mit der Einführung der D-Mark wird als riskantes Unterfangen dargestellt, das zu einem Schock für die ostdeutsche Bevölkerung führte. Die Rolle der Treuhandanstalt und die Herausforderungen bei der Sanierung der Infrastruktur und des Wohnungsbestands werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die „Trotzhypothese“ die DDR-Nostalgie ausreichend erklärt. Sie analysiert die verschiedenen Ausprägungen der Nostalgie im Kontext des wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungsprozesses und präsentiert alternative Erklärungsansätze. Die genaue Schlussfolgerung wird im Text detailliert dargelegt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung, Das Phänomen der DDR-Nostalgie und Der Vereinigungsprozess: Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Die Einleitung stellt gegensätzliche Perspektiven auf den Mauerfall und die deutsche Einheit dar und führt in die Thematik ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den Ausprägungen der DDR-Nostalgie. Das dritte Kapitel analysiert den wirtschaftlichen und sozialen Vereinigungsprozess.
- Quote paper
- Jara Marder (Author), 2013, DDR-Nostalgie trotz euphorischer Wiedervereinigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280275