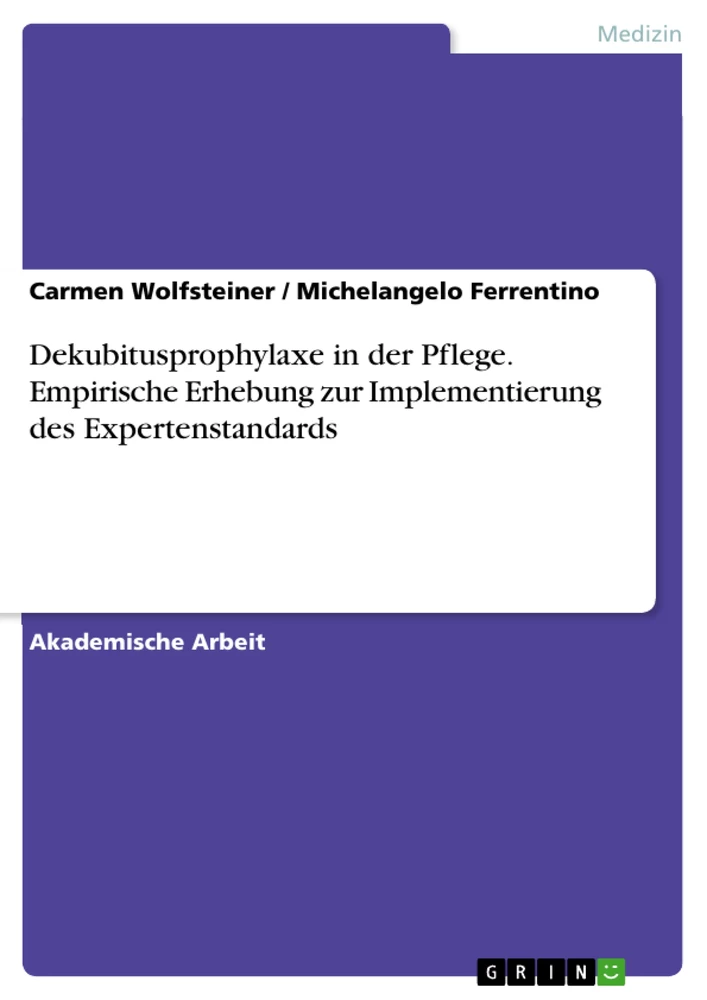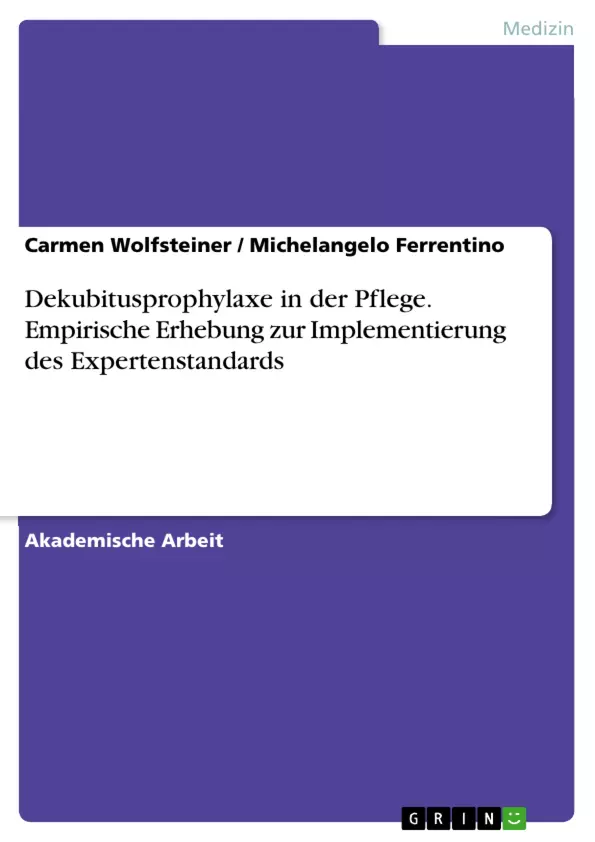Diese Arbeit stellt die Ergebnisse einer explorativen Erhebung dar. Dabei wurde mittels teilstandardisierter Fragebögen eine Erhebung unter insgesamt 20 Kliniken unterschiedlicher Struktur, Trägerschaft und regionaler Ausprägung durchgeführt. Dabei wird in dieser Arbeit zunächst auf das Forschungsproblem und das methodische Vorgehen eingegangen. Es folgt die Darlegung der Auswahl des Untersuchungsdesigns und der Methode der Datensammlung. Danach wird auf das Vorgehen bei Akquirierung der befragten Einrichtungen eingegangen und eine Beschreibung der Durchführung der Erhebung erörtert. Nach der wissenschaftlich begründeten Darlegung der Auswertung der Erhebung folgt die Ergebnisdarstellung. Dabei werden die befragten Einrichtungen in einer Matrixtabelle vorgestellt und nachfolgend die identifizierten Kategorien dargelegt. Eine Zusammenfassung der relevantesten Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung schließt diese Arbeit ab.
Aus dem Inhalt:
- Forschungsproblem und methodisches Vorgehen,
- Ergebnisse der schriftlichen Befragung,
- Zusammenfassung der relevantesten Ergebnisse
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2 Forschungsproblem und methodisches Vorgehen
- 2.1 Auswahl des Untersuchungsdesigns
- 2.2 Methode der Datensammlung
- 2.3 Akquirierung der befragten Einrichtungen und Durchführung der Erhebung
- 2.4 Auswertung der Erhebung
- 3 Ergebnisse der schriftlichen Befragung
- 3.1 Vorstellung der implementierenden Einrichtungen und Beschreibung der verantwortlichen Personen
- 3.2 Wissensmanagement
- 3.3 Anpassung und projekthafte Umsetzung des Expertenstandards
- 3.4 Durchführung des Audits
- 3.5 Reflexion der Implementierung
- 4 Zusammenfassung der relevantesten Ergebnisse
- 5 Literaturverzeichnis (inkl. weiterführender Literatur)
- 6 Anhang
- Fragebogen
- Gesprächsleitfaden
- Anschreiben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Implementierung des Expertenstandards „Dekubitusprophylaxe in der Pflege" in der pflegerischen Praxis. Ziel der empirischen Erhebung ist es, Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln und Erkenntnisse über den Implementierungsprozess zu gewinnen. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei der Einführung des Expertenstandards in verschiedenen Kliniken.
- Analyse der Implementierung des Expertenstandards „Dekubitusprophylaxe in der Pflege" in der Praxis
- Identifizierung von Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Implementierung
- Bewertung des Wissensmanagements und der Anpassung des Expertenstandards an die jeweilige Einrichtung
- Untersuchung der Durchführung von Audits und der Reflexion des Implementierungsprozesses
- Entwicklung von Empfehlungen für eine erfolgreiche Implementierung des Expertenstandards
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert das Forschungsproblem sowie das methodische Vorgehen. Kapitel 2 beschreibt das Untersuchungsdesign, die Methode der Datensammlung, die Akquirierung der befragten Einrichtungen und die Auswertung der Erhebung. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der schriftlichen Befragung, wobei die implementierenden Einrichtungen vorgestellt werden und die identifizierten Kategorien dargelegt werden. Die Zusammenfassung der relevantesten Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung schließt die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Dekubitusprophylaxe, Expertenstandard, Implementierung, Pflege, Kliniken, Wissensmanagement, Anpassung, Audit, Reflexion, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen, Empfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“?
Es handelt sich um einen fachlichen Standard zur Vermeidung von Druckgeschwüren (Dekubitus) in der pflegerischen Versorgung, dessen Implementierung in dieser Arbeit untersucht wird.
Wie wurde die empirische Erhebung durchgeführt?
Mittels teilstandardisierter Fragebögen wurden 20 Kliniken unterschiedlicher Struktur, Trägerschaft und regionaler Ausprägung befragt.
Welche Rolle spielt das Wissensmanagement bei der Implementierung?
Wissensmanagement ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Pflegepersonal über die notwendigen Kenntnisse zur Anwendung des Standards verfügt.
Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Umsetzung des Standards?
Zu den Erfolgsfaktoren gehören eine klare projekthafte Umsetzung, die Anpassung des Standards an die jeweilige Einrichtung sowie regelmäßige Audits zur Reflexion.
Welche Herausforderungen identifiziert die Studie?
Die Arbeit analysiert Schwierigkeiten bei der Anpassung des Standards an den klinischen Alltag und die Motivation der verantwortlichen Personen während des Implementierungsprozesses.
- Quote paper
- Carmen Wolfsteiner (Author), Michelangelo Ferrentino (Author), 2006, Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Empirische Erhebung zur Implementierung des Expertenstandards, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280452