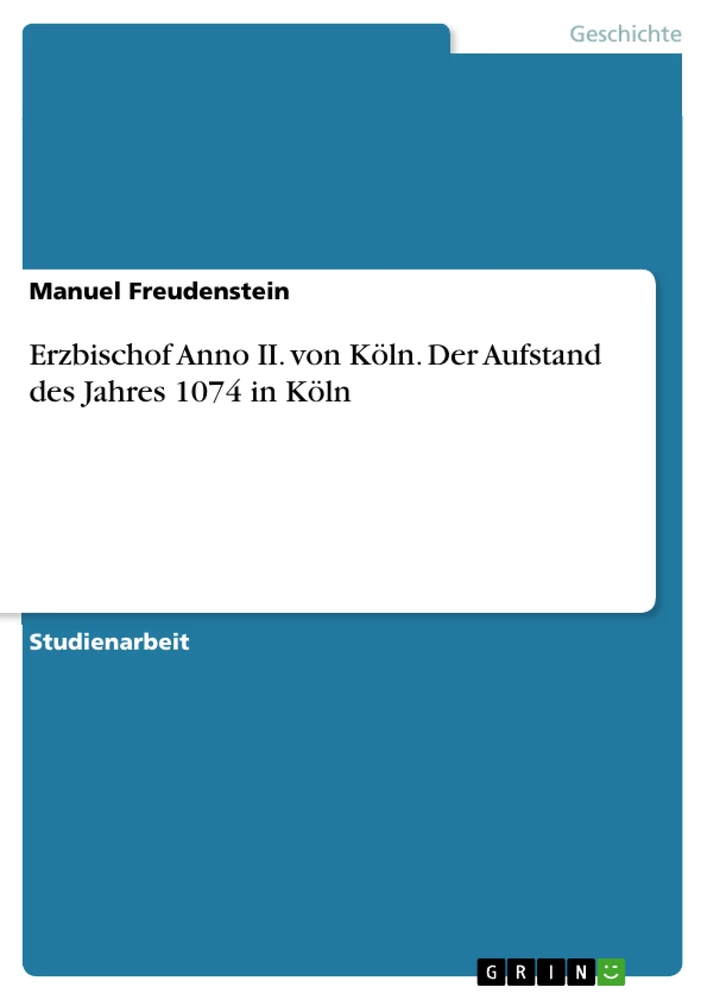Die Lebens- und Wirkungszeit des Erzbischofs Anno II. von Köln fällt in das 11. Jahrhundert. Es ist ein Jahrhundert, welches vor allem vom so genannten Investiturstreit geprägt wird. Dem Streit zwischen den weltlichen Mächten, repräsentiert durch den König und späteren Kaiser Heinrich IV. (1056-1105) von der Salierdynastie, und den geistlichen Mächten, bei denen Papst Gregor VII. (1073-1085) an vorderster Stelle stand.
Der Streit zwischen König und Papst entfachte, weil beide Seiten ihre Macht und die Macht ihrer „Institution“ über die des Anderen stellen wollten und sich beide von Gott dafür berufen fühlten.
Papst Gregor VII. handelte ganz im Sinne der Kirchenreform. Die Ziele dieser Reform beinhalteten die Abschaffung von Simonie, Nikolaitismus und der Laieninvestitur, sowie die eindeutige Vormachtstellung der Kirche gegenüber den weltlichen Mächten. Diese Forderungen waren nicht ohne Grund Bestandteil der Kirchenreform, da der Streit zwischen König und Papst auch deswegen eskalierte, weil Heinrich IV. als Laie in dem Fall ohne Kenntnis des Papstes einen neuen Mailänder Bischof einsetzte. Daraufhin belegte Papst Gregor VII. Heinrich IV. mit dem Kirchenbann und mit ihm alle seine Untertanen.
Höhepunkt dieses weltbewegenden Disputs war der berühmte Bußgang von Canossa im Winter 1076/1077. In diesem Winter überquerte Heinrich IV. gezwungenermaßen die Alpen und zog nach Italien, um beim Papst Buße zu tun, damit dieser ihn vom Kirchenbann lossagt, denn sonst würde Heinrich aufgrund eines Beschlusses der Fürsten seine Macht verlieren.
Drei Tage und Nächte, so berichtet der Chronist Lampert von Hersfeld, harrte Heinrich IV. im Büßergewand vor den Toren Canossas aus, bis der Papst ihn empfing und ihn vom Bann lossprach, sodass er sein königliches Amt weiterhin ausführen konnte. Die Vorgänge lösten eine Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen in den akademischen Kreisen aus. Viele Geschichtswissenschaftler interpretieren den Bußgang als Schwäche, Andere sehen darin einen geschickten Schachzug von Heinrich IV., um seine Machtbefugnisse zu behalten.
Neben dem Investiturstreit drückte der Krieg ebenfalls zwischen dem salischen König Heinrich IV. und den aufständischen Sachsen diesem Jahrhundert seinen Stempel auf.
Geschichtswissenschaftlich gesehen ist das 11. Jahrhundert eine Art Übergangsphase vom Frühmittelalter zum Spätmittelalter Europas.
Anno wurde vermutlich im Jahre 1010 in einem kleinen Ort in Schwaben geboren und starb 1075 in Köln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Einführung in das Thema
- Herkunft, Familie und Werdegang
- Anno als Erzbischof von Köln – Anfänge: 1056-1062
- Anno als Erzbischof von Köln - Ende: 1062- 1074
- Die Annalen des Lampert von Hersfeld
- Der Aufstand von Köln im Jahre 1074
- Annos Tod im Jahre 1075 und sein Nachruf
- Schluss - Fazit
- Quellen und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken des Erzbischofs Anno II. von Köln im 11. Jahrhundert, einem Jahrhundert, das vom Investiturstreit geprägt war. Die Arbeit analysiert Annos Aufstieg vom unbedeutenden schwäbischen Kleinadel zum Oberhaupt des Erzbistums Köln und beleuchtet seine Rolle im Investiturstreit sowie seine Beziehungen zum salischen Königshaus. Darüber hinaus wird der Kölner Aufstand von 1074, bei dem Anno aus der Stadt vertrieben werden sollte, im Detail untersucht.
- Annos Aufstieg vom Kleinadel zum Erzbischof von Köln
- Annos Rolle im Investiturstreit
- Annos Beziehungen zum salischen Königshaus
- Der Kölner Aufstand von 1074
- Annos Leistungen und Kontroversen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet den historischen Kontext des 11. Jahrhunderts, das vom Investiturstreit und dem Krieg zwischen dem salischen König und den aufständischen Sachsen geprägt war. Die Arbeit stellt die Person Annos vor und erläutert die Forschungsfrage, wie ein Mitglied einer unbedeutenden Adelsfamilie zum Erzbischof von Köln werden konnte.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Annos Herkunft, Familie und Werdegang. Es wird seine Geburt in Altsteußlingen, seine Familie und seine Ausbildung beschrieben. Annos außergewöhnliche Klugheit und sein Fleiß führten ihn an den Hof des salischen Kaisers Heinrich III., wo er eine bedeutende Rolle spielte.
Die Kapitel drei und vier befassen sich mit Annos Zeit als Erzbischof von Köln. Es werden seine Anfänge und seine späteren Jahre als Erzbischof beleuchtet, wobei besondere Ereignisse und Entscheidungen hervorgehoben werden.
Das fünfte Kapitel behandelt die Annalen des Lampert von Hersfeld, eine wichtige Quelle für die Erforschung des Lebens Annos.
Das sechste Kapitel analysiert den Kölner Aufstand von 1074, der Annos Herrschaft in Köln bedrohte. Es werden die Ursachen und die Folgen des Aufstands untersucht.
Das siebte Kapitel befasst sich mit Annos Tod im Jahre 1075 und seinem Nachruf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Erzbischof Anno II. von Köln, Investiturstreit, Salier, Kirchenreform, Kölner Aufstand von 1074, Vita Annonis Minor, Lampert von Hersfeld, Altsteußlingen, Heinrich III., Heinrich IV., Gregor VII., mittelalterliche Geschichte, Adel, Kirche, Politik.
- Citation du texte
- Manuel Freudenstein (Auteur), 2013, Erzbischof Anno II. von Köln. Der Aufstand des Jahres 1074 in Köln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280479