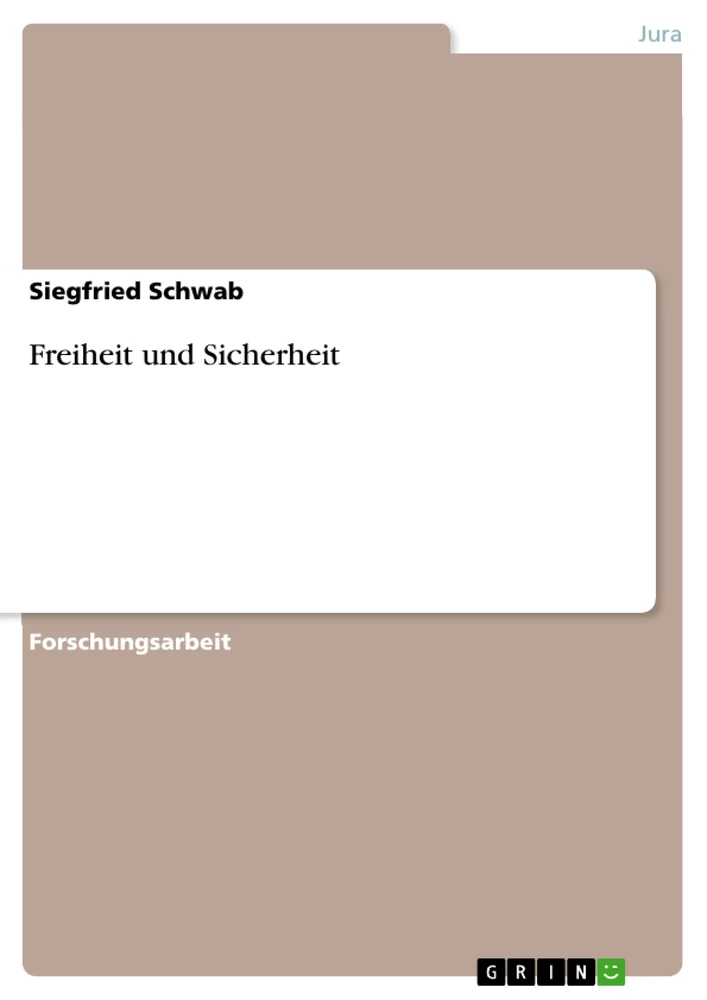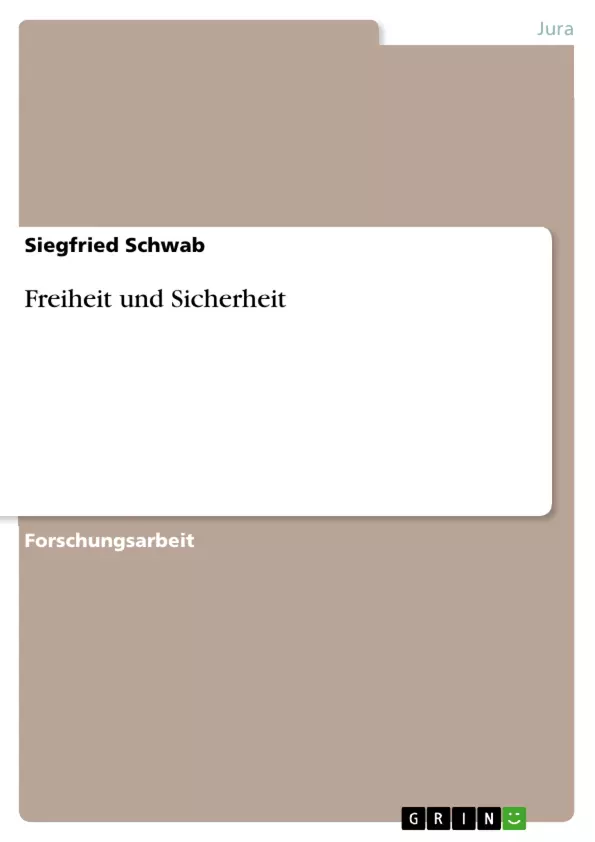Die Freiheit ist kein Geschenk, von dem man billig leben kann, sondern Chance und Verantwortung. Freiheit ist Mitverantwortung (Richard von Weizsäcker). Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst und durch Nichtgebrauch dahinschwindet (Richard von Weizsäcker). Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss, wie andere Menschen (Astrid Lindgren). In einer rechtlich gefestigten, staatlich organisierten und strukturierten Gemeinschaft ist die Verfassung der Ursprung und das Maß allen positiven Rechts. In dem Begriff der Verfassung ist der tatsächliche Zustand eines Gemeinwesens angelegt, aber auch das Gesetz, das politische Herrschaft begründet, rechtfertigt und begrenzt. Die Herrschaft des Rechts greift selbst im Grenzfall. Die Ermächtigung sei mit dem Recht auf Leben in Verbindung mit der Menschenwürde unvereinbar, soweit durch den Abschuss auch an der Tat nicht beteiligte Menschen an Bord betroffen würden. Mit dem Rückgriff auf die Menschenwürde erhebt das BVerfG den denkbar schärfsten Vorwurf, den die Verfassung hergibt. Es fordert die Soldaten geradezu auf, im Falle eines Abschussbefehls den Gehorsam zu verweigern, weil nach dem Soldatengesetz Ungehorsam dann nicht vorliegt, wenn der Befahl die Menschenwürde verletzt, Isensee, Not kennt Gebot, FAZ vom 21. Januar 2008, S. 10
Auf den ersten Blick scheint die juristische Rechnung des BVerfG aufzugehen, wenn es im Widerstreit zwischen den öffentlichen Sicherheitsinteressen und dem Lebensschutz der Geiseln sich für letzteren entscheidet. Doch es bleibt ein unaufgelöster Rest, den das Gericht vernachlässigt. Sicherheit zu gewährleisten ist Verfassungsvoraussetzung / und Verfassungsziel. / Freiheit grundrechtlich gesichert ist Verfassungsinhalt. Der Zweck und das Ziel Sicherheit zu gewährleisten richtet sich gegen Bedrohungen von außen und innen. Freiheit und damit letztlich aber auch Sicherheit soll inhaltlich verwirklicht werden. Im Ausgangspunkt unterscheiden sich beide Ziele: Freiheit verursacht und steigert Risiken, während Sicherheitsbemühungen Gefahren abwehren sollen. Freiheitlicher Grundrechtsschutz bedeutet rechtliche und faktische Handlungsalternativen einzelfallbezogen und grundrechtskonkretisierend offen zu halten. Der einzelne hat die Wahl zwischen risikovermeidenden und risikofreudigen Handlungsalternativen. Risiken sind zwar nicht berechen- und steuerbar, aber mit einem unbekannten Restrisiko prognostizierbar.
Inhaltsverzeichnis
- Freiheit und Sicherheit
- Grundbedürfnisse?
- Keine Freiheit ohne Recht.
- Keine situationsgerechte Rechtsvorschriften ohne wirksamen Rechtsschutz und Rechtsgüterschutz.
- Legitimität erwächst aus der Überzeugung, dass sich staatliches Handeln innerhalb eines rechtlichen Rahmens abspielt und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens muss dafür eine rechtlich gesicherte Grundlage bestehen - handeln darf also nur eine politische Institution, die ein Recht für ihr Vorgehen hat. Zweitens darf staatliches Handeln keine gesetzlichen oder ethischen Normen verletzen. Letztendlich ist Legitimität in einer allgemeinen Vorstellung von Rechtmäßigkeit verwurzelt, Tucker/Hendrickson, Vom Nutzen des Völkerrechts, Rheinischer Merkur, Nr. 45/2004, S. 6.
- Es müssen sich, wenn Demokratie gelingen soll, immer die Überzeugung, dass Demokratie eine Wahrheit sei, unbedingt verpflichtend, auf der einen Seite und das Prinzip Offenheit, das jeder Tendenz, Antworten für definitiv zu erklären, entgegensteht, auf der anderen so stark und präsent gegenüberstehen, dass sie sich die Waage alten können. Das Entweder - Oder wird nicht im Raum der Theorie aufgelöst, sondern im Raum der Politik ins Gleichgewicht gebracht. Die Autonomie des Politischen ist eine Bedingung der Möglichkeit von Demokratie in ihrer modernen Ausprägung, Peter Graf Kielmannsegg, Die Grammatik der Freiheit, 2013, S. 33.
- In der heutigen westlichen Welt herrscht mancherorts die Vorstellung, wahre Freiheit sei ohne Grenzen. Dies ist ein schlimmer Irrtum, dem Ihr nicht verfallen dürft, denn letzten Endes würde dies wieder zum autoritären Staat führen. Meine Freiheit muss dort ihre Grenzen finden, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wenn ein jeder tut, was ihm gefällt, dann führt das zum Chaos und 1,Freiheit kommt nicht über den Fernseher und nicht per Kreditkarte - ihr Besitz will täglich verdient sein (Roman Herzog). „Es kann doch nicht sein, dass eine säkularisierte Welt notwendigerweise bar aller ethischen Grundsätze ist." (Marion Gräfin Dönhoff)4/5
- Zivilisiert den Kapitalismus, Marion Dönhoff, 1997.
- Wir müssen in unserem Bewusstsein dem Grundrecht auf Freiheit die moralische Pflicht zur Verantwortung an die Seite stellen. Hans Jonas hat gesagt: "Letztlich setzt bei alledem meine Hoffnung auf die menschliche Vernunft... An ihr zu verzweifeln wäre unverantwortlich und ein Verrat an uns selbst". Eine entfesselte Freiheit führt zu Brutalität und Kriminalität. Jede Gesellschaft braucht Bindungen. Ohne Regeln, ohne Tradition, ohne Konsens über Verhaltensnormen kein Gemeinwesen. Ohne Tugenden werden wir nicht im Frieden miteinander leben, Helmut Schmidt, Auf der Suche nach einer öffentlichen Moral, 1998, S. 197f. Kompromissfähigkeit und Toleranz sind für den inneren Frieden unserer Gesellschaft unverzichtbare Tugenden. Eine der wichtigsten unter den bürgerlichen Tugenden ist die Solidarität; sie stellt für viele in unserer Gesellschaft einen wesentlichen Grundwert dar, Helmut Schmidt, a.a.O., S. 204. Das Wort Solidarität ist in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die von Bismarck bekämpfte Arbeiterbewegung ins öffentliche Bewusstsein getragen worden. Es ist auch für die Zukunft notwendig, dass wir uns und unsere Nachfahren zur Tugend der Solidarität erziehen. Erfahrungen, Werte, Tugenden werden tradiert durch Miterleben, durch Vorbilder und Beispiele und durch Selbsttun. Wir brauchen eine öffentliche Moral: Das bedeutet: Unser Land als Ganzes muss sich der Notwendigkeit von Veränderungen bewusst werden. Wenn wir die Würde, die Freiheit und die übrigen Grundrechte von achtzig Millionen Bürgern dauerhaft bewahren wollen, dann bedürfen diese achtzig Millionen einer gemeinsamen Ordnung. Eine solche Ordnung kann nicht allein durch Verfassung und Gesetze hergestellt werden, sondern bedarf ebenso des verantwortlichen Handelns der einzelnen. Prinzipiell sind Freiheit und Ordnung nur dann im Gleichgewicht zu halten, wenn wir dieses Gleichgewicht bewusst anstreben und durch unsere Gesetze stützen, Helmut Schmidt, S. 187. Ohne Pflichten können unsere Rechte auf die Dauer nicht gesichert werden, Helmut Schmidt, S. 218.
- Wägt man den unüberschaubaren Sicherheitsgewinn gegen ihre bedenklichen Auswirkungen auf die individuelle Freiheit und die freiheitliche Ordnung der Gesellschaft ab, muss die anlasslose Massenüberwachung als problematisch eingestuft werden, vgl. Gusy, Architektur und Rolle des Nachrichtendienstes in Deutschland, APuZ 18-19/2014, S. 6 - unter den konkreten Bedingungen einer glaubhaften Bedrohung kann sich das Verhältnis zwischen Freiheitseingriff und Sicherheitsgewinn zugunsten von Überwachungsmaßnahmen verschieben 2,Verfassungsvoraussetzung 12/13 und Verfassungsziel. 14/15 Freiheit grundrechtlich gesichert ist Verfassungsinhalt. Der Zweck und das Ziel Sicherheit zu gewährleisten richtet sich gegen
- In einer rechtlich gefestigten, staatlich organisierten und strukturierten Gemeinschaft ist die Verfassung der Ursprung und das Maß allen positiven Rechts. In dem Begriff der Verfassung ist der tatsächliche Zustand eines Gemeinwesens angelegt, aber auch das Gesetz, das politische Herrschaft begründet, rechtfertigt und begrenzt, (frei nach Kirchhof, Paul Kirchhof, Geltungsgrund und Gestaltungskraft des Gesetzes, S. 145, in Koch/Rossi, Gerechtigkeitsfragen in Gesellschaft und Wirtschaft, 2013. Erst das geschriebene Verfassungsrecht bietet eine sichtbare, verallgemeinerungsfähige, voraussehbare Erkenntnisquelle und Verhaltensregel. Die Rechtswirklichkeit stellt die Fragen an das Recht, das Rechtsgesetz gibt die rechtsverbindlichen, realitätsbezogenen Antworten. Das Gesetz begründet die äußere Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, die der natürlichen Freiheit des Menschen verbindliche Grenzen setzt. Das Gesetzt ist dennoch einsichtig, gewinnt Vertrauen und Gestaltungskraft, wenn es dem Gesetzesadressaten hinreichend Freiheit belässt, ihn nicht durch Regelungen erdrückt und dadurch Widerstand provoziert (vgl. Locke, Two treaties of government, 1689). Freiheit ist aber nicht pauschal das Recht zur Beliebigkeit in allen Lebensbereichen, sondern sozial verantwortliche Freiheit und Unabhängigkeit von der nötigenden Willkür anderer freier Menschen. Freiheit heißt, sich unterscheiden zu dürfen (Kirchhof, a.a.O. S. 154). Recht hat stets eine Herkunft und eine Zukunft. Es entsteht aus guter Gewohnheit, erprobten Werten, bewährten Institutionen, gesicherter politischer Erfahrung, aus einem in menschlichen Gemeinschaften geübten Brauch, der die Anschauungen, das Denken und die Verhaltensweisen der Menschen in gemeinsamen Sitten- und Sinnesarten lenkt. In der Verbindlichkeitsfolge handelt das Gesetz von der Zukunft. Das geschriebene Recht sucht sich aus Ideal und Ideen der Gerechtigkeit sittlich-moralisch zu rechtfertigen. Die positiven Normen geben der Gerechtigkeit die Erkennbarkeit und Eindeutigkeit von Tatbestand und Rechtsfolge. Die Allgemeinheit der jedermann bindenden, langfristig verbindlichen Gleichheit in der Freiheit wahrenden Regel sichert die stete Verlässlichkeit und Berechenbarkeit eines kontinuitätswahrenden, nachhaltigen Rechts. Das Recht kann normative Grund- und Rahmenbedingungen vorgeben und gestalten, um die Fairness des Verhandlungsprozesses, die Ausgewogenheit der Ergebnisse sicherzustellen, es darf aber den notwendigen Kommunikationsprozessen nicht die Offenheit und Flexibilität rauben
- Recht wurzelt in der Wirklichkeit des Menschen, in der historisch gewachsenen und bewährten Kultur. Die Verfassung regelt die Prinzipien der Rechtsgemeinschaft. Recht ist Ausdruck der in der Rechtsgemeinschaft gewachsenen Kultur, nimmt das Wissen der Gegenwart auf, nutzt die hergebrachten und bewährten Institutionen, stützt sich auf anerkannte Werte und beantwortet die modernen Aufgaben an das Recht.
- Der Mensch muss das Recht verstehen können (Paul Kirchhof). Recht ist eine Verkörperung menschlicher Erfahrungen und Gebräuche, die sich vor einem Wertehintergrund als praktikable Regelungsmodelle des Zusammenlebens erwiesen haben. Dass der moderne Verfassungsstaat die "Produktion" von Rechtsnormen an demokratische Institutionen delegiert, steht dieser Annahme nicht entgegen, Krüper, Grundlagen des Rechts, 2011, S. 263.
- „Eine Gesellschaft braucht aber Normen und Spielregeln, ohne einen ethischen Minimalkonsens kann sie keinen Bestand haben.” Marion Dönhoff, Vorwort zu „Macht und Moral", 2000.
- Recht ist ein Medium besonders sensibler Art. Form und Gehalt, Rechtswerte und Rechtsverfahren, Rechtssicherheit und materielle Gerechtigkeit, Beständigkeit und Wandelbarkeit müssen in ihm immer wieder zum Ausgleich gebracht werden. Rechtsanwendung und Rechtspolitik teilen sich diese Aufgabe. Der Rechtsstaat ist ein realistischer, ein nüchterner Staat. Die Offenheit, die in dem Medium Recht angelegt ist, wirkt in der Sache und in der Zeit, Schmidt-Aẞmann, in Leitgedanken des Rechts, Festschrift für Paul Kirchhof, 2013, Rechtsstaat, § 22, RN 3.
- Was die Legitimationsfunktion der Verfassung angeht, so hält sich die Volkssouveränität. Herrschaft muss auf dem Konsens der Herrschaftsunterworfenen beruhen. Die Verfassung hat zur Aufgabe, den Staat zu organisieren, also demokratische, allenfalls bundesstaatliche Strukturen sowie die darin handelnden staatlichen Organe zu kreieren (Organisationsfunktion), politische Macht der Staatsorgane zu begründen und in einem gewaltenteiligen System zu begrenzen.
(Legitimationsfunktion), den politischen Grundkonsens zu verstetigen um dem politischen Alltagsstreit zu entziehen(Leitfunktion. Die Funktionen der Verfassung haben sich bei der europäischen
- Bedrohungen von außen und innen. Freiheit 16 und damit letztlich aber auch Sicherheit soll inhaltlich verwirklicht werden. Im Ausgangspunkt unterscheiden sich beide Ziele: Freiheit¹7
- Der Verfassungsstaat baut auf das Gesetz und die Gesetzesanwendung als verlässliche Grundlage des individuellen Rechtsvertrauens. Im freiheitlichen Verfassungsstaat geht es um die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit staatlichen Handelns als notwendige Voraussetzung für menschliche Planungen und Entscheidungen. Die rechtsstaatliche Ordnung gewährleistet Grundrechte und Schutz vor willkürlichem staatlichem Handeln. Das Recht muss offen auf gewandelte gesellschaftliche Verhältnisse reagieren (können) und neue Regelungskonzepte entwerfen. Stetige Verlässlichkeit und Wandlungsfähigkeit des Rechts sind im Begriff der Gerechtigkeit angelegt. Gerechtigkeit ist ohne ständige Bemühungen um die Verwirklichung einer rechtsstaatlichen Ordnung, die sich am gemeinsamen Wohl aller orientiert nicht denkbar, Kirchhof, DStJG 27.
- Die Verfassung schreibt nicht ein gleichbleibendes Fundamentalziel des Staates vor, ein Gemeinwohl, fest, sondern überlässt das verantwortungsvolle Suchen und Finden des Gemeinwohls der Allgemeinheit der Freiheitsberechtigten und dem Verfahren staatlicher Entscheidungsfindung. Die Verfassung errichtet eine verlässliche Ordnung nicht der vorgelebten Wahrheit. Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland stellt eine nachhaltige Ordnung der Freiheit her, die zwischen dem Anspruch jedes Menschen zur Selbstbestimmung und seiner Zugehörigkeit zu einer Friedens- und Ordnungsgemeinschaft ausgleicht, vgl. Kirchhof, Das Grundgesetz ein oft verkannter Glücksfall, DVBI 2009, 541.
- Das Grundgesetz geht als liberale Verfassung eines demokratischen Wohlfahrtsstaates von der Idee der Freiheit und Gleichheit aller Bürgerinnen aus, auf deren Grundlage die soziale Integration demokratisch gestaltet wird. Der demografische Wandel fordert die historisch gewachsene, wohlfahrtsstaatliche Verfassungsstruktur heraus. Er führt zu sozialen Verwerfungen, die die gesellschaftliche Kohäsion der Bundesrepublik gefährden, Kersten/Neu/Vogel, Demografie und Demokratie, Zur Politisierung des Wohlfahrtsstaates, 2012, S. 17. Die demografisch verursachten Veränderungen dürfen nicht die Freiheit und Gleichheit aller Bürgerinnen aushöhlen, die die demokratische Legitimationsgrundlage des Wohlfahrtsstaates bilden. Altbundespräsident Roman Herzog hat den Wandel der politische Herrschaft aufgrund der demografischen Entwicklung auf den Begriff der "Rentner-Republik" gebracht, Kersten/Neu/Vogel, Demografie und Demokratie, Zur Politisierung des Wohlfahrtsstaates, S. 20. Gedankliche Ansätze - ein Wahlrecht von Geburt an oder alternativ ein Familienwahlrecht - darüber wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Ein Wahlrecht von Geburt an, wahrgenommen von den Eltern oder einem Elternteil ist mit den Grundsätzen der unmittelbaren, freien und gleichen sowie geheimen Wahl an nicht zu vereinbaren. Die "treuhänderische Zwischeninstanz verletzt den Grundsatz der freien Wahl, da nicht die Kinder und Jugendlichen selbst und unbeeinflusst über die Stimmabgabe entscheiden, sondern letztlich der/die Treuhänderin die Entscheidung trifft. Das "Wahlrecht von Geburt an" führt letztlich zu einer Stimmenhäufung bei den Eltern, die unkontrolliert und abschließend entscheiden, wie sie das Stimmrecht des/der Kind(er) ausüben. Das Wahlrecht von Geburt an ist letztlich ein "verkapptes Pluralwahlrecht", das gegen den Grundsatz der gleichen Wahl verstößt, der auch Bestandteil des Demokratieprinzips (der Volkssouveränität) ist. Das Grundproblem der Demokratie, die Gegenwartbezogenheit der Entscheidung durch die Stimmabgabe und die Erlebenswirklichkeit in der Zukunft ließe sich nicht lösen. Im Jetzt getroffene Entscheidungen wirken sich oft erst in der Enkelgeneration bemerkbar aus, vgl. Schwab, Verwaltungshandeln, frühzeitige Bürgerbeteiligung, Aarhus-Konvention, 2014.
- Die Menschen vermögen nicht der Verlockung von Wohlstand und Macht widerstehen. Die meisten begreifen nicht, dass zur wirklichen Freiheit Selbstbeschränkung gehört, denn die entfesselte Freiheit führt zwangsläufig zu deren Antithese, einem autoritären Staat. Wenn Pragmatismus in Opportunismus ausartet, heißt es an ethische Prinzipien erinnern, und wenn Träumereien als konkrete Rezepte empfohlen oder Interessen als Ideale ausgegeben werden, dann auf die Realität und das Machbare hinweisen. Man könnte auch so definieren: Wenn die Atmosphäre emotional aufgeheizt ist, dann dämpfen. Wenn dagegen die Leute zu resignieren drohen, dann Argumente finden, die sie inspirieren. Es gibt kein System, das einen befriedigenden Endzustand garantiert, Marion Gräfin Dönhoff, Was mir wichtig war - Herrschaft erträglich machen, S. 102.
- Freiheitsrechte im Spiegel der Freiheit hat der Staat ein Doppelgesicht: er ist Garant der Freiheit; er ist in der Lage, die Freiheit des Individuums effektiv zu schützen. Er hat aber auch die Machtfülle, die individuelle Freiheit zu unterdrücken. Ohne Staat gäbe es keine gleiche Freiheit für alle, sondern nur Freiheit für die Starken und Mächtigen, Murswiek, Freiheitsrechte, in Leitgedanken des Rechts, Festschrift für Paul Kirchhof, § 19 RN 2. Die Monopolisierung der legitimen
- verursacht und steigert Risiken, während Sicherheitsbemühungen Gefahren abwehren sollen. Freiheitlicher Grundrechtsschutz bedeutet rechtliche und faktische Handlungsalternativen einzelfallbezogen und grundrechtskonkretisierend offen zu halten. Der einzelne hat die Wahl zwischen risikovermeidenden und risikofreudigen Handlungsalternativen. Risiken 18 sind zwar nicht berechen- und steuerbar, aber mit einem unbekannten Restrisiko prognostizierbar. Grundrechtliche Freiheit 19/20/21 ist grundsätzlich geeignet, die Komplexität²² des gesellschaftlichen Lebens 23 zu steigern, die daraus entstehenden Risiken zu erhöhen, aber gleichzeitig die individuelle Sicherheit 24 zu mindern.25
- Gewaltanwendung ist zur Wahrung der Freiheit notwendig. Die Freiheitsrechte sind Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Das BVerfG hat aus ihnen auch eine Pflicht des Staates gegen Eingriffe Dritter hergeleitet, denen ein subjektiver Schutzanspruch entspricht, Murswiek, Freiheitsrechte, in Leitgedanken des Rechts, Festschrift für Paul Kirchhof, § 19 RN 10. Freiheitsrechte schützen die Freiheit aber nicht absolut. Zur Verwirklichung von Belangen des 'Gemeinwohls darf der Staat die individuellen Freiheiten einschränken. Er muss dann einschreiten und die Freiheiten einschränken, um die Freiheit des einen Rechtsinhabers mit der Freiheit anderer kompatibel zu machen, Murswiek, Freiheitsrechte, in Leitgedanken des Rechts, Festschrift für Paul Kirchhof, § 19 RN 15.
- Risiken haben keine abstrakte, objektiv-rationalistisch bestimmbare Existenz. Sie können weder durch mathematisch statistische Identifikationsverfahren, Kausalhypothesen noch durch Prognosemodelle bestimmt und begrenzt werden. Sie sind vielmehr das Ergebnis subjektiv-kultureller Wahrnehmung. Diese ist geprägt von der Erkenntnis, dass Risiken als wirklich mögliche Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts nicht durch ein Mehr an Wissen erschließbar und Gefahren verhindert werden können. Das Mehr an Wissen verschmilzt vielmehr Wissen und Nichtwissen im Begriff der Wahrscheinlichkeit zur Ungewissheit. Sie umfasst auch die Kontrollierbarkeit und Kompensierbarkeit von Unsicherheiten und latenten Gefahren.
- Freiheit bedeutet das Recht jedes Menschen seine eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer verlässlichen Rechtsordnung eigenverantwortlich zu bestimmen. Sie berechtigt ihn als Menschenrecht, auch das wirtschaftliche Geschehen selbst zu verantworten. Sie bietet die Chance auf Eigentümer-, Berufs- und Vereinigungsfreiheit, belastet den einzelnen aber gleichzeitig auch mit dem Risiko, Fehler zu machen.
- Die Schule ist das wirksamste Integrationsinstrument des Staates. Da jedoch Integration in der Familie beginnt, trägt die Schule die ganze Last und ist überfordert. Der Ausländer, der deutschen Boden betritt, genießt grundsätzlich die gleiche grundrechtliche Freiheit wie der Staatsangehörige. Kraft dieser Freiheit bestimmt ein jeder für sich, ob er sich in seine Privatheit zurückzieht oder am gesellschaftlichen Wettbewerb teilnimmt, wie er sein Familienleben gestaltet und seine Religion ausübt. Integration, grundrechtlich gesehen, ist zunächst einmal Sache des Einzelnen. Dem Staat fällt die subsidiäre Aufgabe u, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Freiheit für jedermann zu gewährleisten, die sozialen Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins zu sichern und mit seinen begrenzten Mitteln darauf hinzuwirken, dass die Gesellschaft nicht an ihren Gegensätzen zerbricht und ein gedeihliches Zusammenleben möglich bleibt. In der Ausübung seiner Schulhoheit erweist sich der Rechtsstaat als sittlicher Staat. Er bringt das allgemeine Ethos zur Geltung, das ein gedeihliches Zusammenleben in Verschiedenheit ermöglich. Ein Ethos, das Selbstbehauptung und Toleranz, Rücksichtnahme und Gemeinsinn verbindet, das die Fähigkeit gibt die eigne Freiheit verantwortlich auszuüben und die Freiheit des anderen zu ertragen, auch dann, wenn ihre Ausübung schmerzt, Isensee, Toleranz stiften, FAZ vom 27. Januar 2010. Der Gleichheit in der grundrechtlichen Freiheit korrespondiert die Verfassungserwartung, dass der Ausländer fähig und willens ist, diese Freiheit selbstverantwortlich zu gebrauchen, Isensee, Integration als Konzept, 54. Bitburger Gespräche, 2010.
- Ein freier Mensch ist jemand, der alles in allem so lebt, wie er es aus eigenem Antrieb und eigner Überlegung will. alles in allem: Er wird vieles so nehmen und manches so hinnehmen müssen, wie es nun einmal ist. Aus eigenem Antrieb: Er wird vor allem denjenigen seiner Leidenschaften folgen, an denen ihm vor allem liegt - mitsamt den Bindungen, die ihnen entspringen. As eigener Überlegung: Er
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in einer modernen Gesellschaft. Er untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und dem Bedürfnis nach Sicherheit ergeben, und analysiert die Rolle des Rechts und des Staates in diesem Kontext.
- Die Bedeutung von Freiheit als Grundrecht und ihre Grenzen
- Die Rolle des Rechts und der Verfassung in der Sicherung von Freiheit und Sicherheit
- Die Herausforderungen der modernen Gesellschaft im Umgang mit Risiken und Gefahren
- Die Bedeutung von ethischen Prinzipien und einer öffentlichen Moral für das Zusammenleben
- Die Notwendigkeit von Kompromissen und Toleranz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Reihe von Zitaten, die die verschiedenen Facetten des Begriffs "Freiheit" beleuchten. Es wird deutlich, dass Freiheit nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verantwortung ist, die mit Pflichten und Grenzen einhergeht.
Im weiteren Verlauf des Textes wird die Bedeutung des Rechts und der Verfassung für die Sicherung von Freiheit und Sicherheit hervorgehoben. Die Verfassung wird als Grundlage für eine rechtlich gefestigte und staatlich organisierte Gemeinschaft dargestellt, die den Rahmen für die Ausübung individueller Freiheit setzt.
Der Text beleuchtet auch die Herausforderungen der modernen Gesellschaft im Umgang mit Risiken und Gefahren. Es wird argumentiert, dass die zunehmende Komplexität des gesellschaftlichen Lebens zu einer Steigerung von Risiken führt, die wiederum die individuelle Sicherheit beeinträchtigen können.
Ein weiterer Schwerpunkt des Textes liegt auf der Bedeutung von ethischen Prinzipien und einer öffentlichen Moral für das Zusammenleben. Es wird betont, dass eine Gesellschaft nur dann dauerhaft bestehen kann, wenn es bestimmte Spielregeln und Normen gibt, an die sich alle halten.
Schließlich wird die Notwendigkeit von Kompromissen und Toleranz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit hervorgehoben. Der Text argumentiert, dass es im Interesse des Gemeinwohls notwendig sein kann, individuelle Freiheiten einzuschränken, um die Freiheit anderer zu schützen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Freiheit, Sicherheit, Recht, Verfassung, Gesellschaft, Risiken, Gefahren, ethische Prinzipien, öffentliche Moral, Kompromisse, Toleranz, Grundrechte, Rechtsstaat, Demokratie, Integration, Wohlfahrtsstaat, demografischer Wandel, und die Grenzen der Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie stehen Freiheit und Sicherheit laut Verfassungsrecht zueinander?
Sicherheit ist eine Verfassungsvoraussetzung und ein Verfassungsziel, während Freiheit der grundrechtlich gesicherte Verfassungsinhalt ist. Beide müssen in ein Gleichgewicht gebracht werden.
Was sagt das Bundesverfassungsgericht zur Menschenwürde im Sicherheitskontext?
Das Gericht betont, dass staatliches Handeln (z.B. ein Abschussbefehl) die Menschenwürde nicht verletzen darf, selbst wenn es dem Schutz öffentlicher Sicherheitsinteressen dient.
Warum ist Freiheit nicht gleichbedeutend mit Grenzenlosigkeit?
Freiheit findet ihre Grenze dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Eine „entfesselte“ Freiheit ohne Regeln würde zu Chaos und letztlich zum autoritären Staat führen.
Welche Rolle spielt die Solidarität in einem Gemeinwesen?
Solidarität ist eine wesentliche bürgerliche Tugend, die den inneren Frieden sichert. Sie muss durch Vorbilder und Erziehung aktiv tradiert werden.
Ist Massenüberwachung mit der Freiheit vereinbar?
Anlasslose Massenüberwachung wird im Text als problematisch eingestuft, da der Sicherheitsgewinn gegen die Auswirkungen auf die individuelle Freiheit abgewogen werden muss.
Was bedeutet „Legitimität“ staatlichen Handelns?
Staatliches Handeln ist nur legitim, wenn es auf einer rechtlich gesicherten Grundlage beruht und keine gesetzlichen oder ethischen Normen verletzt.
- Quote paper
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Author), 2014, Freiheit und Sicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280509