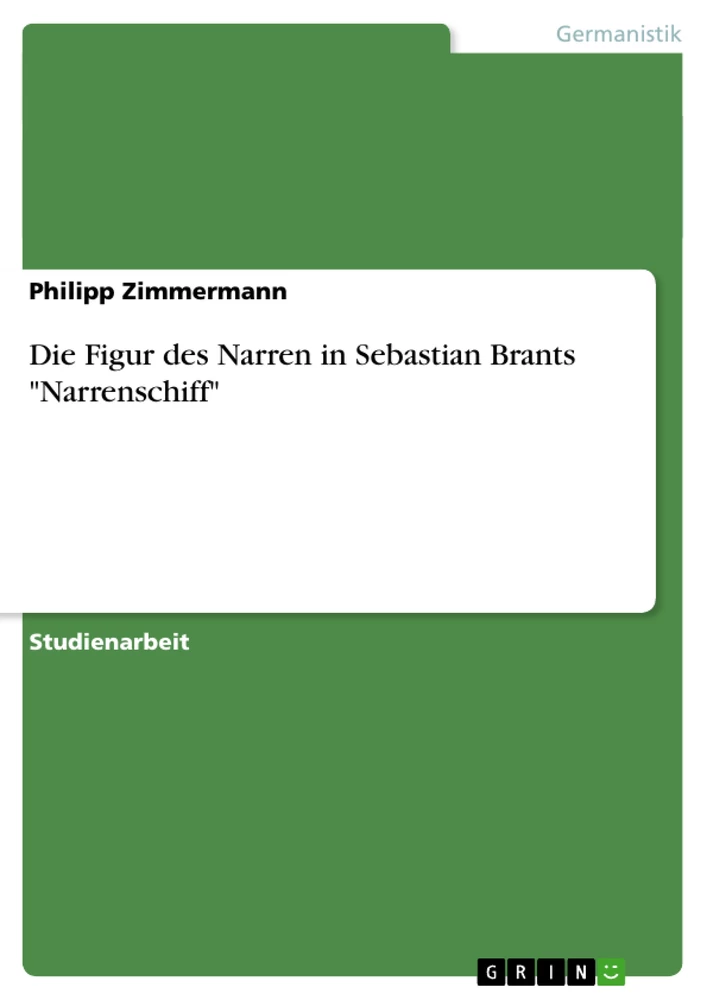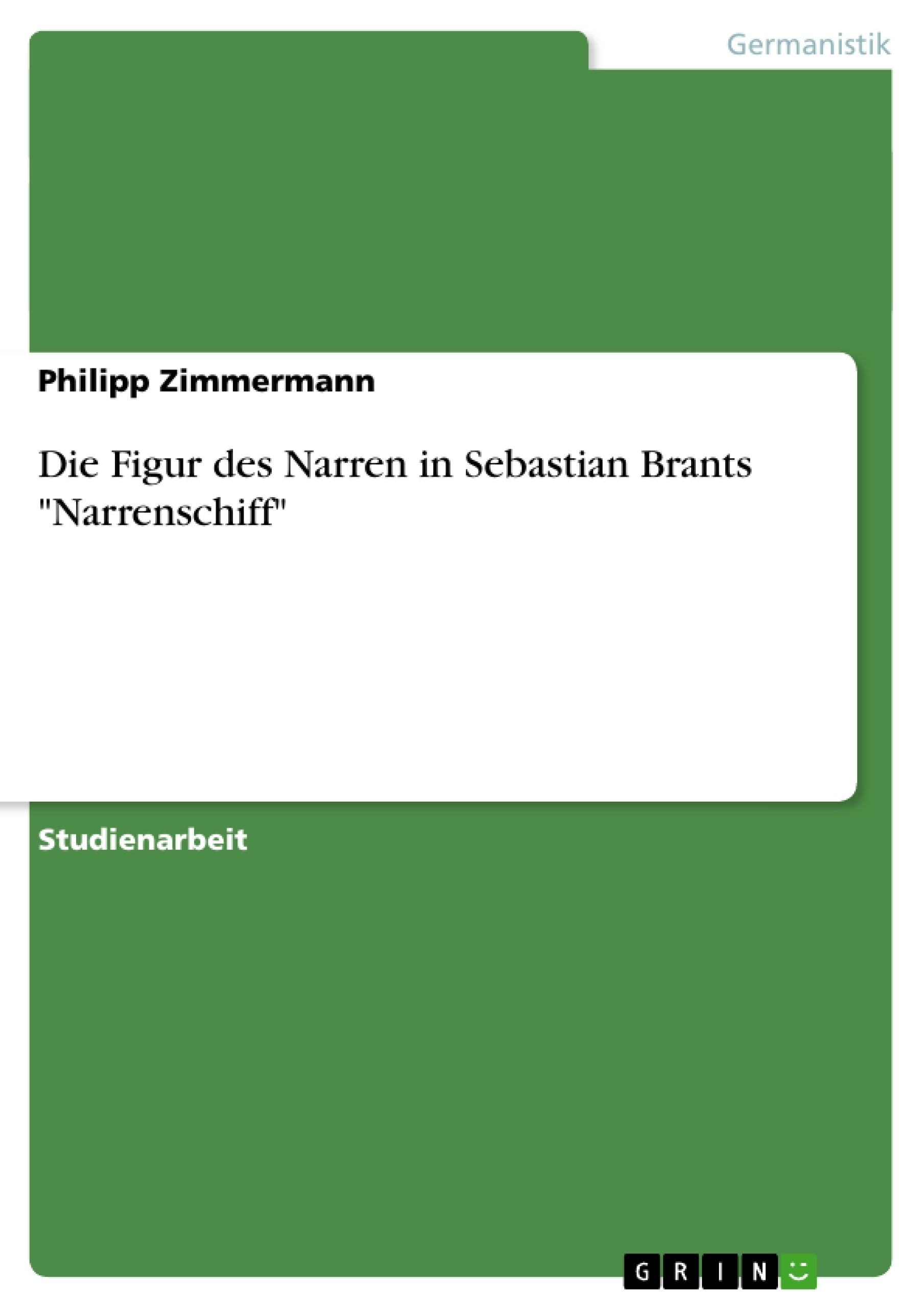Als im Jahr 1494 Sebastian Brant das „Narrenschiff“ veröffentlichte, war die weitere Erfolgsgeschichte des Werkes wohl kaum absehbar. Noch im Erscheinungsjahr wurden in Nürnberg, Reutlingen und Augsburg Nachdrucke publiziert. Ganz Oberdeutschland sei binnen kurzer Zeit mit Nachdrucken nur so übersät gewesen, schreibt Hans-Joachim Mähl in seinem Nachwort zur Reclam-Ausgabe.1 Bis 1509 erlebt das Werk fünf weitere Originalausgaben in Basel. Überarbeitungen ins Niederdeutsche folgten ebenso wie eine lateinische Bearbeitung von Jacob Locher (unter dem Titel „Stultifera Navis“) im Jahr 1497, und dies machte das Werk auch in Gelehrtenkreisen im Ausland bekannt. Ausführlicher lässt sich die Erfolgs- und Wirkungsgeschichte bei Mähl nachlesen. Nicht wenig zum Erfolg beigetragen haben dürften die Holzschnitte. Brant hat als einer der ersten in der Verwendung von Holzschnitten die Möglichkeiten zur Popularisierung von lehrhaften Schriften erkannt.
Ein weiterer Grund dürfte in der Verwendung der Figur des Narren liegen. Narren existierten im realen Leben ebenso wie als fiktionale Figuren. Narren waren im mittelalterlichen Leben bekannt – erwähnt seien nur die Hofnarren und Fastnachtsnarren. Brant hat die Figur des Narren also nicht neu erfunden. Aber: Brant hat die Figur des Narren neu gedeutet, er begründete eine neue Literaturgattung mit eigenen Themen und Motiven – die Narrenliteratur. „Ohne Zweifel müssen damals gemeinsame, übergreifende Ideen latent gewesen sein, die sich auf verschiedensten Ebenen immer wieder in der Gestalt des Narren verdichteten“, meint etwa Mezger2, und Könneker3 spricht davon, dass Brant mit der Narrenthematik an den Geist der Zeit gerührt habe und dasjenige, was die Gemüter im Innersten bewegt habe und was an neuen Möglichkeiten des Selbstverständnisses sich abzuzeichnen begann, im einprägsamen Bild und repräsentativen Symbol ausgesprochen habe.4
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Narr im späten Mittelalter
- Der theologische Narr
- Der pathologische Narr
- Der Hofnarr
- Der Fastnachtsnarr
- Der moralisch-didaktische Narr
- Die Narreninsignien
- Narrenkappe und Eselsohren
- Schellen und Schnabelschuhe
- Kolben, Marotte und Spiegel
- Fuchsschwanz und Hahnenkamm
- Gläserne Kugel oder Blase
- Der Narr in Sebastian Brants „Narrenschiff“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Figur des Narren im Werk Sebastian Brants „Narrenschiff“ und untersucht, wie Brant die Figur des Narren neu gedeutet und eine neue Literaturgattung, die Narrenliteratur, begründet hat.
- Ausweitung des Narrenbegriffs in Brants Werk
- Narren als Repräsentanten aller Gesellschaftsschichten
- Die Rolle des Narren im Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche des späten Mittelalters
- Die Verwendung der Figur des Narren als Mittel zur Kritik und Satire
- Die Bedeutung der Narrenliteratur für die Entwicklung der deutschen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die beiden zentralen Thesen vor, die im weiteren Verlauf untersucht werden sollen.
- Ausweitung des Narrenbegriffs in Sebastian Brants „Narrenschiff“
- Narren bei Brant als Vertreter aller Gesellschaftsschichten
- Der Narr im späten Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Narrentypen des späten Mittelalters und ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext.
- Der theologische Narr, der pathologische Narr, der Hofnarr, der Fastnachtsnarr und der moralisch-didaktische Narr werden vorgestellt und ihre Eigenschaften, Funktionen und Bedeutung diskutiert.
- Das Kapitel beleuchtet auch die verschiedenen Narreninsignien und ihre Symbolik.
Schlüsselwörter
Narrenliteratur, Sebastian Brant, „Narrenschiff“, Mittelalter, Narrentypen, Narreninsignien, Satire, Kritik, Gesellschaftliche Umbrüche, Moral, Didaktik, Symbolfigur, Sapientia, Stultitia.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Sebastian Brants "Narrenschiff" so erfolgreich?
Der Erfolg lag an der Verwendung der populären Narrenfigur, der innovativen Nutzung von Holzschnitten und der Tatsache, dass Brant den "Geist der Zeit" traf.
Welche Narrentypen gab es im späten Mittelalter?
Es gab den theologischen Narren, den pathologischen (geisteskranken) Narren, den Hofnarren, den Fastnachtsnarren und den moralisch-didaktischen Narren.
Was symbolisieren die Insignien des Narren?
Insignien wie Narrenkappe mit Eselsohren, Schellen, Kolben und Spiegel dienten als Symbole für Torheit, Eitelkeit und die Abkehr von göttlicher Weisheit.
Wie deutete Sebastian Brant die Figur des Narren neu?
Brant weitete den Narrenbegriff aus: Bei ihm sind Narren Repräsentanten aller Gesellschaftsschichten, deren Fehlverhalten er satirisch kritisiert.
Was ist "Narrenliteratur"?
Es ist eine Literaturgattung, die Brant begründete, in der die Figur des Narren genutzt wird, um menschliche Laster und gesellschaftliche Missstände didaktisch aufzubereiten.
- Citar trabajo
- Philipp Zimmermann (Autor), 2003, Die Figur des Narren in Sebastian Brants "Narrenschiff", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28052