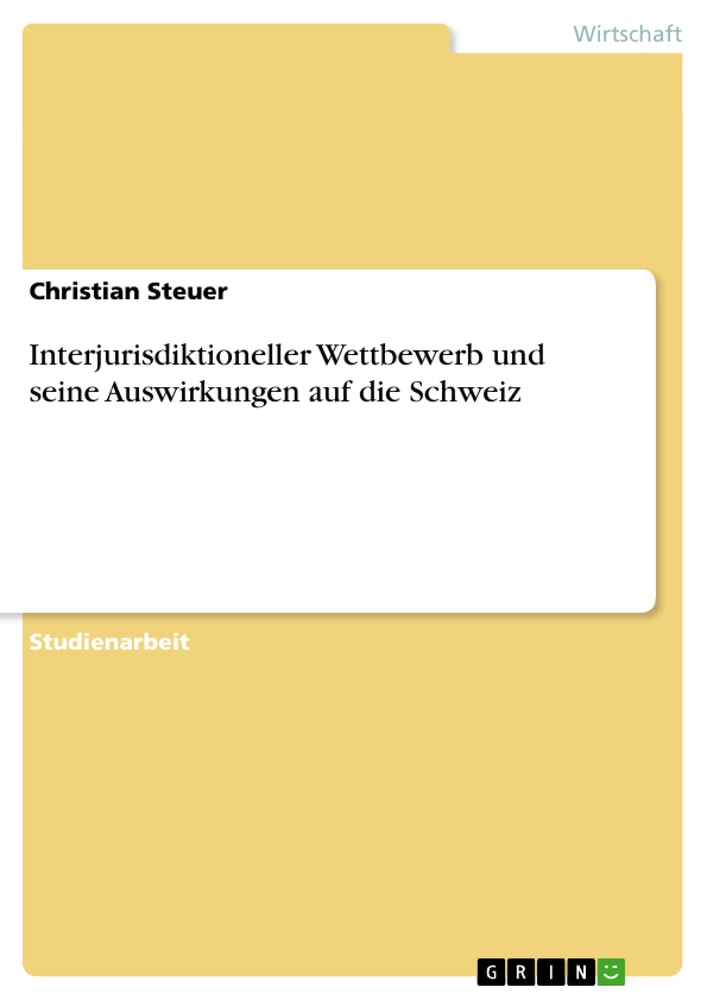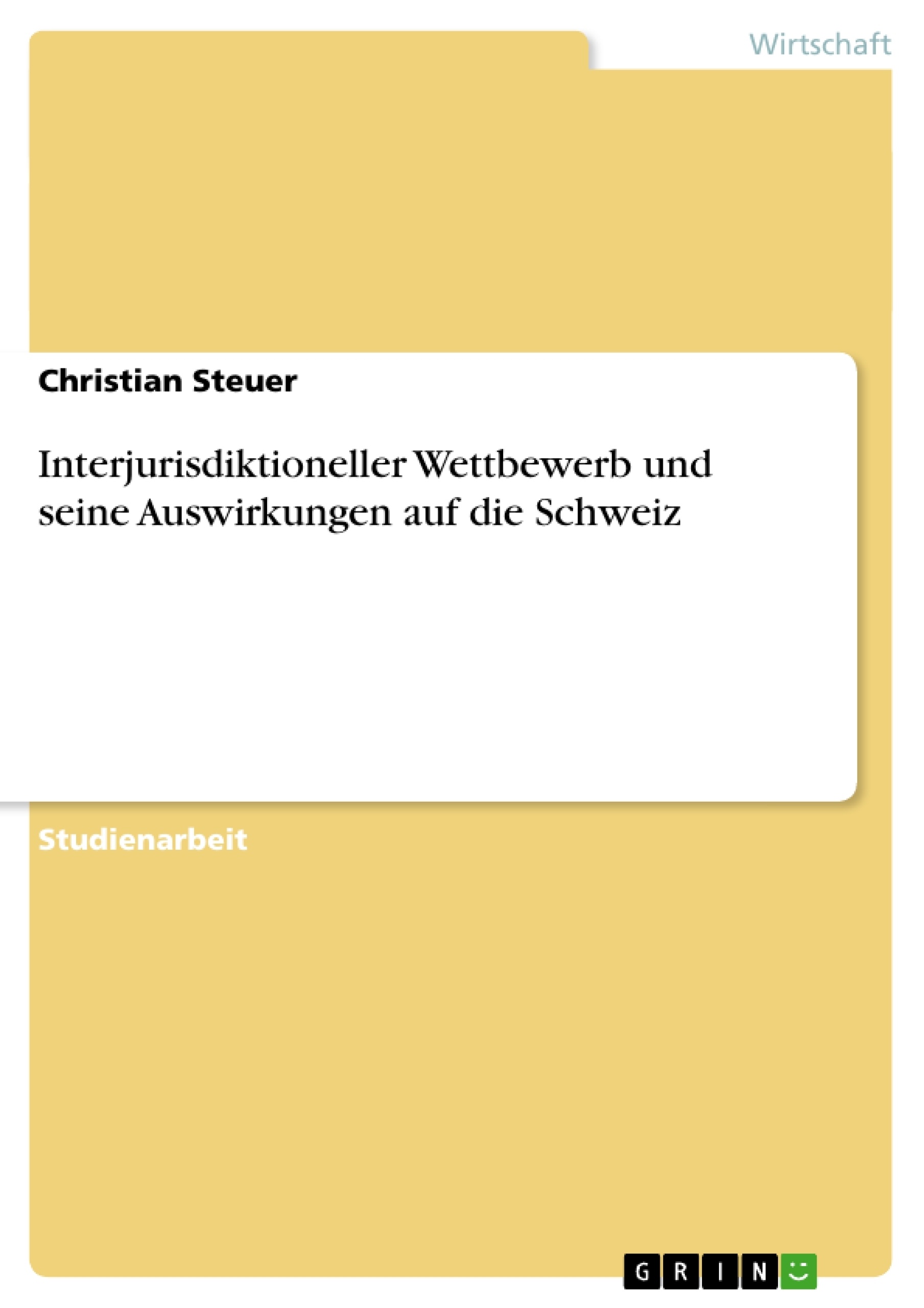Einleitung
Wie wichtig das Thema Föderalismus für einzelne Staaten und deren Bürger ist, zeigt sich alleine an der Tatsache, dass an der Internationalen Föderalismus -Konferenz in St. Gallen Ende August 2002 rund 500 Delegierte aus fast 60 Staaten teilnahmen.1 Doch auch die Fülle von Konzepten und Theorien deuten auf die lange Tradition der wissenschaftlichen Diskussion über den Föderalismus.
Wettbewerb zwischen Jurisdiktionen2 ist in der Realität ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Beispielsweise konkurrieren verschiedene Regionen um die Ansiedlung neuer Unternehmen, unterschiedliche Staaten um neue Einwohner und unterschiedliche Regierungen um Kompetenzen zur Durchführung politischer Maßnahmen.3 Ein durch den Ökonom Tiebout4 erstmals 1956 diskutiertes Konzept zum interjurisdiktionellen Wettbewerb fand Ende der 1980er Jahre erneut Beachtung in der Diskussion. Unter den Begriffen „competitive federalism“, „competition among governments“ und „interjurisdictional competition“ entstand sie in den USA. Somit fand der interjurisdiktionelle Wettbewerb, der sich bei dezentralen Entscheidungen über öffentliche Leistungen und Steuern einerseits und Mobilität der Bürger zwischen den Gebiets-körperschaften andererseits zwangsläufig ergibt, wieder Berücksichtigung in der ökonomischen Föderalismustheorie, um auf diese Weise zu einer integrierten Theorie des Wettbewerbsföderalismus zu gelangen. 5 Diese Arbeit soll einen Einblick in die Theorie zum interjurisdiktionellen Wettbewerb geben, und anhand empirischer Untersuchungen für die Schweiz dessen Auswirkungen aufzeigen. Eine allumfassende Darstellung des föderativen Systems der Schweiz ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich, deshalb beschränke ich mich auf die wichtigsten Merkmale und Auswirkungen.
Zunächst soll im zweiten Abschnitt als grundlegendes Modell des interjurisdiktionellen Wettbewerbs das Tiebout-Modell beschrieben und ein kurzer Überblick zu weiteren Modellen gegeben werden. Anschließend wird das Konzept des Wettbewerbsföderalismus vorgestellt, wobei ich auch auf die Chancen und Grenzen dieses Konzeptes eingehen werde. Im dritten Abschnitt folgt eine kurze Darstellung der föderativen Verfassung der Schweiz. Die Auswirkungen des Wettbewerbsföderalismus sollen anschließend anhand der Einkommensbesteuerung natürlicher und juristischer Personen sowie der Sozial-versicherung dargestellt werden. Der letzte Abschnitt enthält ein Fazit mit einem kurzen Ausblick auf künftige Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interjurisdiktioneller Wettbewerb
- Ökonomische Modelle
- Tiebout Modell
- Überblick zu weiteren Modellen
- Wettbewerbsföderalismus
- Konzept des Wettbewerbsföderalismus
- Chancen und Grenzen des Konzeptes
- Ökonomische Modelle
- Wettbewerbsföderalismus in der Schweiz
- Die föderative Verfassung der Schweiz
- Auswirkungen des Wettbewerbs
- Einkommensbesteuerung natürlicher Personen
- Einkommensbesteuerung juristischer Personen
- Sozialversicherung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie des interjurisdiktionellen Wettbewerbs und dessen Auswirkungen auf die Schweiz. Sie soll einen Einblick in die verschiedenen ökonomischen Modelle bieten, insbesondere das Tiebout-Modell, und das Konzept des Wettbewerbsföderalismus erläutern, einschließlich seiner Chancen und Grenzen. Die Arbeit untersucht auch die Auswirkungen des Wettbewerbsföderalismus auf die schweizerische Einkommensbesteuerung natürlicher und juristischer Personen sowie auf die Sozialversicherung.
- Interjurisdiktioneller Wettbewerb als ökonomisches Phänomen
- Das Tiebout-Modell und seine Relevanz für die Föderalismustheorie
- Das Konzept des Wettbewerbsföderalismus und seine Anwendung in der Schweiz
- Auswirkungen des Wettbewerbs auf die schweizerische Steuer- und Sozialpolitik
- Bewertung der Chancen und Herausforderungen des Wettbewerbsföderalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des interjurisdiktionellen Wettbewerbs ein und beleuchtet dessen Relevanz für Staaten und Bürger. Sie stellt die zentrale Bedeutung des Themas in der wissenschaftlichen Diskussion dar und erläutert den Fokus der Arbeit auf die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Schweiz. Kapitel 2 präsentiert die Theorie des interjurisdiktionellen Wettbewerbs, wobei zunächst das Tiebout-Modell als grundlegendes Modell beschrieben und ein Überblick zu weiteren Modellen gegeben wird. Anschließend wird das Konzept des Wettbewerbsföderalismus vorgestellt, einschließlich seiner Chancen und Grenzen. Kapitel 3 widmet sich dem schweizerischen Föderalismus und untersucht die Auswirkungen des Wettbewerbsföderalismus auf die Einkommensbesteuerung natürlicher und juristischer Personen sowie auf die Sozialversicherung. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Interjurisdiktioneller Wettbewerb, Wettbewerbsföderalismus, Tiebout-Modell, Schweiz, Föderalismus, Einkommensbesteuerung, Sozialversicherung, öffentliche Leistungen, Steuerpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist interjurisdiktioneller Wettbewerb?
Es bezeichnet den Wettbewerb zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften (z.B. Kantonen oder Staaten) um mobile Faktoren wie Unternehmen, Einwohner und Steuerkraft.
Was besagt das Tiebout-Modell?
Das Modell von 1956 geht davon aus, dass Bürger „mit den Füßen abstimmen“, indem sie in die Jurisdiktion ziehen, deren Angebot an öffentlichen Leistungen und Steuern am besten zu ihren Präferenzen passt.
Wie wirkt sich der Wettbewerbsföderalismus auf die Steuern in der Schweiz aus?
In der Schweiz führt der Wettbewerb zwischen den Kantonen zu einer differenzierten Einkommensbesteuerung für natürliche und juristische Personen, was sowohl Anreize für Effizienz als auch Herausforderungen für den sozialen Ausgleich schafft.
Welche Chancen bietet der Wettbewerb zwischen Regierungen?
Chancen liegen in einer höheren Innovationskraft politischer Maßnahmen, einer besseren Anpassung an Bürgerwünsche und einer disziplinierenden Wirkung auf die Staatsausgaben.
Gibt es Grenzen für den interjurisdiktionellen Wettbewerb?
Ja, Grenzen liegen in der Gefahr eines „Race to the bottom“ bei Sozialstandards oder Steuern sowie in der ungleichen Verteilung von Ressourcen zwischen starken und schwachen Regionen.
- Citation du texte
- Christian Steuer (Auteur), 2004, Interjurisdiktioneller Wettbewerb und seine Auswirkungen auf die Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28055