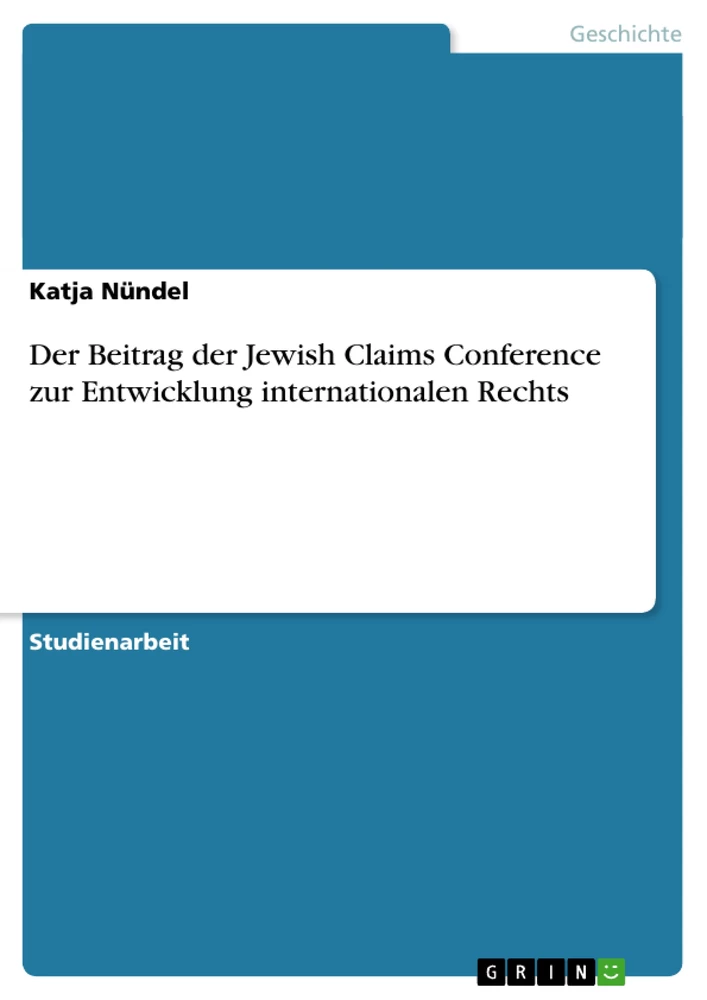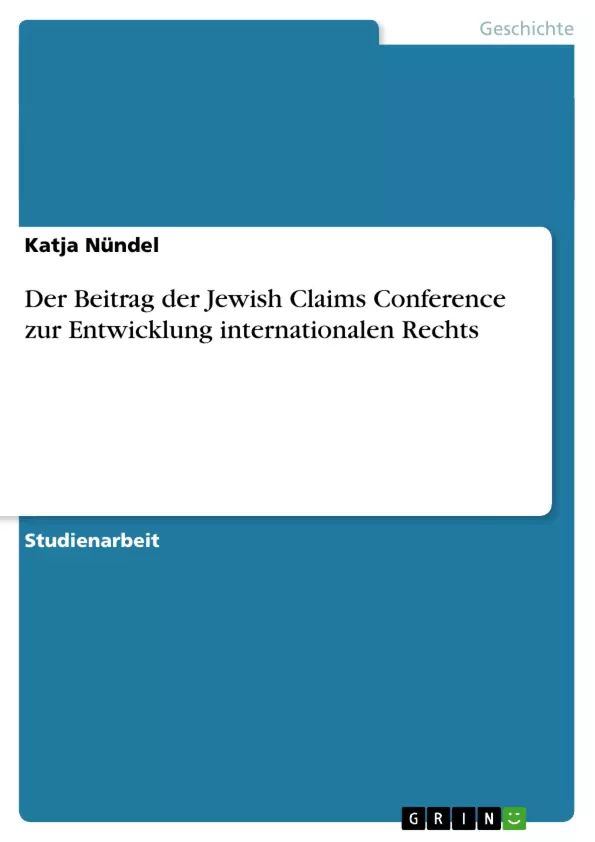Es gibt einen weltweiten Trend zur Entschädigung historischen Unrechts feststellt. Machtpolitik und "Siegerjustiz" weichen immer häufiger einer Verständigung, wenn auch oft einer späten, mit den Opfern. Jüngstes Beispiel ist der Abschluss der Zwangsarbeiterentschädigung durch Deutschland. Ausgangspunkt dieser neueren Entwicklungen sind die Verhandlungen der Conference on Jewish Material Claims against Germany mit der Bundesrepublik Deutschland, welche 1952 mit dem Luxemburger Abkommen zur ersten Entschädigungsvereinbarung über historisches Unrecht zwischen einem völkerrechtlich anerkannten Staat und einer nicht-staatlichen Gruppe führten. Ein völkerrechtlicher Präzedenzfall! Die Claims Conference füllte zunächst sehr pragmatisch und innovativ die völkerrechtliche Lücke, die der Holocaust gerissen hatte. Das erste massenhafte Morden eines Staates an eigenen Bürgern, der erste Völkermord in einem Ausmaß, das den Verbleib des erbenlosen Eigentums zur diskutierten Frage machte. Die Claims Conference, ein Zusammenschluss verschiedener jüdischer Organisationen, erklärte sich selbst zur Nachlassverwalterin und Anwältin ermordeter jüdischer Bürger, und vertrat auf diese Weise auch die, die überlebt hatten.
Der Einfluss der Claims Conference auf die Weiterentwicklung des Völkerrechts wurde bisher kaum diskutiert. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die Claims Conference über ihren eigenen Fall vielleicht hinaus weist, und inwiefern das jüdische Beispiel andere staatenlose Gruppen ermutigt hat, sich quasi-staatliche zu organisieren, um erlittenes Unrecht "nachzuverhandeln".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung – These
- Begriffe
- „Internationales Recht“ und „Völkerrecht“
- „Wiedergutmachung“ und „Entschädigung“
- Juristische Begründung der Entschädigungsforderungen
- Präzedenzfall Holocaust
- Minderheitenschutz
- Haager Landkriegsordnung
- Funktion der Claims Conference
- Das jüdische Volk als Völkerrechtssubjekt
- „Reparationen“ an das jüdische Volk
- Restitutionstheorien im Gefolge der Claims Conference
- Gruppenrecht auf Entschädigung: Silvers
- Flexible Theorie internationaler Entschädigung: Barkan
- Vergleich der Restitutionstheorien
- Völkerrecht nach der Claims Conference
- Völkermordkonvention
- Deklaration über den Minderheitenschutz
- Lösungswege
- Zusammenfassung - Thesediskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Jewish Claims Conference in der Entwicklung des internationalen Rechts im Kontext der Entschädigungsforderungen nach dem Holocaust. Sie analysiert die juristische Begründung der Entschädigungsforderungen sowie die Funktion der Claims Conference als Vertreterin des jüdischen Volkes. Darüber hinaus untersucht die Arbeit zwei Restitutionstheorien, die auf der Arbeit der Claims Conference basieren, und diskutiert die Übertragbarkeit dieser Theorien auf andere Fälle von historischem Unrecht.
- Die historische Einmaligkeit des Holocaust und seine Auswirkungen auf das internationale Recht.
- Die Rolle der Claims Conference in der Entwicklung des internationalen Rechts und des Schutzes von Gruppenrechten.
- Die juristischen Argumente für die Entschädigungsforderungen des jüdischen Volkes.
- Die Übertragbarkeit von Restitutionstheorien auf andere Fälle von historischem Unrecht.
- Die Grenzen und Möglichkeiten der Anwendung von Entschädigungsmechanismen im Völkerrecht.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung – These: Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor, dass die Jewish Claims Conference und ihre Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland zwar einen „Prototyp“ für die Entwicklung des internationalen Rechts darstellen, jedoch nicht ohne Einschränkung verallgemeinerbar sind.
- Begriffe: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Internationales Recht“, „Völkerrecht“, „Wiedergutmachung“ und „Entschädigung“ und definiert die Bedeutung, die sie im Kontext der Arbeit haben.
- Juristische Begründung der Entschädigungsforderungen: Dieses Kapitel untersucht die juristischen Argumente für die Entschädigungsforderungen des jüdischen Volkes, insbesondere im Hinblick auf den Präzedenzfall des Holocaust, den Minderheitenschutz und die Haager Landkriegsordnung.
- Funktion der Claims Conference: In diesem Kapitel wird die Rolle der Claims Conference als Vertreterin des jüdischen Volkes in den Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland untersucht. Es wird die Frage diskutiert, inwiefern das jüdische Volk als Völkerrechtssubjekt betrachtet werden kann und welche Rolle die „Reparationen“ an das jüdische Volk im internationalen Recht spielen.
- Restitutionstheorien im Gefolge der Claims Conference: Dieses Kapitel stellt zwei Restitutionstheorien vor, die auf der Arbeit der Claims Conference basieren: Die Theorie von Silvers, die ein Gruppenrecht auf Entschädigung postuliert, und die Theorie von Barkan, die eine flexiblere Theorie internationaler Entschädigung vorschlägt. Die Theorien werden verglichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt.
- Völkerrecht nach der Claims Conference: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Claims Conference auf die Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere im Hinblick auf die Völkermordkonvention, die Deklaration über den Minderheitenschutz und die Lösungswege für die Behebung von historischem Unrecht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Holocaust, Entschädigungsforderungen, Jewish Claims Conference, Völkerrecht, Internationales Recht, Gruppenrechte, Restitutionstheorien, Wiedergutmachung, Minderheitenschutz, Völkermordkonvention, Deklaration über den Minderheitenschutz, historische Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Jewish Claims Conference?
Die Claims Conference ist ein Zusammenschluss jüdischer Organisationen, die 1952 das Luxemburger Abkommen mit Deutschland aushandelte, um Entschädigungen für Holocaust-Opfer zu sichern.
Warum war das Luxemburger Abkommen ein völkerrechtlicher Präzedenzfall?
Es war die erste Entschädigungsvereinbarung über historisches Unrecht zwischen einem souveränen Staat und einer nicht-staatlichen Gruppe.
Welchen Einfluss hatte die Claims Conference auf das Völkerrecht?
Sie füllte eine völkerrechtliche Lücke beim Umgang mit Völkermord und erbenlosem Eigentum und stärkte die Idee von Gruppenrechten auf Entschädigung.
Was besagt die Restitutionstheorie von Barkan?
Elazar Barkan schlägt eine flexible Theorie internationaler Entschädigung vor, die über rein rechtliche Ansprüche hinausgeht und moralische Anerkennung betont.
Können andere Gruppen das „jüdische Beispiel“ nutzen?
Die Arbeit untersucht, inwiefern andere staatenlose Gruppen ermutigt wurden, sich quasi-staatlich zu organisieren, um erlittenes Unrecht nachzuverhandeln, weist aber auch auf die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit hin.
- Citation du texte
- Diplom Katja Nündel (Auteur), 2003, Der Beitrag der Jewish Claims Conference zur Entwicklung internationalen Rechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28066