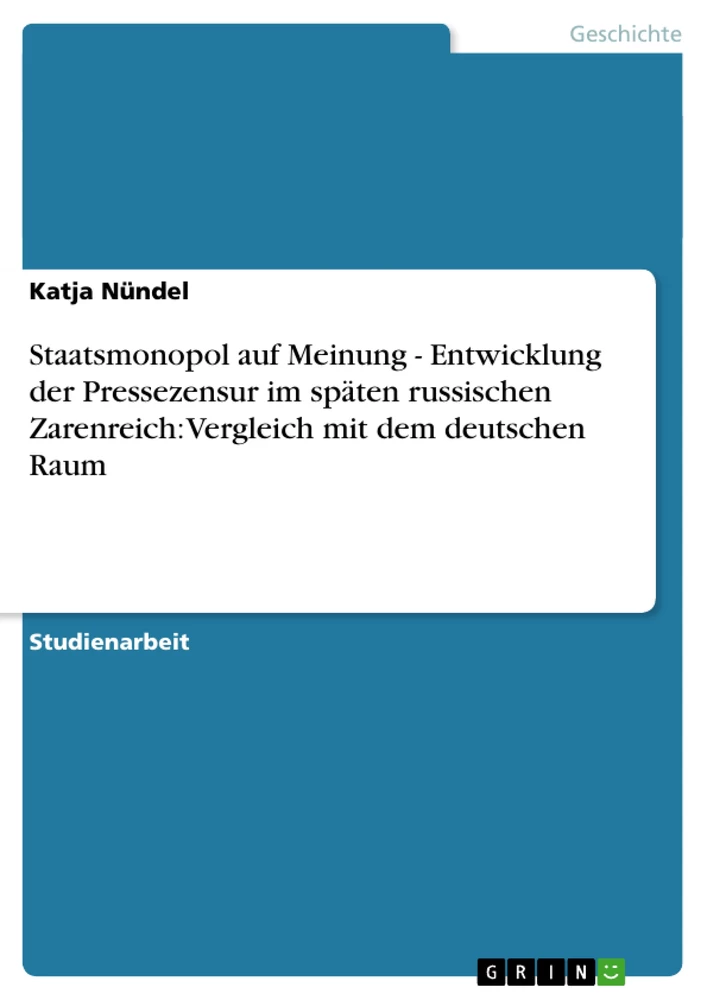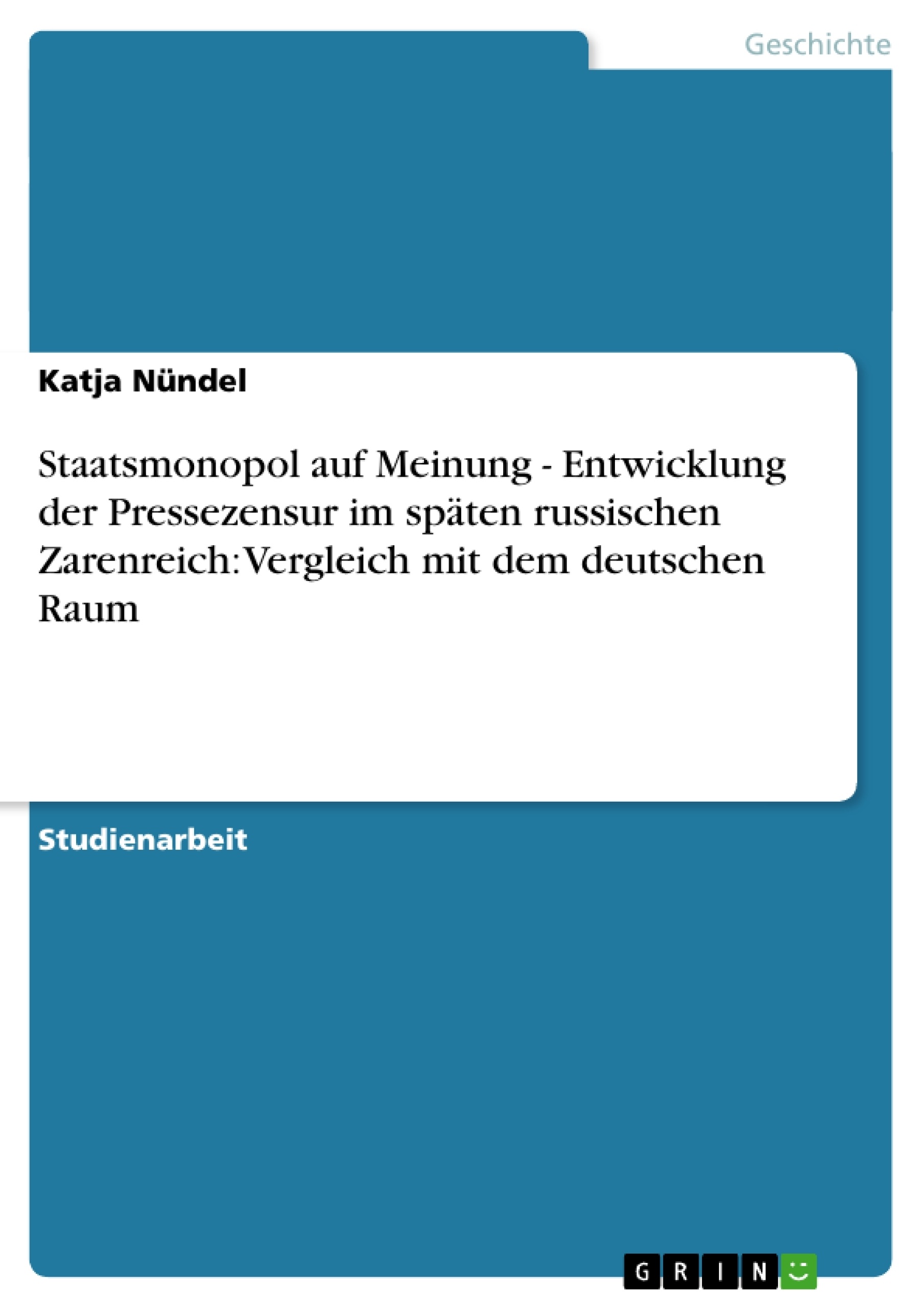Wenn die Freiheit der Presse ein „Thermometer [ist]…, an dem man ablesen kann, wie es um die politischen Freiheiten in einem Land überhaupt bestellt ist“ , kann die Untersuchung der Unterdrückung dieser Freiheit und der Beschränkung von Öffentlichkeit durch Zensur wertvoller Indikator auf die Entwicklung eines Gemeinwesens vom Obrigkeitsstaat zur Zivilgesellschaft liefern.
Hatte England die Pressezensur bereist 1695 de facto abgeschafft und Frankreich die Pressefreiheit nach der Revolution 1789 als erstes europäisches Land in der Verfassung verankert, so brauchten das Russische Zaren- und das Deutsche Kaiserreich bis 1906 bzw. 1874 bevor sie sich dieser Entwicklung anschlossen.
Auch die Genese dieser Entscheidung für die Pressefreiheit, weist in beiden Staaten Parallelen auf: Nicht die Einwohner erstritten im Sinne von Staatsbürgern die Pressefreiheit als ihr unveräußerliches Freiheitsrecht, sondern die Regierungen schenkten es ihnen kampflos, um revolutionäre Umbrüche wie in den westlicheren Ländern zu verhindern. Doch weil die Herrscher dieses Recht ihren Untertanen, denn Bürger waren sie nicht, geschenkt hatten, konnten sie es ihnen auch nehmen. Die institutionelle Entwicklung zur Sicherung dieses Freiheitsrechts im Sinne z.B. einer Volksvertretung hatte in keiner Weise mit der Entwicklung in anderen Ländern Schritt gehalten, was dazu führte, dass die so gewährten Freiheitsrechte Kopien ihrer Vorbilder blieben, die bei Bedarf wieder entfernt werden konnten. Beide Gesellschaften lebten vor der Abschaffung der Vorzensur über Jahrzehnte unter provisorischen Pressestatuten, die die freie Meinungsäußerung in Aussicht stellten. Einklagen konnten sie sie nicht.
Obwohl die Mechanismen der repressiven Pressekontrolle vielfältig sind, agierten Herrscher in Autokratien und obrigkeitsstaatliche Regierungen nach der französischen Revolution in ähnlicher Weise auf die Bedrohung ihrer Herrschaft durch freie Meinungsäußerung. Ein Vergleich zwischen dem späten russischen Zarenreich und dem deutschen Raum seit dem Vormärz zeigt den engen Rahmen, in welchem sich diese Regierungen im nachrevolutionären Europa bewegten, und offenbart eine gewisse Zwangsläufigkeit der „Evolution“ vom staatlichen Arkanprinzip hin zu mehr Öffentlichkeit nach 1789.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe
- „Öffentlichkeit“ bei Habermas
- „Zensur“ und „Pressefreiheit“
- Ansatz: Historischer Vergleich
- Die Befreiung der Presse im Russischen Zarenreich im Vergleich zum Deutschen Kaiserreich
- Darstellung
- Repressive Pressepolitik im russischen Zarenreich
- Geheimpolizeiphase unter Nikolai I.
- Pressestatut von 1865
- Das vierzigjährige Provisorium
- Aufhebung der Vorzensur 1906 und neue Restriktionen
- Repressive Pressepolitik im deutschen Kaiserreich
- Deutsche Presse im System Metternich
- Aufhebung der Vorzensur: Bundesversammlung 1848
- Kontrolle der Presse im Königreich Preußen
- Reichspressegesetz von 1874
- Vergleich. Überprüfung der Hypothese
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Pressezensur im späten russischen Zarenreich und vergleicht sie mit der Entwicklung im deutschen Raum. Ziel ist es, die Mechanismen repressiver Pressekontrolle in autokratischen Systemen zu analysieren und die "Evolution" vom staatlichen Arkanprinzip hin zu mehr Öffentlichkeit aufzuzeigen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Parallelen und Unterschiede in der Entwicklung der Pressefreiheit in beiden Ländern.
- Entwicklung der Pressezensur im späten russischen Zarenreich
- Vergleich mit der Pressezensur im deutschen Kaiserreich
- Der Einfluss der französischen Revolution auf die Pressepolitik beider Staaten
- Das Konzept der "Öffentlichkeit" nach Habermas und seine Relevanz für die Untersuchung
- Die Rolle der Regierung in der Gestaltung der Pressefreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entwicklung der Pressezensur in Russland und Deutschland und deren Bedeutung als Indikator für die Entwicklung der Zivilgesellschaft. Sie formuliert die Arbeitshypothese, dass autokratische Regime trotz unterschiedlicher Ausgangslagen ähnlich auf die Bedrohung ihrer Herrschaft durch freie Meinungsäußerung reagierten. Die Bedeutung der Pressefreiheit als "Thermometer" für politische Freiheiten wird hervorgehoben, und der historische Kontext der Pressezensur in England und Frankreich wird kurz skizziert. Schließlich werden die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Pressefreiheit, wie Industrialisierung und Urbanisierung, genannt, ohne jedoch im Detail darauf einzugehen.
Begriffe: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Öffentlichkeit“ und „Zensur“, wobei der Fokus auf Habermas' Konzept der „bürgerlichen Öffentlichkeit“ liegt. Es wird die Entwicklung von der repräsentativen Öffentlichkeit im Absolutismus zur bürgerlichen Öffentlichkeit in der Aufklärung erläutert, die durch den Diskurs der Bürger geprägt ist und die politische Mitbestimmung ermöglichen soll. Die unterschiedlichen theoretischen Zugänge zum Begriff „Öffentlichkeit“ werden kurz erwähnt, ohne detailliert auf die verschiedenen Modelle einzugehen.
Ansatz: Historischer Vergleich: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einem historischen Vergleich der Pressepolitik im russischen Zarenreich und im deutschen Kaiserreich basiert. Es skizziert die grundsätzliche Forschungsfrage und die Herangehensweise. Die Kapitelbeschreibung legt die Grundlage für den Vergleich der beiden Systeme im weiteren Verlauf der Arbeit.
Darstellung: Dieses Kapitel ist in zwei Unterkapitel gegliedert und stellt die repressive Pressepolitik im russischen Zarenreich und im deutschen Kaiserreich dar. Es analysiert die unterschiedlichen Phasen und Maßnahmen der Zensur in beiden Ländern, von der Geheimpolizeiphase unter Nikolaus I. bis zum Reichspressegesetz von 1874. Es werden die jeweiligen historischen Kontexte und die spezifischen Mechanismen der Pressekontrolle detailliert beschrieben. Es wird die Entwicklung und die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Einflüsse für beide Länder beleuchtet.
Vergleich. Überprüfung der Hypothese: Dieses Kapitel fehlt in der Zusammenfassung, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Pressezensur, Pressefreiheit, Öffentlichkeit, Russisches Zarenreich, Deutsches Kaiserreich, Habermas, Historischer Vergleich, Autokratie, Meinungsfreiheit, Repressive Pressepolitik, Zivilgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung der Pressezensur im späten russischen Zarenreich im Vergleich zum Deutschen Kaiserreich
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Pressezensur im späten russischen Zarenreich und vergleicht sie mit der Entwicklung im deutschen Kaiserreich. Das Hauptziel ist die Analyse der Mechanismen repressiver Pressekontrolle in autokratischen Systemen und die Darstellung der "Evolution" vom staatlichen Arkanprinzip hin zu mehr Öffentlichkeit. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Parallelen und Unterschiede in der Entwicklung der Pressefreiheit in beiden Ländern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Pressezensur in beiden Ländern, den Einfluss der französischen Revolution auf die Pressepolitik, Habermas' Konzept der "Öffentlichkeit" und dessen Relevanz, und die Rolle der Regierung bei der Gestaltung der Pressefreiheit. Die Arbeit definiert außerdem zentrale Begriffe wie "Öffentlichkeit" und "Zensur".
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen historischen Vergleich der Pressepolitik im russischen Zarenreich und im deutschen Kaiserreich. Dieser Ansatz dient der Beantwortung der Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Entwicklung der Pressefreiheit unter autokratischen Bedingungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung ("Öffentlichkeit" und "Zensur"), ein Kapitel zum methodischen Ansatz (historischer Vergleich), ein Kapitel zur Darstellung der repressiven Pressepolitik in beiden Ländern, und ein abschließendes Kapitel zum Vergleich und zur Überprüfung der Arbeitshypothese. Ein Literaturverzeichnis ist ebenfalls enthalten.
Welche Phasen der Pressezensur werden im russischen Zarenreich untersucht?
Die Arbeit untersucht die Geheimpolizeiphase unter Nikolaus I., das Pressestatut von 1865, das "vierzigjährige Provisorium", und die Aufhebung der Vorzensur 1906 mit anschließenden neuen Restriktionen.
Welche Phasen der Pressezensur werden im deutschen Kaiserreich untersucht?
Die Arbeit untersucht die deutsche Presse im System Metternich, die Aufhebung der Vorzensur 1848, die Kontrolle der Presse im Königreich Preußen, und das Reichspressegesetz von 1874.
Welche Rolle spielt Jürgen Habermas' Konzept der "Öffentlichkeit"?
Habermas' Konzept der "bürgerlichen Öffentlichkeit" bildet einen zentralen Bezugsrahmen für die Analyse. Die Arbeit erläutert die Entwicklung von der repräsentativen Öffentlichkeit im Absolutismus zur bürgerlichen Öffentlichkeit in der Aufklärung und diskutiert die Relevanz dieses Konzepts für die Untersuchung der Pressefreiheit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Entwicklung der Pressezensur in Russland und Deutschland und deren Bedeutung als Indikator für die Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die Arbeit überprüft die Hypothese, dass autokratische Regime trotz unterschiedlicher Ausgangslagen ähnlich auf die Bedrohung ihrer Herrschaft durch freie Meinungsäußerung reagierten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pressezensur, Pressefreiheit, Öffentlichkeit, Russisches Zarenreich, Deutsches Kaiserreich, Habermas, Historischer Vergleich, Autokratie, Meinungsfreiheit, Repressive Pressepolitik, Zivilgesellschaft.
- Citation du texte
- Diplom Katja Nündel (Auteur), 2003, Staatsmonopol auf Meinung - Entwicklung der Pressezensur im späten russischen Zarenreich: Vergleich mit dem deutschen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28069