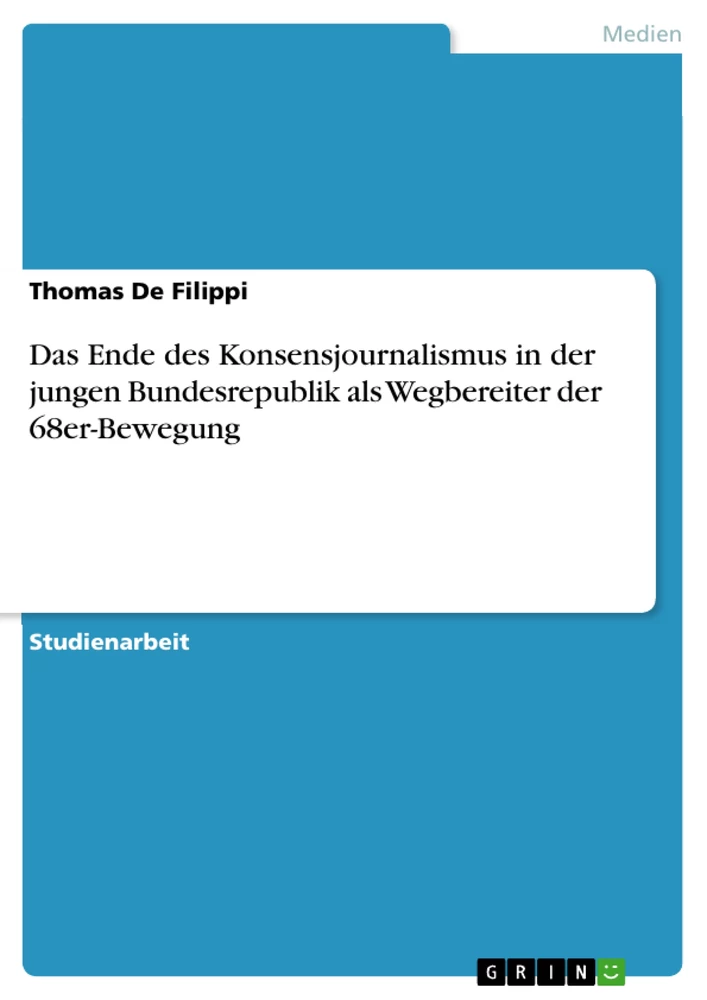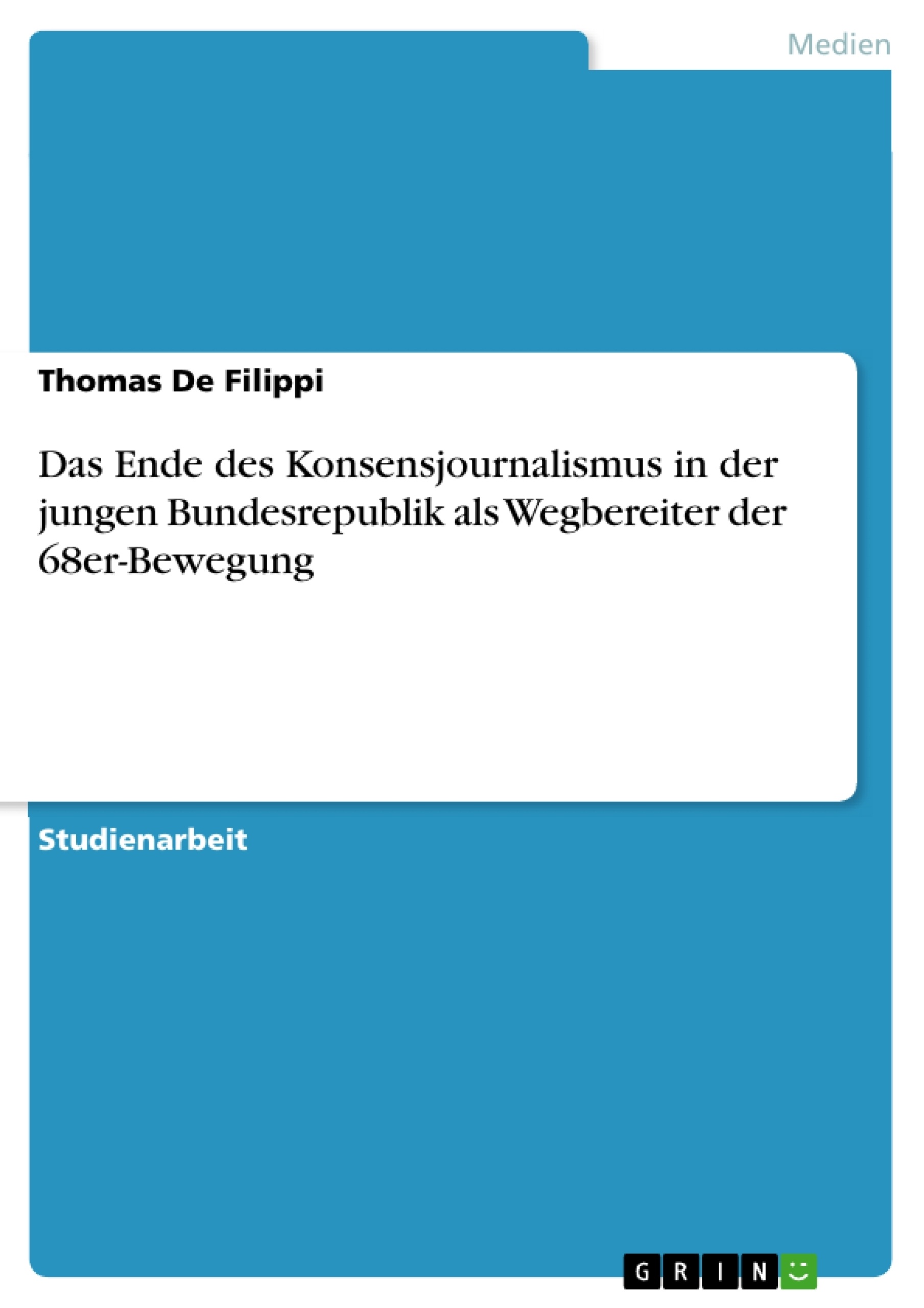„Aber nicht nur in der Jugend, sondern auch in der Bevölkerung allgemein waren die Anfänge eines tief greifenden Wertewandels erkennbar.“
Mit dieser Aussage beschreibt Schildt den Beginn einer gesellschaftlichen Zäsur, die gemeinhin unter dem Namen 68er-Bewegung bekannt geworden ist, eine Bezeichnung, die auf den ersten Blick suggeriert, die gesellschaftlichen Umbrüche hätten sich unmittelbar um das Jahr 1968 ereignet. Weshalb diese Bewegung unter dem Namen „68er“ in die Geschichtsbücher einging, mag daran liegen, dass zeitgenössiche Beobachter von der Vehemenz der Protestbewegungen, die ab 1967 scheinbar aus dem Nichts entstanden waren, völlig überrascht wurden. Gerade die Studentenschaft galt in den 60er Jahren als angepasst und politisch weitgehend desinteressiert.2 Wie sich im Nachhinein herausstellte, betrachteten solche Sichtweisen nur die Oberfläche. Schönhoven versteht die sechziger Jahre hingegen als „Phase der Gärung […], in der sich eine Fülle von Veränderungsimpulsen wechselseitig verstärkten.“3 Eine der zahlreichen Umbrüche4, die aus diesen Impulsen entstand, sind die Umgestaltungen im Bereich der Medienkultur. Nicht nur in auditiven und/oder audiovisuellen Medien kam es zu einer tiefgreifenden Veränderung, sondern auch im Printjournalismus. Was sich Anfang der 60er Jahre in den USA als „New Journalism“ einen Namen machte, ist die Emanzipation der Presse in sozialer, politischer und kritischer Hinsicht. Die Berichterstattung wandelte sich im Zuge des New Journalism von einem reinen Informationsjournalismus, der die „objektive“ Faktenwiedergabe zum höchsten Ziel hatte, hin zu einer Berichterstattung, in der die subjektive Sicht des Journalisten an Bedeutung gewann. In der Bundesrepublik vollzog sich zeitgleich ein Wandel vom „Konsensjournalismus“ hin zum „Kritischen Journalismus“.56
Dieser Wandel im Printjournalismus der Bundesrepublik Deutschland ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Zur Veranschaulichung wird am Ende dieser Arbeit kurz auf einige Reportagen aus der SZ eingegangen, die den im Folgenden skizzierten Wandel exemplarisch darstellen.7
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vom Konsens zur Kritik
- 1.1. Der Versuch der „Reeducation“ nach Kriegsende
- 1.2. „Teegespräche" und die gemeinsame politische Linie
- 2. Mediale und kulturelle Revolution
- 2.1 Der Aufstieg der „45er“ und ihr Gegenentwurf zum Konsensjournalismus
- 2.2 Der Journalist als gleichberechtigter Partner
- 3. Fazit
- 4. Kriterien für die Auswahl der Analysebeispiele
- 4.1 Auswahl der Zeitung
- 4.2 Auswahl des Themas
- 4.3 Auswahl der journalistischen Darstellungsform
- 5. Unterschiede der Reportagen in Inhalt und Aufbau
- 6. Inhalltliche Zusammenfassungen der Zeitungsartikel
- 6.1 „Im Olymp der SPD-Funktionäre“ vom 10.09.1957
- 6.2,,Pfeffer und Honig aus dem CDU-Labor“ vom 11.09.1957.
- 6.3 „Große Politik im Dorfkrug“ vom 08.09.1961
- 6.4 Mit Charme und Standarte auf Stimmenfang vom 15.09.1961
- 6.5 Der Mann, der Wein und Fragen mag vom 12.09.1969
- 6.6 Viele Verbote - dann ein Verbot vom 24.09.69
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Wandel vom Konsensjournalismus zum Kritischen Journalismus in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert, wie die Entwicklungen im Printjournalismus die gesellschaftlichen Umbrüche der 60er Jahre widerspiegelten und gleichzeitig mitgestalteten. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des Konsensjournalismus im Kontext der „Reeducation“ nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt auf, wie dieser durch den Aufstieg der „45er“-Generation und die kulturellen Veränderungen der 60er Jahre in Frage gestellt wurde.
- Die Entwicklung des Konsensjournalismus in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Rolle der „Reeducation“ und des Gesinnungsjournalismus
- Der Aufstieg der „45er“-Generation und ihr Einfluss auf den Journalismus
- Die kulturellen Umbrüche der 60er Jahre und ihre Auswirkungen auf die Medienlandschaft
- Der Wandel vom Informationsjournalismus zum Kritischen Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Wandel vom Konsensjournalismus zum Kritischen Journalismus in der Bundesrepublik Deutschland in den Kontext der gesellschaftlichen Umbrüche der 60er Jahre. Sie beleuchtet die Entstehung des Konsensjournalismus im Kontext der „Reeducation“ nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt auf, wie dieser durch den Aufstieg der „45er“-Generation und die kulturellen Veränderungen der 60er Jahre in Frage gestellt wurde.
Kapitel 1 beleuchtet die Entstehung des Konsensjournalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird die Rolle der „Reeducation“ und des Gesinnungsjournalismus in der unmittelbaren Nachkriegszeit analysiert. Die Arbeit zeigt auf, wie die Besatzermächte versuchten, den deutschen Journalismus zu demokratisieren und wie dieser Versuch auf der Mikroebene (Redaktionsbesprechungen, Trennung von Nachricht und Kommentar) und auf der Makroebene (Gründung von Verlagshäusern) umgesetzt wurde.
Kapitel 2 analysiert den Aufstieg der „45er“-Generation und ihren Einfluss auf den Journalismus. Es wird gezeigt, wie diese Generation, die durch die Demokratiegründung geprägt war, den Konsensjournalismus in Frage stellte und den Weg für den Kritischen Journalismus ebnete. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Journalismus als gleichberechtigter Partner in der Gesellschaft und die Veränderungen in der Medienkultur der 60er Jahre.
Kapitel 4 beschreibt die Kriterien für die Auswahl der Analysebeispiele. Es werden die Auswahl der Zeitung, des Themas und der journalistischen Darstellungsform erläutert.
Kapitel 5 analysiert die Unterschiede der Reportagen in Inhalt und Aufbau. Es werden die verschiedenen journalistischen Darstellungsformen und ihre Bedeutung für den Wandel vom Konsensjournalismus zum Kritischen Journalismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Konsensjournalismus, den Kritischen Journalismus, die „Reeducation“, den Gesinnungsjournalismus, die „45er“-Generation, die 68er-Bewegung, die Medienkultur, den Informationsjournalismus und die Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklungen im Printjournalismus in der jungen Bundesrepublik und zeigt auf, wie diese die gesellschaftlichen Umbrüche der 60er Jahre widerspiegelten und gleichzeitig mitgestalteten.
Was versteht man unter Konsensjournalismus?
Konsensjournalismus bezeichnet eine Phase in der frühen Bundesrepublik, in der Medien oft eine gemeinsame politische Linie mit der Regierung verfolgten und auf scharfe Kritik verzichteten.
Wer war die "45er-Generation" im Journalismus?
Es handelt sich um Journalisten, die nach dem Krieg durch die demokratische "Reeducation" geprägt wurden und später den Weg für einen kritischeren Journalismus ebneten.
Wie veränderte sich die Berichterstattung in den 1960er Jahren?
Es fand ein Wandel vom reinen Informationsjournalismus hin zu einem subjektiveren, kritischeren Stil statt, ähnlich dem "New Journalism" in den USA.
Welche Rolle spielte die 68er-Bewegung für die Medien?
Die gesellschaftlichen Umbrüche der 68er wurden durch die Emanzipation der Presse vorbereitet und führten zu einer dauerhaften Veränderung der Medienkultur.
Warum ist die Trennung von Nachricht und Kommentar wichtig?
Diese Trennung war ein zentrales Element der demokratischen Presse-Erziehung nach 1945, um den vorherrschenden Gesinnungsjournalismus der NS-Zeit zu überwinden.