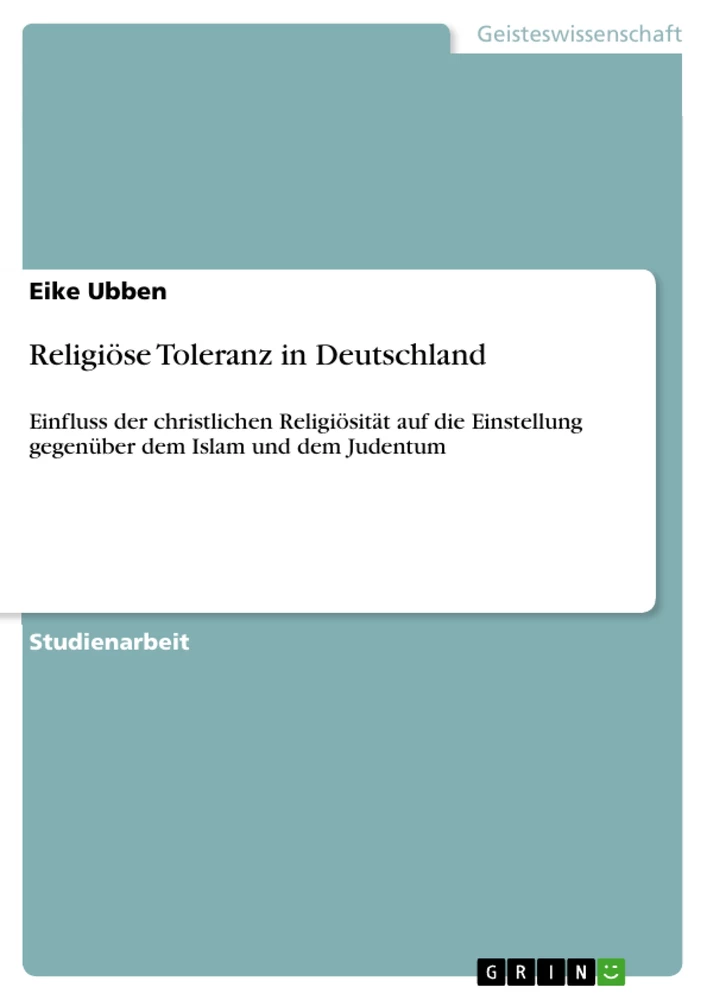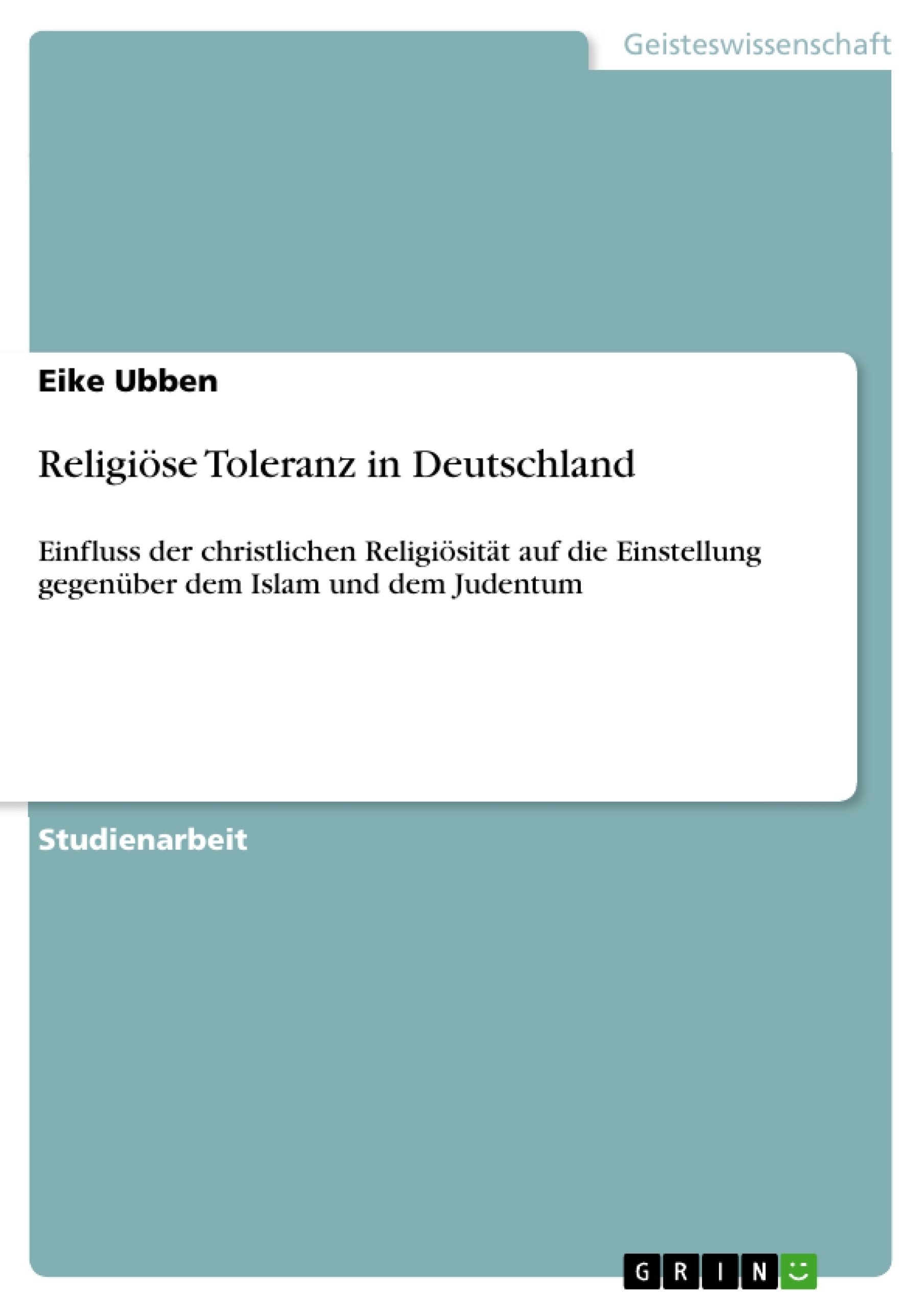Auch 69 Jahre nach Ende des Dritten Reiches und der damit einhergehenden Judenverfolgung gibt es in der deutschen Bevölkerung Ressentiments gegenüber Juden, teils verdeckt, teils aber auch als offener Antisemitismus. Festzuhalten bleibt hier, dass die Form des Antisemitismus sich geändert hat. Anders als früher gibt es heutzutage keine offene Verfolgung mehr, vielmehr werden die Juden allgemein kritisiert, oftmals unter dem Deckmantel der Kritik an der israelischen Politik in Palästina.
Eine erschreckende Entwicklung ist bei der jüngeren Generation zu erkennen, die weder direkt noch indirekt durch die Elterngeneration mit der Judenverfolgung zu tun hatte. Hier wird der Begriff „Jude“ in bestimmten Kreisen mittlerweile als Schimpfwort benutzt, was die Gefahr aufzeigt, dass Antisemitismus wieder bis in die Mitte der Gesellschaft reicht.
Auch die Muslime als größte nichtchristliche Religionsgemeinschaft stoßen in Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung. Während die Ablehnung von Juden aufgrund sozialer Erwünschtheit wie oben genannt oftmals verdeckt abläuft, ist Antiislamismus durch viele Bevölkerungsschichten hinweg zu bemerken. So ziehen unter anderem einige Parteien mit antiislamischen Parolen in den Wahlkampf. Insbesondere wenn in den Nachrichten wieder von Al-Quaida und Terroranschlägen die Rede ist, ist eine Art Generalverdacht gegenüber Moslems zu bemerken.
Andererseits leben wir heute in einem toleranten Deutschland, wo sogar führende Politiker betonen, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Auch gegenüber dem Judentum erklären Politiker jeglicher Couleur immer wieder, dass Israel, und damit die jüdische Glaubensgemeinschaft, Freunde Deutschlands seien. Doch schließen sich der Meinung der Politiker nicht alle Menschen an, mit der NPD hat es eine offen antiislamische und antiisraelische Partei in zwei Landtage geschafft.
Ich will daher in dieser Hausarbeit der Frage nachgehen, inwiefern die Religiosität der Menschen Einfluss hat auf die Einstellung gegenüber Juden und Moslems. Nimmt mit der Religiosität die Toleranz zu, im Sinne von „Liebe deinen Nächsten“? Oder sind religiöse Menschen kritischer gegenüber anderen Religionen, da sie ihre eigene Religion als die einzig Wahre betrachten?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hypothesenableitung und Formulierung
- 3. Datensatz
- 3.1 Beschreibung des Datensatzes
- 3.2 Variablenbeschreibung
- 4. Auswertung
- 4.1 Univariate Auswertung
- 4.2 Multivariate Auswertung
- 4.2.1 Clusteranalyse
- 4.2.2 Regression
- 4.3 Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der Religiosität auf die Einstellung gegenüber Juden und Muslimen in Deutschland. Es wird der Frage nachgegangen, ob eine höhere Religiosität mit größerer Toleranz oder im Gegenteil mit stärkerer Ablehnung anderer Religionen einhergeht.
- Der Einfluss christlicher Religiosität auf die Einstellung gegenüber dem Islam und Judentum.
- Analyse von Antisemitismus und Antiislamismus in der deutschen Bevölkerung.
- Auswertung des ALLBUS-Datensatzes zur Überprüfung von Forschungsfragen.
- Anwendung quantitativer Analyseverfahren (Clusteranalyse und Regression).
- Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Forschungsergebnissen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Antisemitismus und Antiislamismus in Deutschland dar und beleuchtet die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Religiosität auf die Einstellung gegenüber Juden und Muslimen. Sie skizziert die Struktur der Arbeit, die von der Hypothesenformulierung über die Datensatzbeschreibung und Auswertung bis hin zum Fazit reicht. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit, den Zusammenhang zwischen Religiosität und Toleranz bzw. Intoleranz zu untersuchen, da widersprüchliche Beobachtungen existieren (hohe Toleranz im öffentlichen Diskurs vs. Anzeichen von Antisemitismus und Antiislamismus in Teilen der Bevölkerung).
2. Hypothesenableitung und Formulierung: Dieses Kapitel leitet zwei Forschungshypothesen ab, die auf der Literatur, insbesondere auf der Arbeit von Küpper (2010), basieren. Die erste Hypothese postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen Religiosität und antisemitischen Einstellungen. Die zweite Hypothese unterstellt hingegen keinen Einfluss der Religiosität auf antiislamische Einstellungen. Für beide Hypothesen werden entsprechende Nullhypothesen formuliert. Die Herangehensweise an die Hypothesenprüfung wird kurz skizziert und auf die nachfolgende Datenanalyse verwiesen. Der Bezug auf Küpper dient als theoretische Grundlage und liefert einen Ausgangspunkt für die eigene Untersuchung.
3. Datensatz: Dieses Kapitel beschreibt den verwendeten Datensatz, den ALLBUScompact 2012. Es wird die Kompaktversion des ALLBUS erläutert und die Größe des Datensatzes (3480 Befragte, 750 Fragen) genannt. Die Besonderheiten des ALLBUS, wie die repräsentative Stichprobe und die zweijährliche Erhebung mit sowohl konstanten als auch variierenden Fragen, werden hervorgehoben. Die freie Zugänglichkeit des Datensatzes für Forscher wird ebenfalls betont. Die Kapitel erläutert somit die Datenbasis der Studie und ihre methodischen Eigenschaften.
Schlüsselwörter
Religiöse Toleranz, Antisemitismus, Antiislamismus, Religiosität, ALLBUS, Quantitative Analyse, Clusteranalyse, Regression, Deutschland, Einstellungen gegenüber Religionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Einfluss der Religiosität auf Einstellungen gegenüber Juden und Muslimen in Deutschland
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der Religiosität auf die Einstellungen gegenüber Juden und Muslimen in Deutschland. Es wird der Frage nachgegangen, ob eine höhere Religiosität mit größerer Toleranz oder Ablehnung anderer Religionen einhergeht.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich die Religiosität auf die Einstellung gegenüber Juden und Muslimen aus? Konkrete Aspekte sind der Einfluss christlicher Religiosität auf die Einstellung gegenüber Islam und Judentum, die Analyse von Antisemitismus und Antiislamismus in der deutschen Bevölkerung und der Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Forschungsergebnissen.
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Es werden zwei Hypothesen formuliert: Erstens, ein positiver Zusammenhang zwischen Religiosität und antisemitischen Einstellungen. Zweitens, kein Einfluss der Religiosität auf antiislamische Einstellungen. Zu jeder Hypothese wird eine entsprechende Nullhypothese formuliert.
Welcher Datensatz wird verwendet?
Die Analyse basiert auf dem ALLBUScompact 2012, einer repräsentativen Stichprobe von 3480 Befragten mit 750 Fragen. Die Eigenschaften des ALLBUS, wie die repräsentative Stichprobe und die zweijährliche Erhebung, werden detailliert beschrieben.
Welche Methoden werden angewendet?
Es werden quantitative Analyseverfahren angewendet, darunter die univariate und multivariate Auswertung. Im Speziellen werden Clusteranalyse und Regression eingesetzt, um die Forschungsfragen zu beantworten.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hypothesenableitung und -formulierung, Datensatzbeschreibung, Auswertung (univariate und multivariate Analyse mit den Ergebnissen), und Fazit. Die Einleitung stellt die Problematik dar und skizziert den Aufbau. Die Auswertung beschreibt die angewandten Methoden und Ergebnisse. Das Fazit fasst die Erkenntnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Religiöse Toleranz, Antisemitismus, Antiislamismus, Religiosität, ALLBUS, Quantitative Analyse, Clusteranalyse, Regression, Deutschland, Einstellungen gegenüber Religionen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Hausarbeit enthält detaillierte Informationen zu allen Aspekten, einschließlich der einzelnen Kapitelzusammenfassungen und der Literaturangaben.
- Quote paper
- Eike Ubben (Author), 2014, Religiöse Toleranz in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280770