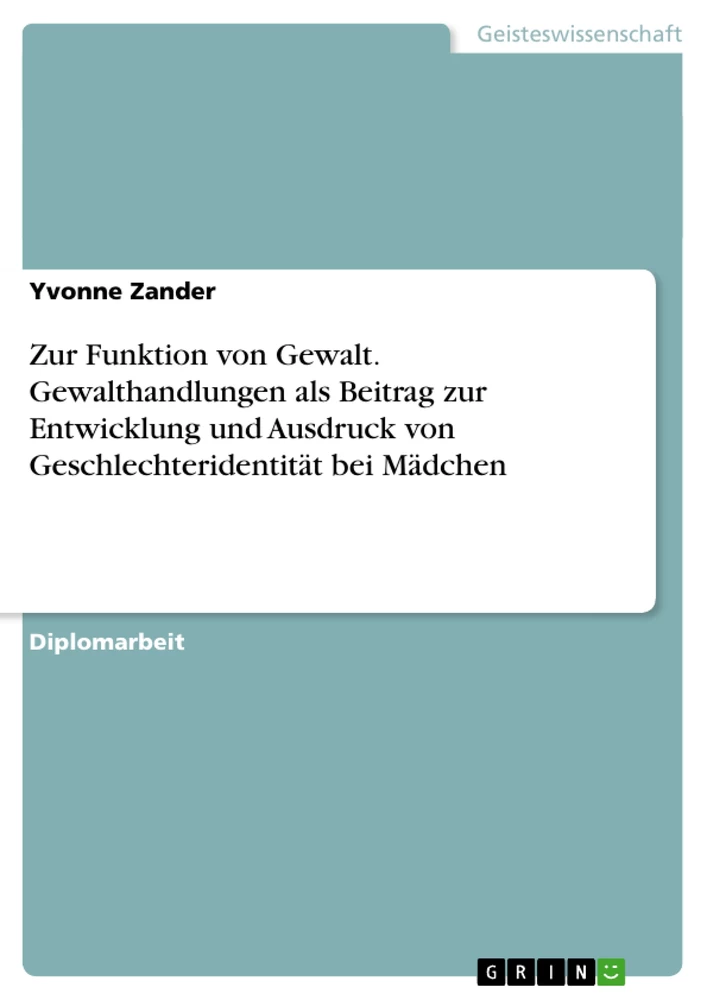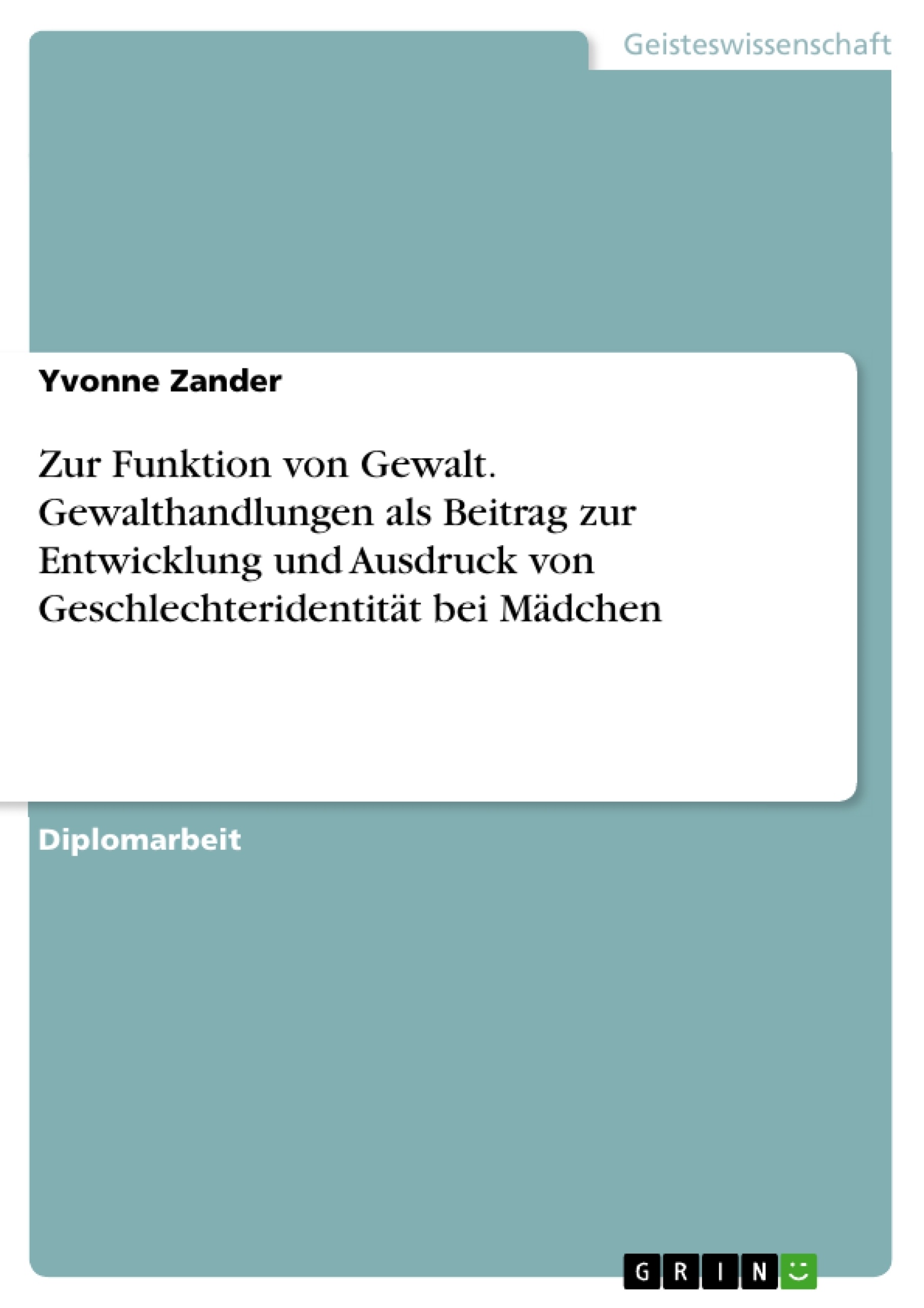Das Thema Jugendgewalt auf die Geschlechter bezogen betrachtet, wirft zunächst Assoziationen des Mädchens als Opfer und des Jungen als Täter hervor. Mädchen gelten als schwach und nicht wehrfähig, während Jungen Fähigkeiten wie Stärke und Mut zugesprochen werden. So werden Jungen von der gängigen Fachliteratur als extrovertiert und Mädchen als introvertiert charakterisiert . Doch gibt es auch Mädchen, welche aggressives Verhalten zeigen, sie schließen körperlich gewalttätige Handlungsstrategien vermehrt in ihr Verhaltensrepertoire ein. Auf dieses Phänomen wird in der letzten Zeit häufiger durch die Medien eingegangen. Das Thema wird gerne überzogen geschildert und die Mädchen als unnormal und unweiblich hingestellt.
Gewalthandlungen von Mädchen und jungen Frauen weichen von dem gesellschaftlichen Bild ihrer Geschlechterrolle ab. Ihnen werden mitfühlendere Fähigkeiten als dem männlichen Geschlecht zugesprochen. So gelten sie als häuslich, sozial engagiert, friedfertig und mütterlich. Anders als Jungen wird es ihnen abgesprochen, sich allzu laut und stürmisch zu benehmen. Reagieren sie in manchen Situationen aggressiv, wird dieses Verhalten als unnatürlich und männlich aufgefasst.
Jugendgewalt ist männlich dominiert. Die Polizeiliche Kriminalstatistik gab für das Jahr 2007 an, dass 87% der jugendlichen Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität dem männlichen Geschlecht angehörten. Durch dieses ungleiche Zahlenverhältnis fallen männliche Gewalttäter stärker auf als weibliche. Jugendgewalt wird also eher als ein Problem der männlichen denn der weiblichen Jugend gesehen. Dadurch treten die weiblichen Täterinnen leicht in den Hintergrund und ihre Motive, Hintergründe und Anlässe, aus denen heraus sie aggressiv reagieren, sind unbekannt.
Doch um die Vielfalt gewaltbereiter Mädchen und jungen Frauen zu erfassen und zu verstehen, bedarf es einer ausführlichen Forschungsreihe und Diskussion, ähnlich der auf männlichem Gebiet. Denn die Hintergründe und Motive ebenso wie die Folgen und Auswirkungen von erfahrener und selbst erteilter Gewalt sind im Geschlechterverhältnis gesehen nicht homogen. Jugendliche nutzen Gewalt in unterschiedlichen Situationen aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zwecken. Diese gilt es aufzudecken und zu verstehen, vor allem wenn es in der sozialpädagogischen Arbeit darum geht, diesen Jugendlichen neue Perspektiven zu ermöglichen und ein Leben ohne Gewalt zu öffnen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Theoretische Einrahmung
- Weibliche Jugend
- Gibt es ,,die weibliche Jugend"?
- Weibliche Identitätsentwicklung
- Weibliche Sozialisation
- Begriffsklärungen: Gewalt und Aggression
- Gewalt, vorhandene Arten und Formen
- Aggression, vorhandene Arten und Formen
- Jugendgewalt ist überwiegend Jungengewalt
- Weibliche Jugend
- Welche Funktionen kann das Ausüben von Gewalt haben?
- Aus psychologischer Perspektive
- Aggression als Triebhandlung
- Aggressionen zum Frustrationsabbau
- Gewaltverhalten als gelerntes Verhalten
- Aus soziologischer Perspektive
- Gewalt als Gruppenstruktur
- Gewalt als Mittel gegen Verunsicherung
- Gewaltanwendung durch Rollenzuschreibung
- Sozialisatorische Erklärungsansätze
- Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz
- Freunde als sekundäre Sozialisationsinstanz
- Medien als sekundäre Sozialisationsinstanz
- Vielfältige Differenzierungen des Sozialisationsprozesses
- Zwischenergebnis
- Aus psychologischer Perspektive
- Aktuelle Forschungssituation
- Ein Forschungsüberblick
- Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik
- Darstellung der aktuellen Forschungssituation
- Ausgewählte Forschungsprojekte
- Das Forschungsprojekt „Biographien gewalttätiger Jugendlicher"
- Mädchen in gewaltbereiten Jugendgruppen
- Psychoanalytischer Diskurs
- Ein Forschungsüberblick
- Geschlechtsspezifische Darstellung der Gewaltanwendung
- Gewaltperzeption von weiblichen Jugendlichen
- Besteht ein Unterschied zu „,männlicher Gewalt"?
- Gewaltbereitschaft von Mädchen im Kontext ihrer Geschlechterrolle
- Doppelte Normabweichung gewaltbereiter Mädchen
- Weibliche Gewaltanwendung - ein Ausdruck moderner Emanzipation?
- Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- Ausblick
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Funktion von Gewalt bei Mädchen und untersucht, inwiefern Gewalthandlungen als Beitrag zur Entwicklung und zum Ausdruck von Geschlechteridentität dienen können. Die Arbeit analysiert die Rolle von Gewalt im Kontext der weiblichen Jugend und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die Mädchen im Umgang mit Gewalt und Aggressionen erleben.
- Die Entwicklung und Herausforderungen der weiblichen Geschlechteridentität
- Die Rolle von Gewalt und Aggression in der Sozialisation von Mädchen
- Die Funktionen von Gewalt im Kontext der weiblichen Identitätsbildung
- Die spezifischen Herausforderungen, die Mädchen im Umgang mit Gewalt erleben
- Die Bedeutung von Forschung und Diskussion über weibliche Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die gängigen Stereotype über weibliche Gewalt. Sie zeigt auf, dass die männliche Dominanz in der Gewaltforschung dazu führt, dass die Motive und Hintergründe weiblicher Gewalttäterinnen oft unbeachtet bleiben.
Das zweite Kapitel bietet eine theoretische Einrahmung des Themas. Es werden die Besonderheiten der weiblichen Jugend, die Entwicklung der weiblichen Identität und die Prozesse der weiblichen Sozialisation beleuchtet. Zudem werden die Begriffe Gewalt und Aggression definiert und verschiedene Arten und Formen von Gewalt sowie die Dominanz männlicher Gewalt in der Jugendkriminalität dargestellt.
Das dritte Kapitel untersucht die möglichen Funktionen von Gewalt aus psychologischer und soziologischer Perspektive. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für Gewaltverhalten vorgestellt, darunter die Triebtheorie, die Frustrationstheorie und die Lerntheorie. Zudem werden die Rolle von Familie, Schule, Freunden und Medien im Sozialisationsprozess und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Gewaltbereitschaft beleuchtet.
Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die aktuelle Forschungssituation zum Thema Jugendgewalt. Es werden die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik analysiert und ausgewählte Forschungsprojekte vorgestellt, die sich mit den Biographien gewalttätiger Jugendlicher, Mädchen in gewaltbereiten Jugendgruppen und dem psychoanalytischen Diskurs über weibliche Gewalt befassen.
Das fünfte Kapitel widmet sich der geschlechtsspezifischen Darstellung der Gewaltanwendung. Es untersucht die Gewaltperzeption von weiblichen Jugendlichen und die Frage, ob es einen Unterschied zu „männlicher Gewalt" gibt. Zudem wird die Gewaltbereitschaft von Mädchen im Kontext ihrer Geschlechterrolle beleuchtet und die Problematik der „doppelten Normabweichung" gewaltbereiter Mädchen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Funktion von Gewalt, Gewalthandlungen, Geschlechteridentität, weibliche Jugend, Sozialisation, Aggression, Jugendgewalt, Forschung, weibliche Gewalt, Geschlechterrolle, Emanzipation und Normabweichung. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Gewalt in der Entwicklung und dem Ausdruck von Geschlechteridentität bei Mädchen und untersucht die spezifischen Herausforderungen, die Mädchen im Umgang mit Gewalt und Aggressionen erleben.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat Gewalt bei Mädchen?
Gewalt kann für Mädchen ein Mittel zum Frustrationsabbau, ein Beitrag zur Identitätsentwicklung oder ein Werkzeug zur Positionierung innerhalb einer Gruppe sein.
Warum wird weibliche Gewalt oft als "unweiblich" wahrgenommen?
Weil sie dem gesellschaftlichen Bild der friedfertigen, mütterlichen Frau widerspricht; aggressives Verhalten wird daher oft als männlich oder unnatürlich stigmatisiert.
Wie hoch ist der Anteil weiblicher Tatverdächtiger bei Gewaltkriminalität?
Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik von 2007 waren 87% der jugendlichen Tatverdächtigen männlich, wodurch weibliche Täterinnen statistisch weniger auffallen.
Welche Rolle spielt die Sozialisation in der Familie?
Die Familie ist die primäre Sozialisationsinstanz; erfahrene Gewalt oder Rollenzuschreibungen in der Kindheit können die spätere Gewaltbereitschaft maßgeblich beeinflussen.
Ist weibliche Gewalt ein Ausdruck moderner Emanzipation?
Die Arbeit diskutiert, ob die Zunahme weiblicher Gewalt mit der Aneignung männlicher Verhaltensmuster im Zuge der Emanzipation zusammenhängt.
- Citation du texte
- Yvonne Zander (Auteur), 2009, Zur Funktion von Gewalt. Gewalthandlungen als Beitrag zur Entwicklung und Ausdruck von Geschlechteridentität bei Mädchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280817