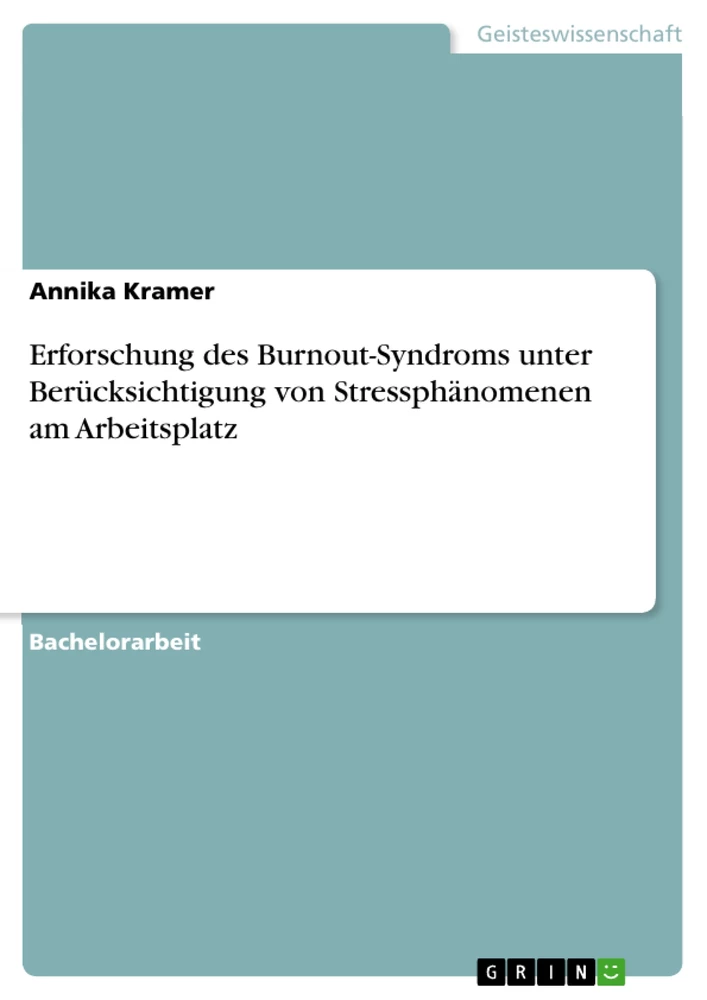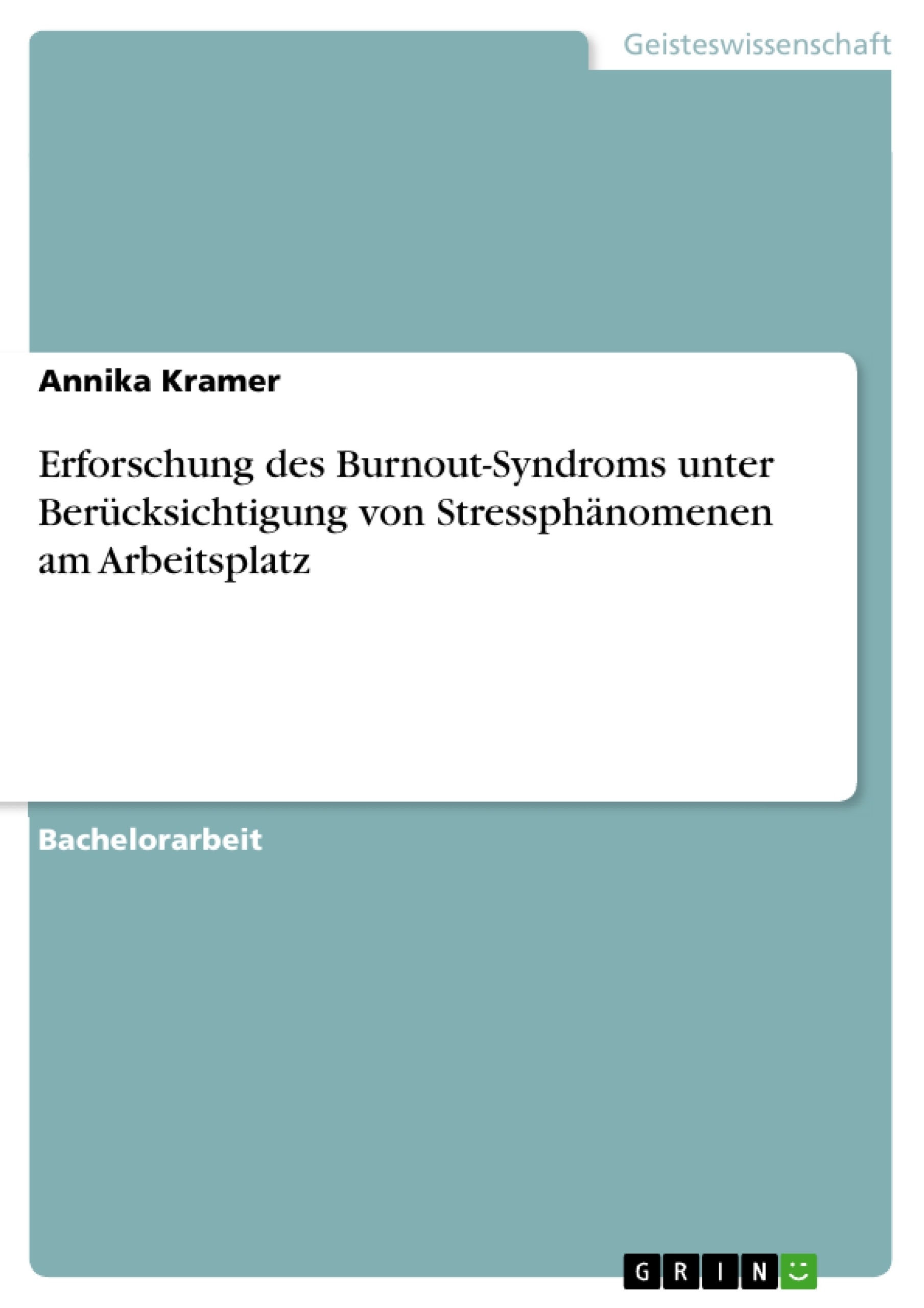Die Begriffe „Burnout“ und „Stress“ sind insbesondere im Arbeitsalltag zu Schlagwörtern geworden. Immer häufiger kommt es dadurch zu Personalausfällen. Viele Menschen sind gar nicht mehr in der Lage, sich zu regenerieren und werden aus ihren beruflichen und sozialen Gefügen geworfen.
Relevant ist das Thema Burnout aufgrund von langwierigen und auch kostenintensiven Folgen für Unternehmen, Behörden, Krankenkassen und letztlich für die gesamte Gesellschaft. In den letzten Jahren ist die Zahl der Krankheitstage aufgrund von psychischer Krankheit, insbesondere von Burnout stark angestiegen. Die Techniker Krankenkasse hat ermittelt, dass „jährlich rund 40 000 Arbeitskräfte wegen einer mit Burnout assoziierten Erkrankung an ihrem Arbeitsplatz fehlen“.
Die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung sind zunehmend den stagnierenden, sogar knapper werdenden finanziellen Ressourcen ausgesetzt und können den ständig steigenden Arbeitsanforderungen nicht mehr standhalten. Durch organisationsbedingten Druck auf die Mitarbeiter ist es nicht verwunderlich, dass diese verstärkt Symptome des Burnout-Syndroms zeigen. Trotz der drastischen Zunahme von psychischen Krankheiten in Deutschland weiß man in vielen Betrieben und Verwaltungen noch sehr wenig über die Ursachen des Burnout-Syndroms und mögliche Präventionsmaßnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stress am Arbeitsplatz
- 2.1 Entstehung und Begriffsbestimmung
- 2.2 Gefährdete Berufsgruppen
- 2.3 Stressoren am Arbeitsplatz
- 2.4 Stressreaktionen
- 3. Was ist Burnout?
- 3.1 Entstehung und Begriffsbestimmung
- 3.2 Gefährdete Berufsgruppen
- 3.3 Phasen und Symptomatik
- 3.4 Auswirkungen auf die Gesundheit
- 3.5 Wissenschaftliche Ursachenmodelle
- 3.5.1 Persönlichkeitszentrierter Erklärungsansatz
- 3.5.2 Sozial-, arbeits- und organisationspsychologischer Erklärungsansatz
- 3.5.3 Soziologisch geprägter Erklärungsansatz
- 4. Umgang mit Betroffenen in der öffentlichen Verwaltung
- 4.1 Interview mit dem Sozialen Ansprechpartner der Stadt ***
- 4.2 Auswertung des Interviews
- 5. Behandlungs- und Präventionsansätze von Burnout
- 5.1 Behandlungsmöglichkeiten
- 5.2 Individuelle, personenbezogene Vorbeugung
- 5.2.1 Stärkung der individuellen Ressourcen
- 5.2.2 Stressbewältigung
- 5.2.2.1 Kurzfristige Stressbewältigungsmaßnahmen
- 5.2.2.2 Langfristige Stressbewältigungsmaßnahmen
- 5.3 Vorbeugung am Arbeitsplatz
- 5.3.1 Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 5.3.2 Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der Vorzeigekommune Dortmund
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Burnout-Syndrom im Kontext von Stress am Arbeitsplatz, insbesondere im öffentlichen Verwaltungsdienst. Ziel ist es, die Relevanz des Burnout-Syndroms in diesem Bereich zu belegen und Ursachen sowie Präventions- und Behandlungsansätze zu analysieren.
- Stress am Arbeitsplatz als Auslöser für Burnout
- Ursachen des Burnout-Syndroms auf individueller und organisationaler Ebene
- Auswirkungen von Burnout auf die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit
- Präventionsstrategien auf individueller und betrieblicher Ebene
- Der Umgang mit Betroffenen in der öffentlichen Verwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik Burnout und Stress am Arbeitsplatz ein und hebt die zunehmende Relevanz dieser Problematik, insbesondere im öffentlichen Dienst, hervor. Sie benennt die steigenden Krankheitskosten und Personalausfälle als Folge und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit: die Relevanz von Burnout im öffentlichen Dienst, die Faktoren, die zum Ausbrennen führen, und die Untersuchung des Umgangs mit Betroffenen sowie die Möglichkeiten der Prävention.
2. Stress am Arbeitsplatz: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Definition von Stress, differenziert zwischen Eustress und Disstress und beschreibt die hohe Belastung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst durch lange Arbeitszeiten und erhöhten Leistungsdruck. Es wird auf die Auswirkungen dieser Belastungssituation auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten eingegangen.
3. Was ist Burnout?: Dieses Kapitel definiert das Burnout-Syndrom, beschreibt betroffene Berufsgruppen, die Phasen und Symptomatik des Burnout, seine gesundheitlichen Auswirkungen und beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze (persönlichkeitszentriert, sozial- und organisationspsychologisch sowie soziologisch), um die komplexen Ursachen des Syndroms zu verstehen.
4. Umgang mit Betroffenen in der öffentlichen Verwaltung: Dieses Kapitel analysiert den Umgang mit von Burnout betroffenen Mitarbeitern im öffentlichen Dienst anhand eines Interviews mit einem Sozialen Ansprechpartner. Die Auswertung des Interviews soll Aufschluss über die praktische Bewältigung der Problematik in einer öffentlichen Verwaltung geben.
5. Behandlungs- und Präventionsansätze von Burnout: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für Burnout und fokussiert sich auf individuelle und betriebliche Präventionsmaßnahmen. Es werden Strategien zur Stärkung individueller Ressourcen, Stressbewältigungstechniken und die Rolle des betrieblichen Gesundheitsmanagements detailliert erörtert, inklusive eines Beispiels aus Dortmund.
Schlüsselwörter
Burnout-Syndrom, Stress am Arbeitsplatz, öffentliche Verwaltung, Prävention, Behandlung, Stressbewältigung, betriebliches Gesundheitsmanagement, individuelle Ressourcen, Gesundheit, Arbeitsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Burnout-Syndrom im öffentlichen Dienst
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Burnout-Syndrom im Kontext von Stress am Arbeitsplatz, insbesondere im öffentlichen Dienst. Sie analysiert die Relevanz des Burnout-Syndroms, seine Ursachen auf individueller und organisationaler Ebene, die Auswirkungen auf Gesundheit und Arbeitsfähigkeit sowie Präventions- und Behandlungsansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Stress am Arbeitsplatz als Auslöser für Burnout, Ursachen des Burnout-Syndroms (individuell und organisational), Auswirkungen von Burnout auf Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, Präventionsstrategien (individuell und betrieblich), und den Umgang mit Betroffenen in der öffentlichen Verwaltung. Es werden verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze zum Burnout-Syndrom beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Stress am Arbeitsplatz, Was ist Burnout?, Umgang mit Betroffenen in der öffentlichen Verwaltung, Behandlungs- und Präventionsansätze von Burnout und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Burnout-Syndroms und des Umgangs damit im öffentlichen Dienst.
Wie wird der Umgang mit Betroffenen im öffentlichen Dienst dargestellt?
Der Umgang mit Betroffenen wird anhand eines Interviews mit einem Sozialen Ansprechpartner einer Stadtverwaltung analysiert und ausgewertet. Diese Analyse soll Aufschluss über die praktische Bewältigung der Problematik in einer öffentlichen Verwaltung geben.
Welche Präventions- und Behandlungsansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für Burnout und fokussiert sich auf individuelle und betriebliche Präventionsmaßnahmen. Es werden Strategien zur Stärkung individueller Ressourcen, Stressbewältigungstechniken (kurz- und langfristig) und die Rolle des betrieblichen Gesundheitsmanagements (am Beispiel Dortmund) detailliert erörtert.
Welche wissenschaftlichen Erklärungsansätze zum Burnout werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze zum Burnout-Syndrom: einen persönlichkeitszentrierten Ansatz, einen sozial-, arbeits- und organisationspsychologischen Ansatz sowie einen soziologisch geprägten Ansatz. Diese Ansätze sollen die komplexen Ursachen des Syndroms umfassender verstehen helfen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für die Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Burnout-Syndrom, Stress am Arbeitsplatz, öffentliche Verwaltung, Prävention, Behandlung, Stressbewältigung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Individuelle Ressourcen, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Relevanz des Burnout-Syndroms im öffentlichen Dienst zu belegen, Ursachen zu analysieren und Präventions- sowie Behandlungsansätze zu untersuchen. Sie soll einen Beitrag zum Verständnis und zur Bewältigung dieser Problematik leisten.
- Quote paper
- Annika Kramer (Author), 2014, Erforschung des Burnout-Syndroms unter Berücksichtigung von Stressphänomenen am Arbeitsplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280818