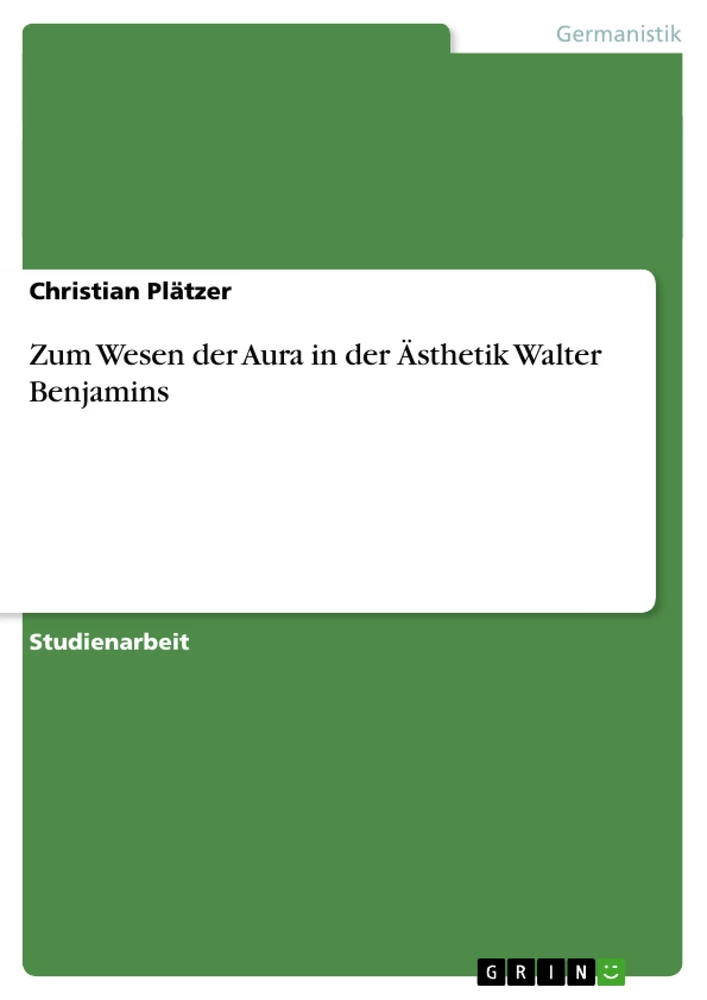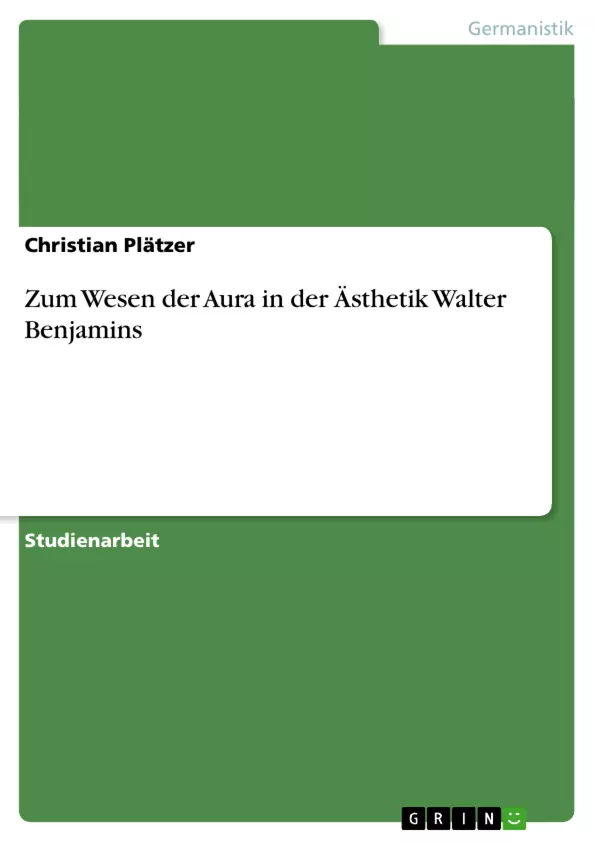Einleitung
Die Drogenexperimente Walter Benjamins fallen in den Zeitraum von 1927 bis 1934. Den Anstoß dazu bekam er von seinen beiden Freunden, den Ärzten Ernst Joel und Fritz Fraenkel, die ihn als Versuchsperson für ihre entsprechenden medizinischen Untersuchungen warben. Benjamins Experimente mit Haschisch und Opium, später auch Meskalin, dürfen nicht als Flucht vor der Realität in den Rausch mißverstanden werden. Im Gegenteil wurden die Versuche äußerst ernsthaft und zumeist unter ärztlicher Beobachtung durchgeführt. Benjamin nutzte den Rausch als Grenzbereich menschlichen Wahrnehmungsvermögens zur Inspiration für seine intellektuellen Arbeiten. Ziel der Versuche blieb immer der reinfiltrierte intellektuale Ertrag1. Die Texte, die er noch in derselben Nacht oder am Tag nach dem Rausch niederschrieb, ermöglichen uns so "einen Blick in das Laboratorium seiner Gedanken"2. Dies ist umso aufschlußreicher für die Deutung von Benjamins philosophischen Arbeiten, da diese durch verschiedene Parallelen in engem Zusammenhang mit seinen Rauscherfahrungen stehen. So erhielten auch Benjamins Überlegungen zur auratischen Wahrnehmung entscheidende Impulse im Drogenrausch3. Aura ist einer der zentralen Begriffe, die sich kontinuierlich durch sein Werk während des letzten Jahrzehnts seines Lebens ziehen. Der Terminus ist konstitutiv für Walter Benjamins ästhetische Theorie und wird dadurch nach seiner Verwendung in Medizin, Theosophie, Parapsychologie und in der Kabbala, erstmals zu einem philosophischen Begriff. Der Entdeckung der Aura im Rausch folgte bereits wenige Zeit später die Beobachtung ihres Verfalls durch die Möglichkeit der technischen Reproduktion des Kunstwerks in der Moderne. Die verschiedenen Beschreibungen der Aura, die sich im Werk Benjamins während der 30er Jahre finden lassen, führten in der Forschung vielfach dazu, darin einen Wandel der Vorstellung an sich zu sehen. Das Phänomen selbst läßt sich aus den Drogentexten allein nicht hinreichend erschließen. Die betreffenden Stellen sind Aufzeichnungen aus Rauschzuständen und verzeichnen meist dunkel und fragmentarisch Gedankengänge, die "nüchternen" Überlegungen nur schwer zugänglich sind. Unter Rückgriff auf die wesentlich konkreteren Beschreibungen im Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" werden die Texte plastischer.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ästhetikbegriff Benjamins
- Auratische Erfahrung in der Kunstrezeption
- Der Verlust der Aura durch die technische Reproduktion des Kunstwerks
- Auratische Wahrnehmung unter Drogeneinfluß - zur Ästhetik des Rauschs
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Wesen der Aura in der Ästhetik Walter Benjamins, insbesondere im Kontext seiner Rauscherfahrungen und seiner Überlegungen zur technischen Reproduktion des Kunstwerks. Sie beleuchtet die Entwicklung des Aura-Begriffs in Benjamins Werk und zeigt auf, wie seine Erfahrungen mit Drogen die Wahrnehmung des Ästhetischen beeinflussten.
- Die Bedeutung der Aura für die ästhetische Theorie Benjamins
- Der Wandel der Aura in der Moderne durch die technische Reproduktion
- Die Rolle des Rauschs als Quelle auratischer Wahrnehmung
- Die Verbindung von Aura, Kunstwerk und Kultwert
- Die Bedeutung der kontemplativen Rezeption für die auratische Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Walter Benjamins Drogenexperimente und deren Bedeutung für seine intellektuellen Arbeiten vor. Sie betont den Zusammenhang zwischen den Rauscherfahrungen und seinen Überlegungen zur Aura.
- Der Ästhetikbegriff Benjamins: Dieses Kapitel erläutert Benjamins Verständnis von Ästhetik als Theorie der Wahrnehmung und zeigt auf, wie sich dieser Begriff im Kontext der modernen technologischen Entwicklungen wandelt.
- Auratische Erfahrung in der Kunstrezeption: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Aura-Begriffs für Benjamins ästhetische Theorie und untersucht die traditionellen Formen der auratischen Wahrnehmung.
- Der Verlust der Aura durch die technische Reproduktion des Kunstwerks: Dieses Kapitel behandelt Benjamins Argumentation, dass die technische Reproduktion des Kunstwerks den Verfall der Aura bewirkt.
- Auratische Wahrnehmung unter Drogeneinfluß - zur Ästhetik des Rauschs: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Rauschs bei der auratischen Wahrnehmung und zeigt auf, wie Drogen die Wahrnehmung des Ästhetischen verändern können.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen der Aura, der Ästhetik, der technischen Reproduktion, der Rauscherfahrung und der kontemplativen Rezeption in Walter Benjamins Werk. Sie beleuchtet, wie die Aura als ein mystifizierendes Element des Kunstwerks im Kontext der Moderne und durch die technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts an Bedeutung verloren hat.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Walter Benjamin unter der „Aura“?
Die Aura ist die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“ – das Gefühl von Echtheit und Einzigartigkeit eines Original-Kunstwerks.
Warum verfällt die Aura in der Moderne?
Durch die technische Reproduzierbarkeit (z. B. Fotografie, Film) verliert das Kunstwerk seine Einmaligkeit und seinen Kultwert im Vergleich zum Ausstellungswert.
Welchen Einfluss hatten Drogen auf Benjamins Theorie?
Benjamin nutzte kontrollierte Experimente mit Haschisch und Opium als „Laboratorium der Gedanken“, um Grenzbereiche der Wahrnehmung und auratische Erfahrungen zu untersuchen.
Was ist der Unterschied zwischen Kultwert und Ausstellungswert?
Der Kultwert basiert auf der religiösen oder rituellen Bedeutung eines Werks; der Ausstellungswert auf seiner Sichtbarkeit für eine breite Masse.
Warum ist kontemplative Rezeption wichtig für die Aura?
Das Versinken im Kunstwerk (Kontemplation) ermöglicht die auratische Erfahrung, die durch die moderne Zerstreuung (z. B. im Kino) verdrängt wird.
- Citation du texte
- Christian Plätzer (Auteur), 1995, Zum Wesen der Aura in der Ästhetik Walter Benjamins, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28081