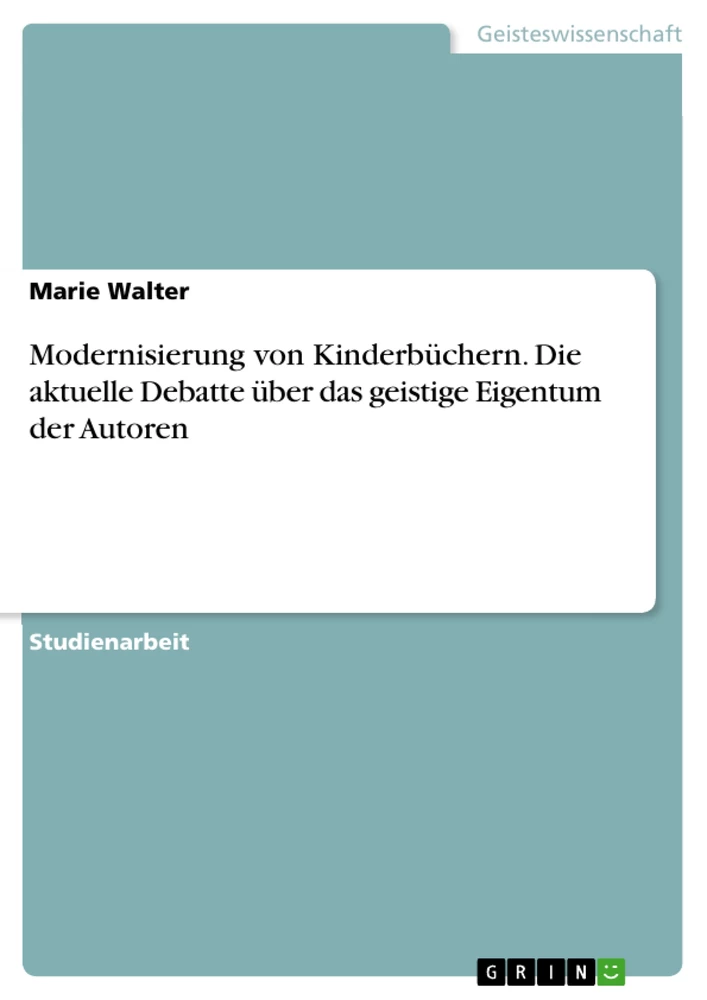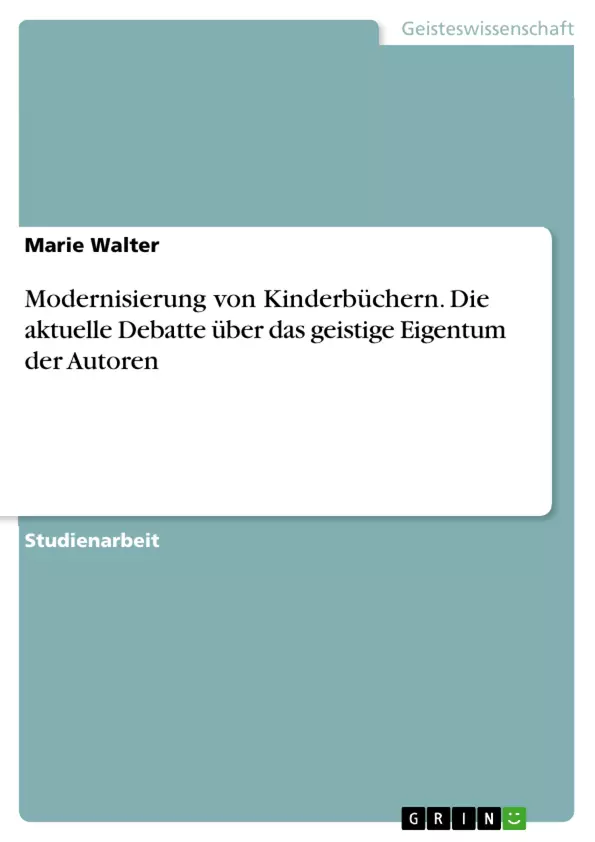Bekannte deutsche Verlage haben angekündigt, ihre Kinderbuch-Klassiker zu überarbeiten. Formulierungen, die als rassistisch empfunden werden, sollen durch neutrale Begriffe ersetzt werden.
So will der Thienemann Verlag die veröffentlichten Bücher von Michael Ende und Otfried Preußler überarbeiten. Veraltete und politisch nicht mehr korrekte Begrifflichkeiten sollen ersetzt werden.
Auch das seit Jahrzehnten wohl beliebteste Kinderbuch Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren überarbeitete die Oetinger Verlagsgruppe abermals.
Der Stein des Anstoßes sind Wörter wie „Neger“ und „Zigeuner“ sowohl bei Lindgren als auch bei etlichen anderen Kinderbüchern.
Somit wurden schon im Jahre 2009 eben diese Wörter aus Lindgrens Werk gestrichen. Die Folge, aus Pippis Vater dem „Negerkönig“ wurde der „Südseekönig“. Soweit so gut, doch nun werden einzelne Stimmen laut, die alten, nicht überarbeiteten Exemplare aus Bibliotheken auszusortieren.
Ist dieses Vorgehen ein längst notwendiger Schritt oder liegt hier Fälschung oder Zensur vor? Wird durch die politische Korrektheit die Vergangenheit umgeschrieben oder gar verschwiegen?
Diese Hausarbeit soll einen Einblick in die aktuelle Debatte über die Modernisierung der Kinderbücher geben.
- Arbeit zitieren
- Marie Walter (Autor:in), 2013, Modernisierung von Kinderbüchern. Die aktuelle Debatte über das geistige Eigentum der Autoren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280824