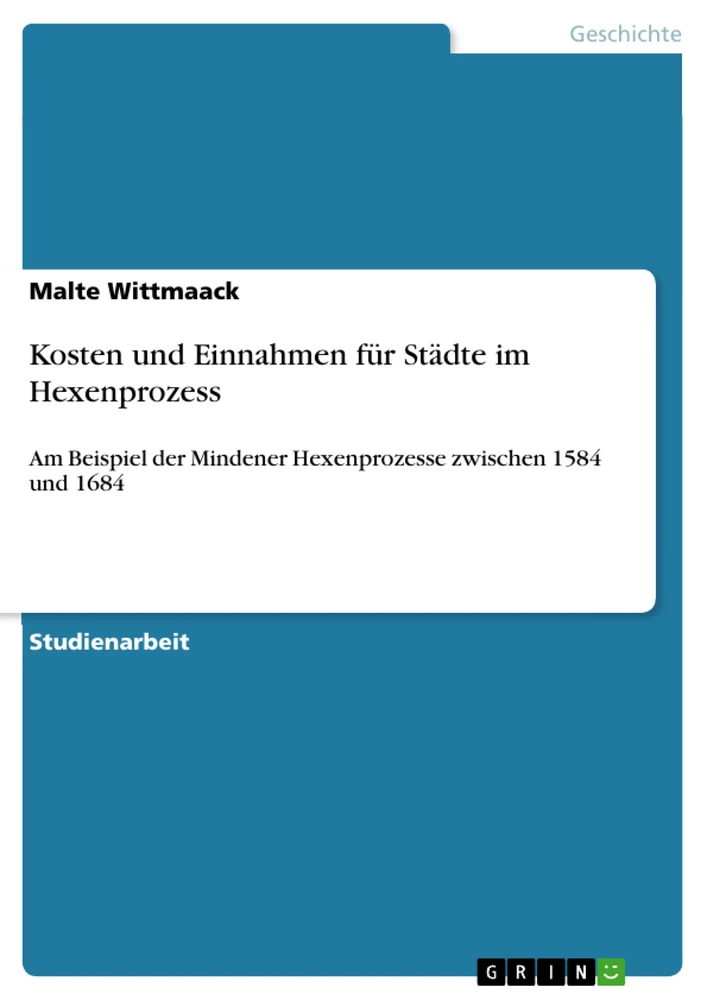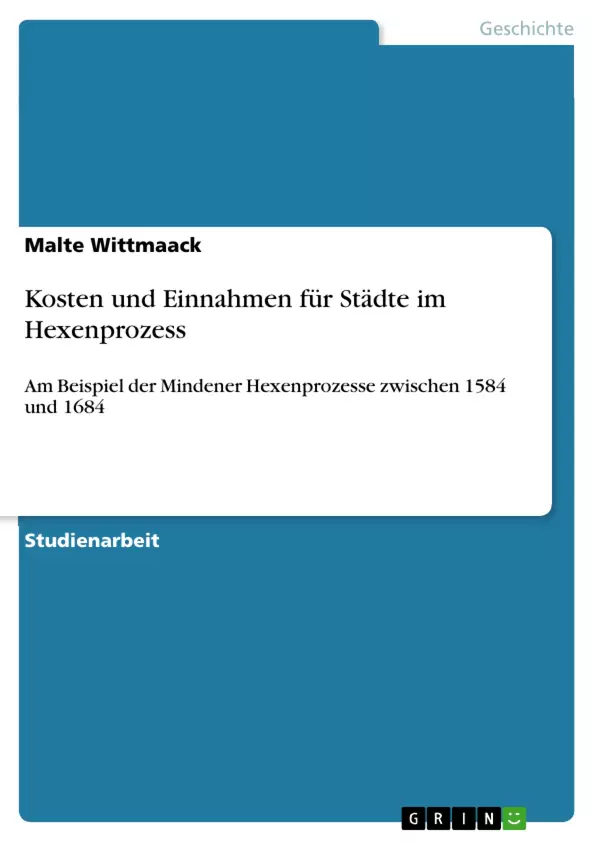In Minden wurde in der Zeit von 1584 bis in das Jahr 1684 gegen insgesamt 170 Personen wegen Hexerei ermittelt. In 132 Fällen führten die eingeleiteten Ermittlungen zur Erhebung einer Anklage und somit zu einem Hexenprozess vor dem Ratsgericht der Stadt. Die Akten zu diesen Ermittlungen beziehungsweise Prozessen sind im Kommunalarchiv Minden zugänglich. In dieser Arbeit soll es jedoch nicht um die Hexenprozesse im Allgemeinen gehen, sondern es soll der Frage nach dem finanziellen Aspekt eines Hexenprozesses nachgegangen werden. Hierzu wird der Prozess gegen die Rockemansche von 16694 herangezogen. Die Umstände dieses Prozesses werden zum Großteil aus der Monographie von Barbara Groß rekonstruiert, da für eine vollständige Zusammenfassung aus den Akten der Umfang dieser Arbeit nicht ausreicht. Es soll hier exemplarisch eine Auseinandersetzung mit der Rechnung oder, wie in der Akte bezeichnet, mit dem „Behgleichnis der Unkosten“ zu diesem Prozess stattfinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit
- Verfolgung und deren Intensität in Minden
- Der Verlauf der Verfolgung 1584-1684 und politische Rahmenbedingungen
- Beteiligte an einem Hexenprozess in der Stadt Minden
- Fallstudie
- Der Hexenprozess gegen die Rockemannsche 1669
- Beginn und Verlauf des Prozesses
- Urteil und Prozesskosten
- Hexenprozesse als potentielle Einnahmequelle für die Stadt
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den finanziellen Aspekt von Hexenprozessen im 16. und 17. Jahrhundert anhand der Mindener Hexenprozesse. Sie analysiert, welche Kosten bei einem Hexenprozess anfielen, welche Beteiligten davon profitierten und ob sich mit diesen Prozessen langfristig Geld für die Stadt verdienen ließ. Die Arbeit zielt auf ein tieferes Verständnis der Rolle von Hexenprozessen im städtischen Kontext und auf die Klärung ihrer Einordnung im frühneuzeitlichen Rechtssystem.
- Finanzielle Aspekte von Hexenprozessen
- Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit Hexenprozessen
- Rolle von Hexenprozessen im städtischen Umfeld
- Einordnung von Hexenprozessen im frühneuzeitlichen Rechtssystem
- Rekonstruktion der Prozesse anhand von Aktenmaterial und Sekundärliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund der Hexenverfolgung und die spezifische Situation in Minden dar. Sie präsentiert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit.
- Kapitel 2 beleuchtet den historischen Kontext der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Es analysiert die Entstehung des Hexereibegriffs und die Rolle der Dämonologie.
- Kapitel 3 untersucht die Hexenverfolgung in Minden. Es beschreibt den zeitlichen Verlauf der Prozesse und die politischen Rahmenbedingungen. Zudem werden die Beteiligten an einem Hexenprozess vorgestellt.
- Kapitel 4 analysiert den Hexenprozess gegen die Rockemannsche von 1669 als Fallstudie. Es untersucht den Beginn und Verlauf des Prozesses sowie das Urteil und die Prozesskosten.
- Kapitel 5 diskutiert die Frage, ob Hexenprozesse für die Stadt Minden eine Einnahmequelle darstellten.
Schlüsselwörter
Hexenprozess, Hexenverfolgung, Frühe Neuzeit, Stadt Minden, Kosten, Einnahmen, Rechtssystem, Dämonologie, Teufelspakt, Fallstudie, Kommunalarchiv Minden, Barbara Groß, Michael Ströhmer, Gerhard Schormann
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Hexenprozesse gab es in Minden?
Zwischen 1584 und 1684 wurde in Minden gegen insgesamt 170 Personen wegen Hexerei ermittelt, was in 132 Fällen zu einer Anklage vor dem Ratsgericht führte.
Wer war die "Rockemansche" und warum ist ihr Fall wichtig?
Gretke Rockemann war eine Angeklagte in einem Hexenprozess von 1669. Ihr Fall dient in dieser Arbeit als Fallstudie, um die konkreten "Unkosten" und finanziellen Abrechnungen eines solchen Prozesses zu analysieren.
Waren Hexenprozesse eine Einnahmequelle für die Städte?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die Stadt Minden durch die Einziehung von Vermögen und Prozessgebühren langfristig Gewinne erzielte oder ob die hohen Kosten für Wachen, Folter und Hinrichtung die Einnahmen überstiegen.
Welche Kosten fielen bei einem Hexenprozess an?
Zu den Kosten gehörten Gebühren für den Scharfrichter, Kosten für die Inhaftierung und Verpflegung der Angeklagten, Schreibgebühren für die Akten sowie Entschädigungen für Zeugen und Gutachter.
Woher stammen die Informationen über die Mindener Prozesse?
Die Daten basieren auf Originalakten aus dem Kommunalarchiv Minden sowie auf wissenschaftlichen Monographien, unter anderem von Barbara Groß und Michael Ströhmer.
Welche Rolle spielte die Dämonologie in diesen Prozessen?
Die Dämonologie lieferte die rechtliche und theologische Basis für die Verfolgung, indem sie Konzepte wie den Teufelspakt und die Hexenbuhlschaft definierte, die dann in den Verhören als Beweise gesucht wurden.
- Quote paper
- Malte Wittmaack (Author), 2014, Kosten und Einnahmen für Städte im Hexenprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280953