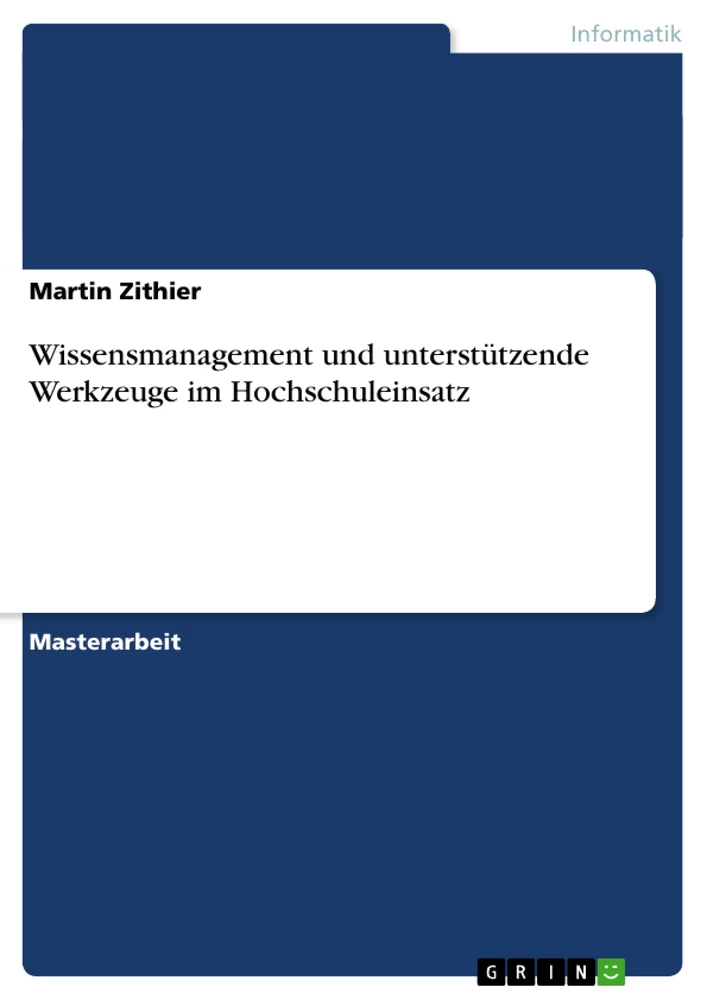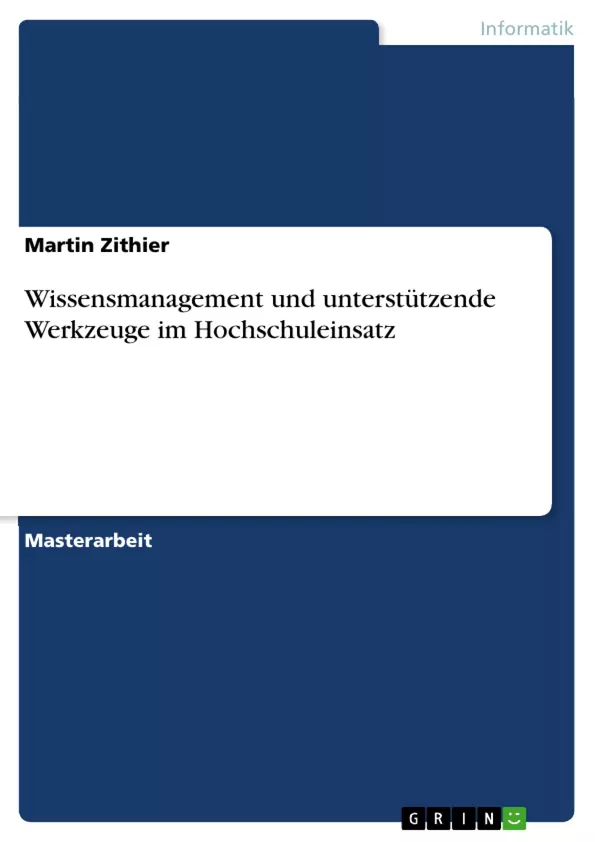„Wissen ist Macht.“
Dieses, dem Philosophen Francis Bacon (1561-1626) zugeschriebene, Zitat aus dem 16. Jahrhundert beweist auch heute noch – vielleicht mehr denn je – seine Gültigkeit (SCHNECKENBURGER 2005, 1).
In unserer heutigen Wissensgesellschaft hat sich Wissen neben Kapital, Boden und Arbeit als Produktionsfaktor längst etabliert (DRUCKER 1997, 18). Viele Unternehmen haben den Stellenwert dieser Form von ökonomischer Macht erkannt und setzen Wissensmanagementlösungen ein. Sie verfolgen damit das Ziel, das Wissen ihrer Mitarbeit und der Organisation zu bündeln, strukturieren und in Wettbewerbsvorteile umzusetzen (PFIFFNER & STADELMANN 1995, 1 & PROBST, RAUB & ROMHARDT 2003, 3). In jüngster Zeit wurde die steigende Bedeutung von Informationen und Wissen im unternehmerischen Kontext deutlich. Der Fokus vieler Unternehmen richtete sich im Rahmen von Hypes und Schlagworten wie Enterprise 2.0, Big Data oder Industrie 4.0 stärker auf die Bearbeitung immer größer werdender Datenmengen und die kollaborative Zusammenarbeit an gemeinsamen Inhalten (BACK, GRONAU & TOCHTERMANN 2009, 6, BITKOM 2014, 17 & HOFFMANN & VOSS 2013, 30).
Nicht nur die Dokumentation, Strukturierung und Speicherung, sondern auch der Transfer von Wissen nimmt seit langer Zeit eine wichtige Rolle in ökonomischen Bereichen ein. Im Mittelalter und in der vorindustriellen Zeit wurde berufliches Fach-wissen innerhalb von Familien und Zünften übertragen (ERLACH, ORIANS & REISACH 2013, 1). So erlernte bspw. Johannes Andreas Eisenbarth seine Künste durch eine zehnjährige Lehre bei seinem Schwager, dem Arzt, Okulisten, Bruch- und Steinschneider Alexander Biller, bevor er selbst landesweiten Ruhm als Wunderarzt erlangte (POHL 1982, 31). Die Industrialisierung und der spätere Wandel über die Informations- bis hin zur Wissensgesellschaft änderten Berufsbilder sowie die Anforderungen und Möglich-keiten der Wissensweitergabe. Die Übertragung impliziten Fachwissens, das vorher durch jahrelanges Beobachten und Nachahmen zwischen Meister und Lehrling übertragen wurde, stellte neue Herausforderungen an die moderne Gesellschaft: Aufgrund fortwährender Erweiterung unternehmerischer Informationsbasen und Expertenfluktuation mussten Wissensmanagementlösungen entwickelt werden, um Fachwissen innerhalb der Organisationen zu bewahren und weiterzugeben (ERLACH, ORIANS & REISACH 2013, 1f.). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Wissen: Daten, Informationen und deren Stellenwert für Organisationen
- Begriffliche Grundlagen
- Entstehung von Wissen
- Begriffshierarchie
- Daten-Information-Wissen-Modell
- Wissenstreppe
- Wissensarten
- Wissensträger
- Organisationale Wissensbasis
- Wissen in der Wertschöpfung
- Wissen in Organisationen
- Wissenslebenszyklus
- Organisationale Intelligenz
- Organisationales Vergessen
- Wissensmanagement: Vom personengebundenen Wissen zur kollaborativen Wissensgemeinschaft
- Grundlagen
- Entwicklungsgeschichte
- Begriffsdefinition
- Informationsmanagement und Wissensmanagement
- Ausgewählte Wissensmanagement-Modelle
- SECI-Modell
- Bausteine des Wissensmanagement
- Informationstechnologie und Wissensmanagement
- Die Rolle der Informatik im Wissensmanagement
- Systematik IT-unterstützter Wissensmanagementsysteme
- Wissenstransfer durch IT-unterstützte Wissensmanagementsysteme
- Stellenwert von Gemeinschaften in Wissensmanagementsystemen
- Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements
- Grundlagen
- Wissensmanagement an Hochschulen
- Einsatzmöglichkeiten in der Forschung
- Einsatzmöglichkeiten in der Lehre
- Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung
- Zwischenfazit
- Werkzeuge zur Umsetzung von Wissensmanagementlösungen und deren Potentiale im Hochschuleinsatz
- Groupware
- Social Software
- Inhaltsorientierte Systeme
- Führungsinformationssysteme
- Systeme der künstlichen Intelligenz
- Enterprise Content Management Systeme
- Vergleich der Einsatzmöglichkeiten von Wissensmanagementwerkzeugen
- Umsetzung einer Wissensmanagementlösung im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Universität Bamberg
- Ausgangssituation
- Anforderungsanalyse
- Realisierungskonzept
- Analyse potentieller Werkzeuge
- Werkzeugauswahl
- Funktionalität
- Benutzerfreundlichkeit
- Kosten
- Integrationsaufwand
- Ergebnis
- Realisierung
- Ausblick
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Thematik des Wissensmanagements und der Anwendung unterstützender Werkzeuge im Hochschuleinsatz. Ziel ist es, die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor in der heutigen Wissensgesellschaft zu beleuchten und die Herausforderungen des Wissensmanagements an Hochschulen zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten von Wissensmanagementlösungen in Forschung, Lehre und Verwaltung und beleuchtet die Potentiale verschiedener IT-gestützter Werkzeuge. Im Fokus steht die Entwicklung eines Realisierungskonzepts für eine Wissensmanagementlösung im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Universität Bamberg, um den Verlust personengebundenen Wissens zu minimieren und die Zusammenarbeit innerhalb des Fachbereichs zu optimieren.
- Wissensmanagement als strategisches Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
- Herausforderungen des Wissensmanagements an Hochschulen
- Einsatzmöglichkeiten von Wissensmanagementlösungen in Forschung, Lehre und Verwaltung
- Potentiale und Herausforderungen von IT-gestützten Wissensmanagementwerkzeugen
- Entwicklung eines Realisierungskonzepts für eine Wissensmanagementlösung im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Universität Bamberg
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Masterarbeit beleuchtet die Problemstellung des Wissensverlustes in wissenschaftlichen Einrichtungen und die Notwendigkeit einer Wissensmanagementlösung. Es wird die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor in der heutigen Wissensgesellschaft hervorgehoben und die Herausforderungen des Wissensmanagements in wissenschaftlichen Einrichtungen, insbesondere im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Universität Bamberg, dargestellt.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff des Wissens und dessen Stellenwert für Organisationen. Es werden verschiedene Wissensarten, Wissensträger und die organisationale Wissensbasis erläutert. Der Fokus liegt auf der Entstehung von Wissen, dem Wissenslebenszyklus und der Bedeutung von organisationaler Intelligenz.
Kapitel 3 widmet sich dem Wissensmanagement und dessen Entwicklung. Es werden verschiedene Wissensmanagement-Modelle vorgestellt, die Rolle der Informationstechnologie im Wissensmanagement beleuchtet und die Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements diskutiert.
Kapitel 4 untersucht die Einsatzmöglichkeiten von Wissensmanagement an Hochschulen in den Bereichen Forschung, Lehre und Verwaltung. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Chancen des Wissensmanagements im Hochschulkontext beleuchtet.
Kapitel 5 stellt verschiedene Werkzeuge zur Umsetzung von Wissensmanagementlösungen vor, darunter Groupware, Social Software, Inhaltsorientierte Systeme, Führungsinformationssysteme, Systeme der künstlichen Intelligenz und Enterprise Content Management Systeme. Die Einsatzmöglichkeiten und Potentiale dieser Werkzeuge im Hochschuleinsatz werden analysiert und verglichen.
Kapitel 6 beschreibt die Umsetzung einer Wissensmanagementlösung im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Universität Bamberg. Es werden die Ausgangssituation, die Anforderungsanalyse, das Realisierungskonzept und die Auswahl geeigneter Werkzeuge detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wissensmanagement, unterstützende Werkzeuge, Hochschuleinsatz, Wirtschaftspädagogik, Universität Bamberg, Wissensverlust, personengebundenes Wissen, IT-gestützte Werkzeuge, Realisierungskonzept, Forschung, Lehre, Verwaltung, Wissensentwicklung, Wissensweitergabe, Wissensbewahrung, Wissensstrukturierung, kollaborative Wissensgemeinschaft, SECI-Modell, Erfolgsfaktoren, Groupware, Social Software, Inhaltsorientierte Systeme, Führungsinformationssysteme, Systeme der künstlichen Intelligenz, Enterprise Content Management Systeme.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement an Hochschulen so wichtig?
Um den Verlust von personengebundenem Wissen bei Expertenfluktuation zu minimieren und die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Verwaltung zu optimieren.
Was ist der Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen?
Daten sind reine Zeichen. Informationen sind kontextualisierte Daten. Wissen entsteht durch die Vernetzung von Informationen mit Erfahrungen und individuellen Fähigkeiten (Wissenstreppe).
Welche IT-Werkzeuge unterstützen das Wissensmanagement?
Dazu gehören Groupware, Social Software (Wikis, Blogs), Content-Management-Systeme (CMS) und Systeme der künstlichen Intelligenz.
Was besagt das SECI-Modell?
Es beschreibt die Wissensumwandlung in vier Phasen: Sozialisation (implizit zu implizit), Externalisierung, Kombination und Internalisierung (explizit zu implizit).
Wie wurde Wissensmanagement im Fachbereich Wirtschaftspädagogik der Uni Bamberg umgesetzt?
Durch eine Anforderungsanalyse wurde ein Realisierungskonzept erstellt, das geeignete Software-Werkzeuge auswählte, um die kollaborative Zusammenarbeit zu stärken.
- Citation du texte
- Martin Zithier (Auteur), 2014, Wissensmanagement und unterstützende Werkzeuge im Hochschuleinsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281209