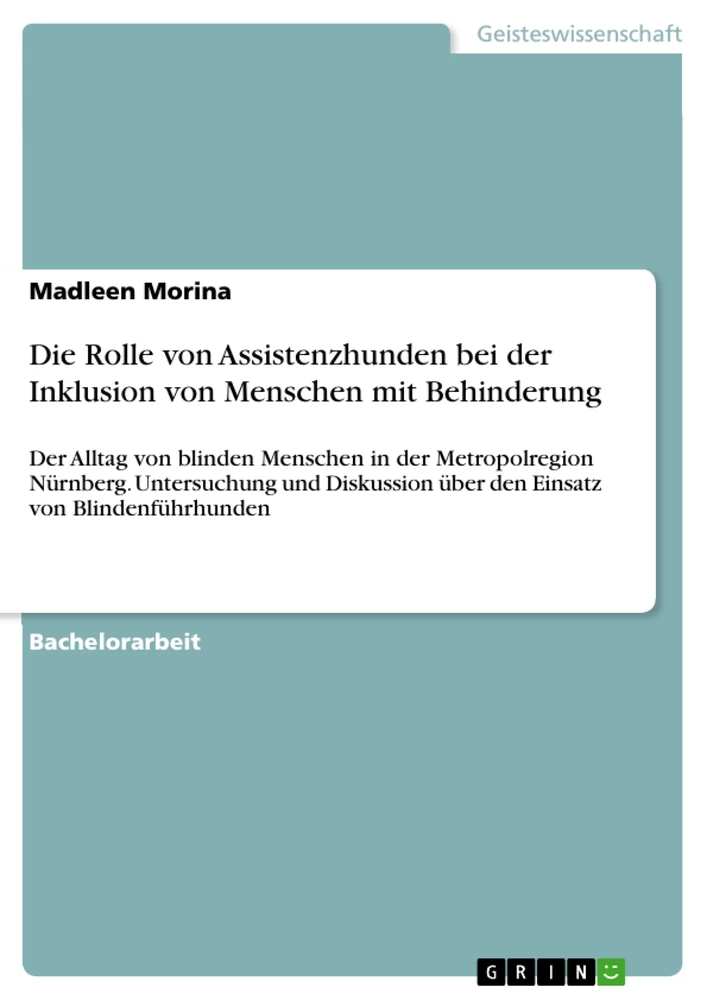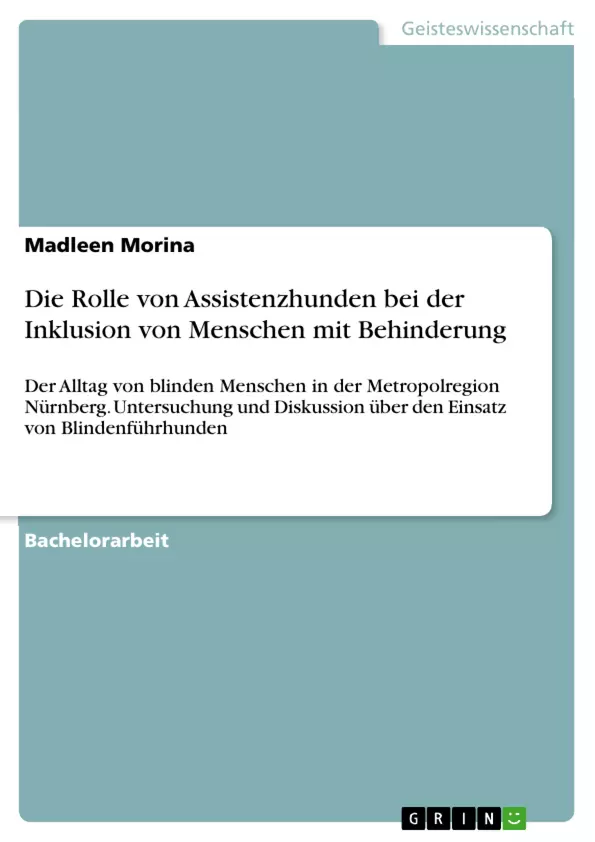Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Assistenzhunde zu der Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft beitragen. Dabei wird besonders der Einsatz von Blindenführhunden untersucht und diskutiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick darüber zu schaffen, wie sich die Teilhabe blinder Menschen in der Metropolregion Nürnberg an der Gesellschaft darstellt und welche Rolle ihr Blindenführhund dabei spielt.
Da sich zu diesem Thema nur wenig aktuelle Fachliteratur finden lässt, soll sie durch die individuellen Erfahrungen der Betroffenen ergänzt werden. Diese wurden mittels leitfadengestützter Interviews erhoben. Zudem werden Situationen geschildert, in denen das Verhalten der Mitmenschen beobachtet wurde.
Im Ergebnis zeigt sich, dass der Blindenführhund für die Menschen mit Seheinschränkung eine wesentliche Unterstützung im Alltag darstellt. Wobei die Führhundehalter sich allerdings nicht bedingungslos als in die Gesellschaft inkludiert erleben, da sie durch das Verhalten ihrer Mitmenschen mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dies lässt sich beispielsweise in dem rücksichtslosen Benehmen anderer Hundehalter, die ihr Tier nicht zurückrufen, erkennen. Zudem stellt das Verbot einiger Ladenbesitzer das Geschäft mit einem Führhund zu betreten ein großes Problem dar.
Des Weiteren sind in den meisten Städten immer noch zahlreiche Barrieren vorhanden. Auch wenn sich deren Ausprägung auf andere Bereiche, wie die rutschigen Böden in den öffentlichen Verkehrsmitteln und den Müll auf den Straßen, verschoben hat.
Blinde Menschen erfahren zwar durch einen Führhund bereits Verbesserungen in ihrer Selbständigkeit und im Kontakt mit den Mitmenschen. Vor allem im Hinblick auf das Handlungsbedürfnis der Sozialen Arbeit besteht aber noch ein hoher Bedarf an Veränderung.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Fachliche Grundlagen
- 2.1 Inklusion
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Abgrenzung zu Integration
- 2.2 Menschen mit Behinderung
- 2.2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2.2 Arten der Behinderung
- 2.2.3 Fokus: Sehschädigung
- 2.3 Assistenzhunde als Helfer für Menschen mit Behinderungen
- 2.3.1 Begriffsbestimmung
- 2.3.2 Einsatzbereiche von Assistenzhunden
- 2.4 Blindenführhunde als erweitertes Wahrnehmungsorgan
- 2.4.1 Begriffsbestimmung
- 2.4.2 Ausbildung eines Blindenführhundes
- 2.4.3 Rechtliche Stellung des Blindenführhundes
- 2.4.4 Möglichkeiten des Einsatzes eines Blindenführhundes
- 2.4.5 Grenzen des Einsatzes eines Blindenführhundes
- 2.4.6 Inklusionserfolge durch den Blindenführhund
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1 Leitfadengestütztes Interview
- 3.2 Beobachtung
- 3.3 Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund als Zugang zu Befragungspartnern
- 3.4 Erhebungsort
- 3.5 Auswertung
- 4. Befragungen
- 4.1 Interview Frau F.
- 4.1.1 Beschreibung der Interviewpartnerin
- 4.1.2 Darstellung der Interviewsituation
- 4.1.3 Inhaltliche Erkenntnisse
- 4.2 Interview Herr B.
- 4.2.1 Beschreibung des Interviewpartners
- 4.2.2 Darstellung der Interviewsituation
- 4.2.3 Inhaltliche Erkenntnisse
- 4.3 Interview Herr H.
- 4.3.1 Beschreibung des Interviewpartners
- 4.3.2 Darstellung der Interviewsituation
- 4.3.3 Inhaltliche Erkenntnisse
- 4.4 Zusammenfassung
- 4.4.1 Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse
- 4.4.2 Vergleich der aus der Erhebung gewonnenen Erkenntnisse mit der Literatur
- 5. Beobachtungen
- 5.1 Beobachtung Frau F.
- 5.1.1 Darstellung der Beobachtungssituation
- 5.1.2 Inhaltliche Erkenntnisse
- 5.2 Beobachtung Herr B.
- 5.2.1 Darstellung der Beobachtungssituation
- 5.2.2 Inhaltliche Erkenntnisse
- 5.3 Beobachtung Herr H.
- 5.3.1 Darstellung der Beobachtungssituation
- 5.3.2 Inhaltliche Erkenntnisse
- 5.4 Zusammenfassung
- 5.4.1 Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse
- 5.4.2 Vergleich der aus der Erhebung gewonnenen Erkenntnisse mit der Literatur
- 6. Handlungsbedürfnis der Sozialen Arbeit
- 6.1 Öffentlichkeitsarbeit als Schlüssel zur Gesellschaft
- 6.2 Handhabung der Sozialen Arbeit
- 7. Fazit und Ausblick
- 8. Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anhang 1: Abbildungsverzeichnis
- Anhang 2: Interviewleitfaden
- Anhang 3: Interviewtranskription Frau F.
- Anhang 4: Interviewtranskription Herr B.
- Anhang 5: Interviewtranskription Herr H.
- Anhang 6: Beobachtungsprotokoll Frau F.
- Anhang 7: Beobachtungsprotokoll Herr B.
- Anhang 8: Beobachtungsprotokoll Wanderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Assistenzhunde zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft beitragen. Der Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von Blindenführhunden und deren Rolle im Alltag blinder Menschen in der Metropolregion Nürnberg.
- Die Arbeit untersucht die Teilhabe blinder Menschen an der Gesellschaft und die Rolle des Blindenführhundes dabei.
- Sie analysiert die individuellen Erfahrungen von Menschen mit Sehschädigung im Umgang mit Blindenführhunden.
- Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Inklusion von Menschen mit Sehschädigung durch den Einsatz von Blindenführhunden.
- Sie identifiziert Handlungsbedarfe für die Soziale Arbeit im Kontext der Inklusion von Menschen mit Sehschädigung.
- Die Arbeit untersucht die rechtliche Stellung des Blindenführhundes und dessen Bedeutung für die Selbstständigkeit und Mobilität blinder Menschen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Motivation für die Untersuchung. Sie stellt die Problematik der Inklusion von Menschen mit Sehschädigung in den Vordergrund und beleuchtet die Rolle von Assistenzhunden in diesem Kontext. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle von Assistenzhunden bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung herauszuarbeiten und einen Überblick darüber zu geben, welchen Beitrag die Tiere dabei leisten können.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den fachlichen Grundlagen der Arbeit. Es werden die Begriffe Inklusion und Behinderung definiert und die Situation von Menschen mit Sehschädigung in Deutschland dargestellt. Anschließend wird die Rolle von Assistenzhunden hinsichtlich inklusiver Bestrebungen diskutiert und deren Unterstützung für blinde Menschen geprüft. Der Fokus liegt dabei auf Blindenführhunden als erweitertes Wahrnehmungsorgan und deren Bedeutung für die Selbstständigkeit und Mobilität blinder Menschen.
Das dritte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es werden die Methoden der leitfadengestützten Interviews und der Beobachtung erläutert. Zudem wird der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund als Zugang zu Befragungspartnern vorgestellt. Die Erhebungsort und die Auswertung der Daten werden ebenfalls beschrieben.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit drei blinden Menschen, die einen Blindenführhund einsetzen. Die Interviews beleuchten die individuellen Erfahrungen der Betroffenen im Umgang mit ihrem Blindenführhund und deren Auswirkungen auf ihren Alltag. Die Ergebnisse werden vergleichend betrachtet und mit der Literatur in Beziehung gesetzt.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Beobachtungen zusammen. Es werden drei Beobachtungssituationen beschrieben, in denen blinde Menschen mit ihren Blindenführhunden im öffentlichen Raum unterwegs waren. Die Beobachtungen beleuchten das Verhalten der Mitmenschen gegenüber blinden Menschen mit Blindenführhunden und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Das sechste Kapitel diskutiert das Handlungsbedürfnis der Sozialen Arbeit im Kontext der Inklusion von Menschen mit Sehschädigung. Es werden die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und die Handhabung der Sozialen Arbeit im Umgang mit blinden Menschen mit Blindenführhunden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Inklusion von Menschen mit Behinderung, den Einsatz von Assistenzhunden, insbesondere Blindenführhunden, die Teilhabe blinder Menschen an der Gesellschaft, die Herausforderungen und Chancen der Inklusion, die Rolle der Sozialen Arbeit und die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit im Kontext der Inklusion von Menschen mit Sehschädigung.
- Quote paper
- Madleen Morina (Author), 2014, Die Rolle von Assistenzhunden bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281285