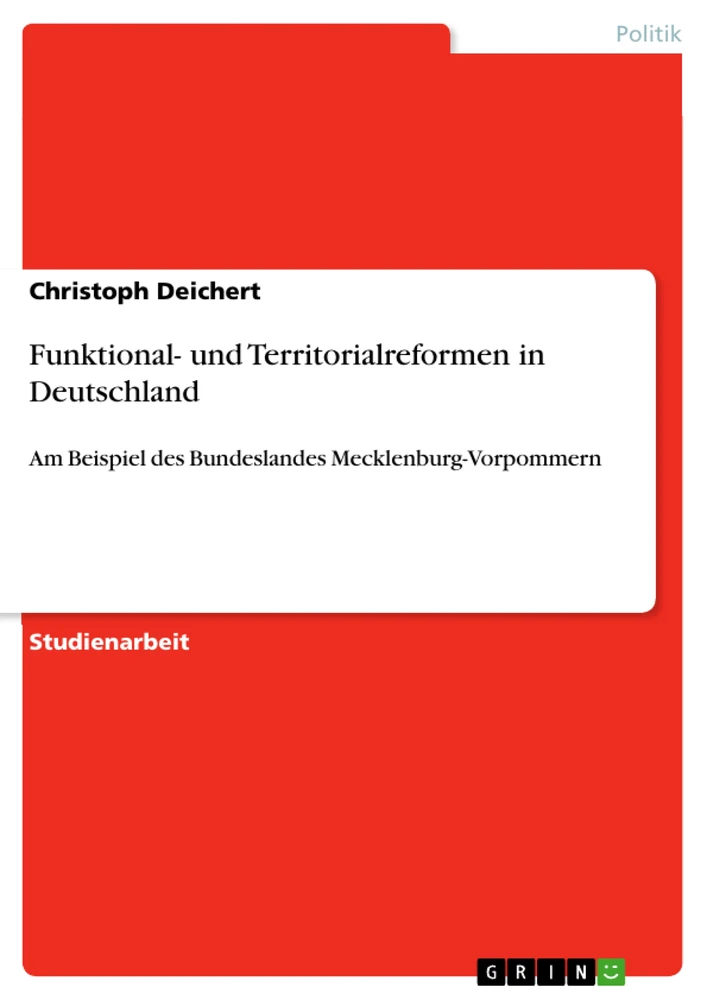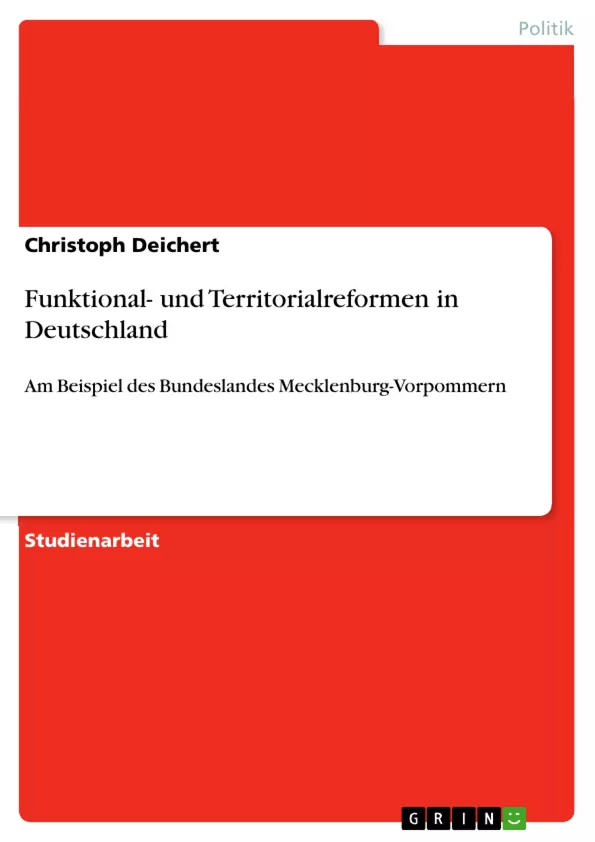In der föderalen Ordnung Deutschlands existieren 16 Länder mit ihren eigenen Verfassungen, verfassungsrechtlichen Kompetenzen und ihrer eigenen Legislative. Wobei die Hansestädte Hamburg und Bremen sowie die Bundeshauptstadt Berlin, durch ihre Doppelrolle als Stadt und Staat einen abweichenden Verwaltungsaufbau vorweisen. Für die restlichen 13 Bundesländer gilt, dass die Gemeinden und 301 Landkreise rechtlich als Bestandteile der Länder behandelt werden. Des Weiteren existiert mit den 107 kreisfreien Städten eine besondere Form der territorialen Einheit. (Vgl.: Heinelt u. Egner 2011 : S. 106 f.)
Die Landespolitik in den Bundesländern hat vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise Funktional- und Gebietsreformen verstärkt im Blick. Aber auch die Effekte des demographischen Wandels sowie der Wettbewerbsdruck durch die Globalisierung führen in den Bundesländern zu Bestrebungen nach möglichst großen Kommunen und Regionen, um Kosteinsparungen durch Effizienzgewinne im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu erreichen. Doch für das Gelingen dieser Reformen ist im Wesentlichen eine vorherige Aufgabenkritik, also die Zurverfügungstellung von öffentlichen Mitteln und die politische Definition der künftigen öffentlichen Aufgaben von Nöten. (Vgl.: Franzke 2013 : S. 25)
Gegenwärtige Debatten über die Landkreise betreffen hauptsächlich deren Territorialität. Besonders in Ostdeutschland kam es zur Implementation von Gebietsreformen so zum Beispiel in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Oder im Jahr 2007 wurde in Mecklenburg-Vorpommern eine solche Reform für verfassungswidrig erklärt und wenige Jahre später durch Gesetzesänderungen herbei geführt. Aber auch in den drei westdeutschen Flächenstaaten Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden in jüngster Zeit über Gebietsreformen der kommunalen Ebene diskutiert. Des Weiteren spielen auch Funktionalreformen wie in Baden-Württemberg eine Rolle. (Vgl.: Heinelt u. Egner 2011 : S. 120 f.)
Aufgrund der im ersten Abschnitt geschilderten Rolle der Kommune als Bestandteil der 13 Flächenländer erscheint eine Untersuchung aller Reformbemühungen der Landkreise als zu weitreichend, da davon ausgegangen werden muss, dass Reformen im jeweils eigenen subnationalen Kontext diskutiert werden, aus diesem Grund lautet die Fragestellung:
Wie lassen sich die aktuelle Funktional- und Territorialreform für das Land Mecklenburg-Vorpommern erklären?
Diese Fragestellung erscheint am geeignetstem, da zum einen beiden Reformarten beh
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Forschungsstand
- I.2 Aufbau der Hausarbeit
- II. Definition von Territorial- und Funktionalreformen
- III. Theoretischer Rahmen
- IV. Ausgangslage der Reformen der Kreisebene
- V. Grundlagen der Reformen in Mecklenburg-Vorpommern
- V.1 Reformbeteiligte
- V.2 Positionen der beteiligten Akteure
- V.3 Entwicklung der Demografie, Kreisfläche und Steuereinnahmen
- V.4 Wünschenswerte Reformidee
- V.5 Für durchführbar gehaltene Reformidee
- VI. Darstellung der Reform in Mecklenburg-Vorpommern
- VI.1 Inhalte des Reformpakets
- VI.2 Umsetzungsprozess der Reform
- VI.3 Evaluation der Reform
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel ist es, die Hintergründe und die Umsetzung dieser Reformen zu erklären und zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Territorialreform der Kreisebene. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Akteure, ihre Positionen und die demografischen, finanziellen und politischen Faktoren, die die Reformen beeinflusst haben.
- Analyse der Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern
- Untersuchung der beteiligten Akteure und ihrer Interessen
- Bewertung der demografischen, finanziellen und politischen Rahmenbedingungen
- Auswertung der Effizienz und Effektivität der durchgeführten Reformen
- Diskussion des Spannungsverhältnisses zwischen Effizienz/Effektivität und Bürgerbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: Funktional- und Gebietsreformen in den deutschen Bundesländern im Zuge der Finanzkrise, des demografischen Wandels und der Globalisierung. Sie führt in die Forschungsfrage ein: Wie lassen sich die aktuellen Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern erklären? Die These der Arbeit, dass die Reformen auf die Steigerung von Effizienz und Effektivität abzielen, wird vorgestellt, wobei ein Spannungsverhältnis zu Bürgerbeteiligung und Demokratie angedeutet wird. Der Forschungsstand wird kurz umrissen.
II. Definition von Territorial- und Funktionalreformen: (Es wird angenommen, dass dieses Kapitel Definitionen von Territorial- und Funktionalreformen liefert. Eine detaillierte Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text. Eine sinnvolle Zusammenfassung müsste diese Definitionen und deren Unterschiede im Detail erläutern.)
III. Theoretischer Rahmen: (Ähnlich wie Kapitel II fehlt hier eine detaillierte Beschreibung des Inhalts. Die Zusammenfassung müsste den theoretischen Rahmen der Arbeit, beispielsweise verwendete Theorien und Modelle, erläutern und deren Relevanz für die Analyse der Reformen in Mecklenburg-Vorpommern herausstellen.)
IV. Ausgangslage der Reformen der Kreisebene: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeine Situation der Kreisebene in Deutschland vor den Reformen in Mecklenburg-Vorpommern. Es beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, die zu den Reformbestrebungen geführt haben, z.B. finanzielle Schwierigkeiten, demografischer Wandel etc. Es dient als Grundlage für das Verständnis der spezifischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern.
V. Grundlagen der Reformen in Mecklenburg-Vorpommern: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Grundlagen der Reformen in Mecklenburg-Vorpommern. Es untersucht die beteiligten Akteure (z.B. Regierung, Kommunen, Bürgerinitiativen), ihre unterschiedlichen Positionen und Interessen, die demografische Entwicklung, die Kreisflächen, die Steuereinnahmen und schließlich die verschiedenen Reformideen – sowohl die wünschenswerten als auch die als durchführbar angesehenen.
VI. Darstellung der Reform in Mecklenburg-Vorpommern: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die konkreten Inhalte des Reformpakets, den Umsetzungsprozess und die Evaluation der Reform. Es geht auf die gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen ein. Die Zusammenfassung sollte die wichtigsten Punkte des Reformpakets hervorheben und den Erfolg oder Misserfolg der Reform anhand von Kriterien wie Effizienzsteigerung und Bürgerakzeptanz bewerten.
Schlüsselwörter
Funktionalreformen, Territorialreformen, Mecklenburg-Vorpommern, Kreisebene, Gebietsreform, Effizienz, Effektivität, Bürgerbeteiligung, Demokratie, demografischer Wandel, Finanzkrise, Kommunalverwaltung, Governance, Partizipation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern, mit Schwerpunkt auf der Territorialreform der Kreisebene. Sie analysiert die Hintergründe, den Umsetzungsprozess und die Auswirkungen dieser Reformen.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Funktional- und Territorialreformen in Mecklenburg-Vorpommern zu erklären und zu analysieren. Sie beleuchtet die beteiligten Akteure, ihre Positionen und die demografischen, finanziellen und politischen Faktoren, die die Reformen beeinflusst haben. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewertung der Effizienz und Effektivität der Reformen im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen Effizienz/Effektivität und Bürgerbeteiligung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse der Funktional- und Territorialreformen, Untersuchung der beteiligten Akteure und ihrer Interessen, Bewertung der demografischen, finanziellen und politischen Rahmenbedingungen, Auswertung der Effizienz und Effektivität der Reformen und Diskussion des Spannungsverhältnisses zwischen Effizienz/Effektivität und Bürgerbeteiligung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in den einzelnen Kapiteln?
Die Hausarbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel I (Einleitung) beschreibt den Kontext und die Forschungsfrage. Kapitel II (Definitionen) liefert Definitionen von Territorial- und Funktionalreformen. Kapitel III (Theoretischer Rahmen) erläutert die theoretischen Grundlagen. Kapitel IV (Ausgangslage) beschreibt die Situation vor den Reformen. Kapitel V (Grundlagen der Reformen in MV) analysiert die Akteure, Positionen und Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern. Kapitel VI (Darstellung der Reform) beschreibt die Inhalte, Umsetzung und Evaluation der Reform in Mecklenburg-Vorpommern. Kapitel VII (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Akteure werden in der Hausarbeit betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Akteure, die an den Reformen beteiligt waren, z.B. die Regierung, Kommunen und Bürgerinitiativen. Ihre unterschiedlichen Positionen und Interessen werden analysiert.
Welche Faktoren haben die Reformen beeinflusst?
Die Reformen wurden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter demografische Entwicklung, finanzielle Schwierigkeiten (Finanzkrise), politische Entscheidungen und die Größe der Kreisflächen sowie die Steuereinnahmen.
Wie werden Effizienz und Effektivität der Reformen bewertet?
Die Hausarbeit bewertet die Effizienz und Effektivität der Reformen anhand von Kriterien wie der angestrebten Steigerung der Effizienz und der Akzeptanz durch die Bürger. Der mögliche Konflikt zwischen Effizienz und Bürgerbeteiligung wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Funktionalreformen, Territorialreformen, Mecklenburg-Vorpommern, Kreisebene, Gebietsreform, Effizienz, Effektivität, Bürgerbeteiligung, Demokratie, demografischer Wandel, Finanzkrise, Kommunalverwaltung, Governance, Partizipation.
- Quote paper
- Christoph Deichert (Author), 2014, Funktional- und Territorialreformen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281365