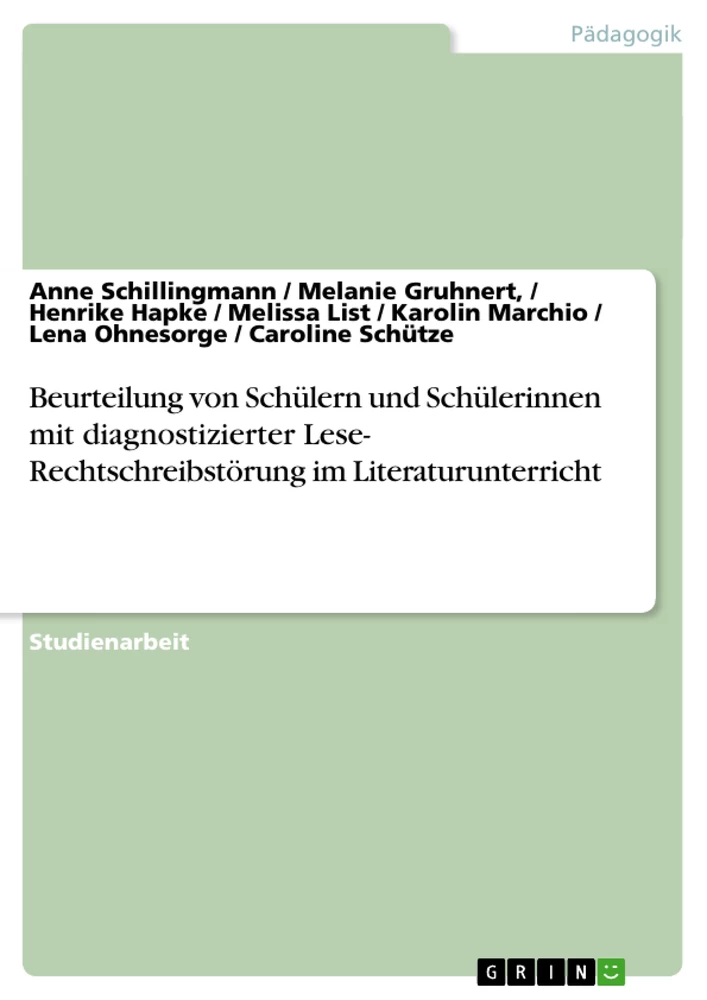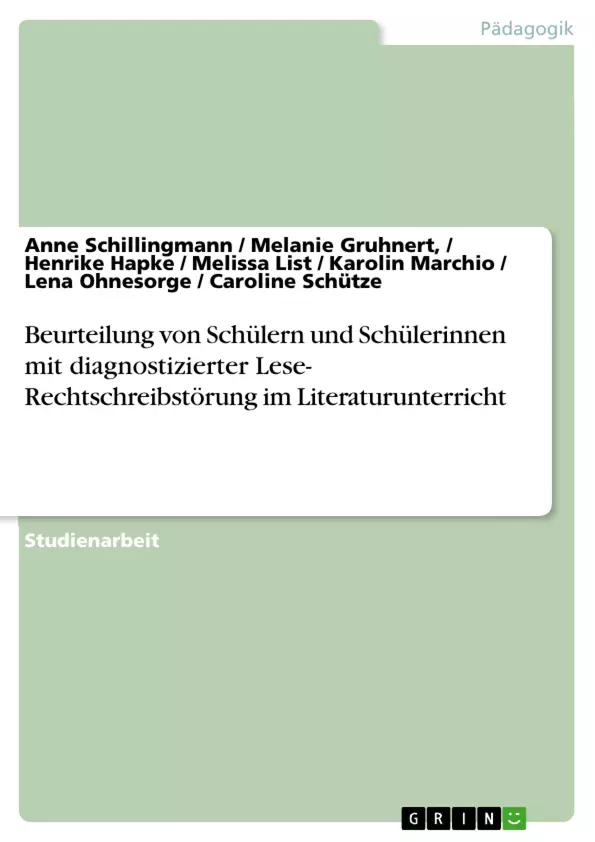Legastheniker haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen in geschriebene Sprache und umgekehrt. Charakteristisch ist dabei die Häufigkeit und hohe Stabilität der Fehler, wobei das Kind meist nicht einmal beim wiederholten Üben erkennen kann, ob das Wort richtig oder falsch gelesen bzw. geschrieben ist. Mögliche Anzeichen einer Legasthenie sind z.B. auffallend große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, sehr langsames, fehlerhaftes Lesen, das Auslassen von Buchstaben oder Silben, undeutliche Aussprache, Probleme beim Niederschreiben von Gehörtem oder Abschreiben von der Tafel sowie die häufige Verwechslung ähnlicher Wörter und Buchstaben.
Um eine Lese-Rechtschreib-Störung genau feststellen zu können, werden Fachleute (Schulpsychologen) benötigt, die mit dem Kind bestimmte Tests durchführt. Das diagnostische Vorgehen muss den Anforderungen, der internationalen Standards der Psychologie und Pädagogik entsprechen. Dieses orientiert sich an dem „mutlitaxialen Diagnoseschema“ und ...
Inhaltsverzeichnis
- Lese-Rechtschreibstörung
- Rechtlichen Grundlagen für die Gewährung des Nachteilsausgleichs
- Schulpraktische Bewertungsverfahren
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Beurteilung von Schülern und Schülerinnen mit diagnostizierter Lese-Rechtschreibstörung (LRS) im Literaturunterricht. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen des Nachteilsausgleichs für LRS-Schüler und stellt verschiedene schulpraktische Bewertungsverfahren vor, die an einer konkreten Schule angewendet werden.
- Definition und Merkmale von Lese-Rechtschreibstörung
- Rechtliche Grundlagen des Nachteilsausgleichs für LRS-Schüler
- Schulpraktische Bewertungsverfahren im Literaturunterricht
- Individuelle Förderung und Anpassung der Leistungsbewertung
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion von LRS-Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
-
Das erste Kapitel definiert den Begriff der Lese-Rechtschreibstörung (LRS) und beschreibt die charakteristischen Merkmale dieser Störung. Es werden verschiedene Anzeichen für LRS aufgezeigt und die diagnostischen Verfahren erläutert, die zur Feststellung einer LRS eingesetzt werden.
-
Das zweite Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen für die Gewährung des Nachteilsausgleichs für LRS-Schüler. Es werden die unterschiedlichen Rahmenrichtlinien in den Bundesländern sowie die Umsetzung des Nachteilsausgleichs an den Schulen hinsichtlich Diagnose und Förderung dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem Nachteilsausgleich in Niedersachsen.
-
Das dritte Kapitel widmet sich den schulpraktischen Bewertungsverfahren im Literaturunterricht. Es werden verschiedene Abweichungen von der allgemeinen Leistungsbewertung vorgestellt, die an einer konkreten Schule angewendet werden, um LRS-Schülern gerecht zu werden. Diese Abweichungen umfassen beispielsweise die Ausweitung der Arbeitszeit, die Anpassung der Aufgabenstellung, den Verzicht auf die Bewertung der Rechtschreibleistung und die Verwendung medialer Hilfsmittel.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Lese-Rechtschreibstörung (LRS), Nachteilsausgleich, Inklusion, Literaturunterricht, Leistungsbewertung, individuelle Förderung, Schulrecht, Diagnostik, Schulpraktische Verfahren, Anpassung der Anforderungen, mediale Hilfsmittel, Zeugnisvermerke.
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Anzeichen einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS)?
Typische Merkmale sind sehr langsames und fehlerhaftes Lesen, das Auslassen von Buchstaben oder Silben, die Verwechslung ähnlicher Buchstaben sowie große Schwierigkeiten beim Niederschreiben von Gehörtem.
Wie wird eine LRS offiziell diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch Fachleute wie Schulpsychologen mithilfe standardisierter Tests, die sich am „multiaxialen Diagnoseschema“ orientieren.
Was bedeutet "Nachteilsausgleich" im Literaturunterricht?
Ein Nachteilsausgleich umfasst Maßnahmen wie die Ausweitung der Arbeitszeit, angepasste Aufgabenstellungen, den Verzicht auf die Bewertung der Rechtschreibung oder die Nutzung medialer Hilfsmittel, um Schülern mit LRS faire Chancen zu ermöglichen.
Gibt es Zeugnisvermerke bei gewährtem Nachteilsausgleich?
Ja, je nach Bundesland und Art der Abweichung von der Leistungsbewertung kann ein entsprechender Vermerk im Zeugnis aufgenommen werden.
Welche Rolle spielt das Schulrecht bei LRS?
Das Schulrecht (z. B. in Niedersachsen) legt die Rahmenrichtlinien fest, wie Schulen Diagnosen anerkennen müssen und welche Fördermaßnahmen sowie Bewertungsspielräume rechtlich zulässig sind.
- Citation du texte
- Anne Schillingmann (Auteur), Melanie Gruhnert, (Auteur), Henrike Hapke (Auteur), Melissa List (Auteur), Karolin Marchio (Auteur), Lena Ohnesorge (Auteur), Caroline Schütze (Auteur), 2014, Beurteilung von Schülern und Schülerinnen mit diagnostizierter Lese- Rechtschreibstörung im Literaturunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281409