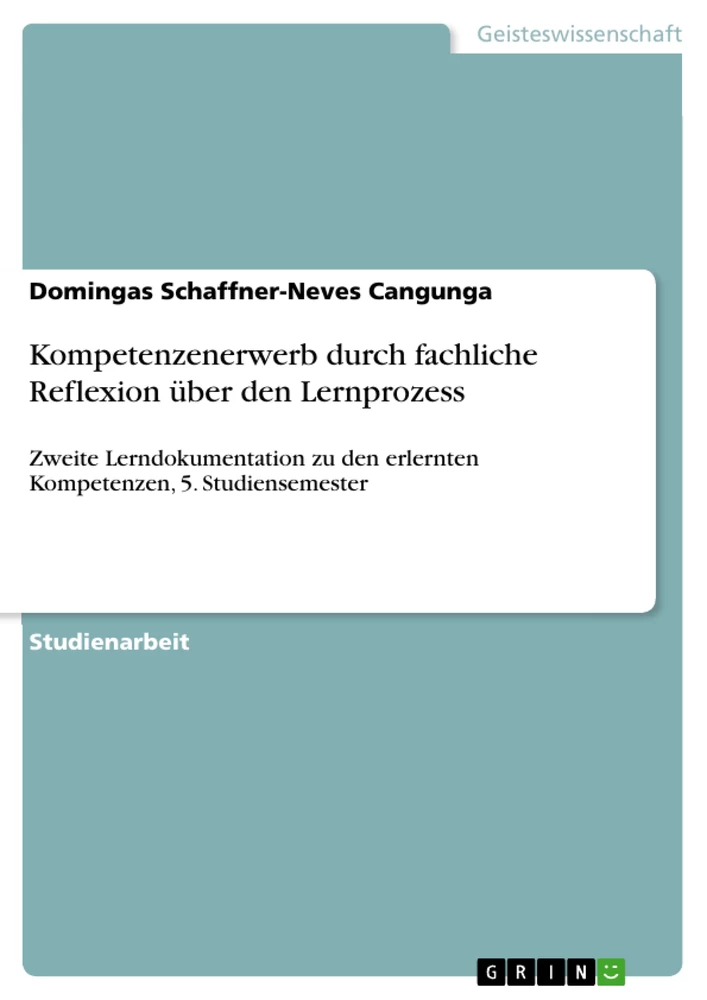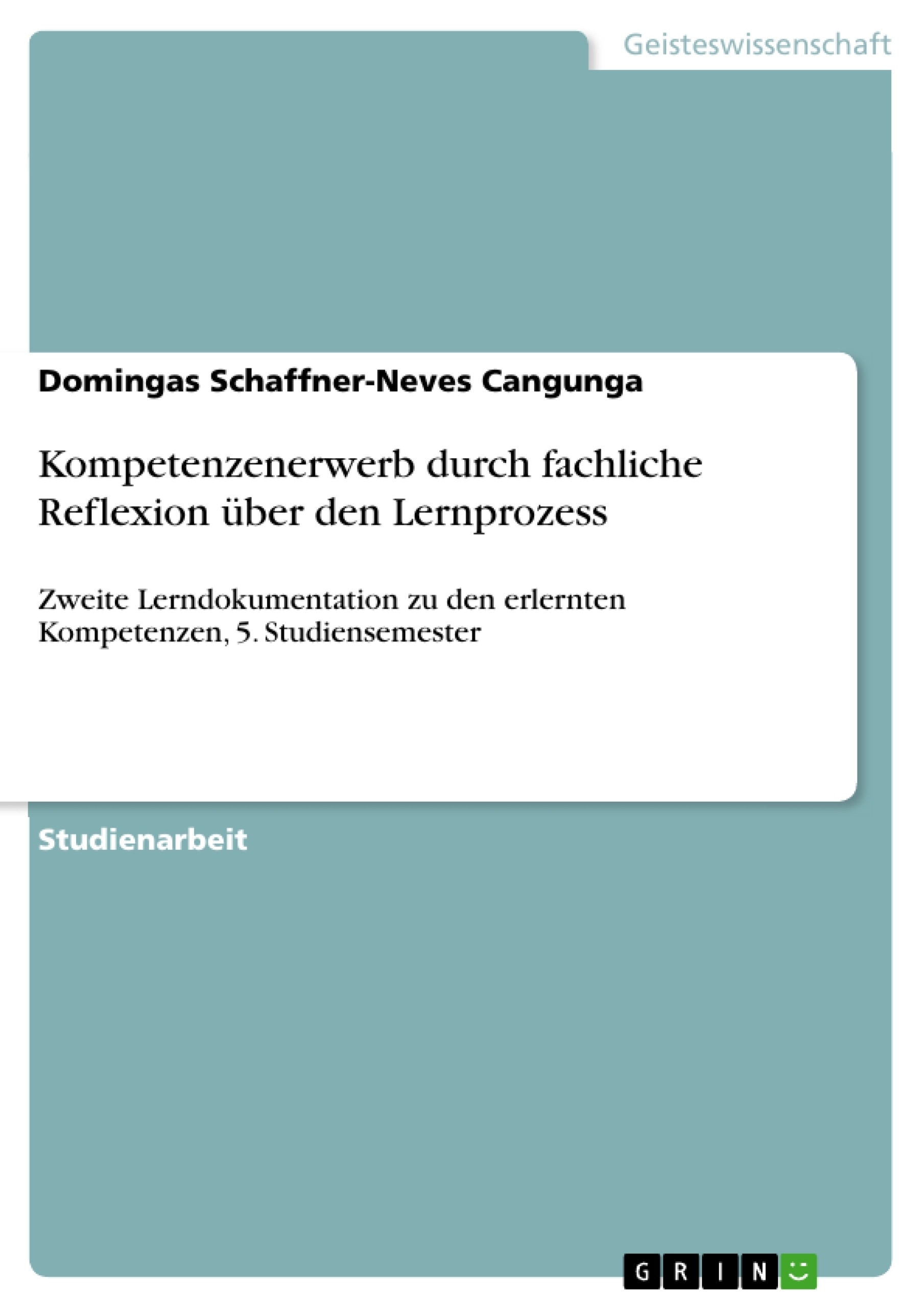Sich selbst unter die Luppe zu nehmen ist nie einfach. Dennoch reift diese Übung den Geist und macht einen auf eigenen Blindenflecken etwas aufmerksamer. Der Professioneller Habitus ist ein sehr wichtiger Begriff in dem Studiengang Bachelor of Arts in Social Work. Diese ist meine zweite Dokumentation und scheinbar habe ich aus den ersten Fehlern etwas gelernt. Diesen Weg muss ich immer wieder machen um nicht in die Routine, des Verallgemeinern zu geraten, was bekanntlich sehr unprofessionell ist. Heute lesend, sehe ich dennoch Inhalte, die ich eventuell anders deuten würde. Die Reife und die deutliche Unterscheidung zwischen Emotionen und Fakten wäre bei einer dritten Dokumentation sicherlich gestiegen. Jeder Mensch ist nicht nur Sozial, sondern auch ein emotionales Wesen. Die Emotionen sind gesunde Abwehrmechanismen, die sehr wohl reflektiert als eigener Schutz genutzt werden dürfen. Die Umweltfaktoren, die Emotionen negativ nutzen lassen, sind zu beachten und darüber animiere ich alle Menschen zu reflektieren: Wann ist "emotional" schlecht? Wie wird denn den emotionalen und nicht emotionalen Menschen unterschieden ? Wie gut oder schlecht ist dieses Wort in den unterschiedlichen Gesellschaften konotiert? Wer nutzt das für wen? Fremdzuschreibung, Fremd-oder Selbstbestimmung?
Inhaltsverzeichnis
- Vorgehen und Aufbau der schriftlichen Arbeit zur Lerndokumentation
- Einleitung
- Übersicht über die Kompetenzen
- Methodisches Vorgehen
- Start LD2
- Vorwissen, Ausgangslage
- Ausgangsfragen
- Ziel LD2
- Gewonnene Erkenntnisse in Bezug auf „Was?"
- Weiterführende, offen gebliebene Fragen in Bezug auf „Wo/Warum?"
- Weiteres Vorgehen in Bezug auf „Wie?"
- Reflexion der Kompetenzbereiche
- Was hat mein Handeln geprägt?
- Auswirkungen auf mich
- Auswirkungen auf meinen weiteren Lernprozess im Studium
- Auswirkungen auf meinen beruflichen Habitus
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Arbeit zur Lerndokumentation verfolgt das Ziel, den Lernprozess des Autors im fünften Semester des Studiums zu reflektieren und die dabei gewonnenen Erkenntnisse zu dokumentieren. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen sowie analytischen und Informationskompetenzen im Kontext von Gruppenarbeiten und Projekten.
- Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen in heterogenen Gruppen
- Herausforderungen der Zusammenarbeit in Projektgruppen
- Reflexion des eigenen Lernprozesses und der Auswirkungen auf das berufliche Handeln
- Anwendung von wissenschaftlichen Methoden und Theorien in der Praxis
- Bedeutung von interdisziplinärem Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Lerndokumentation beschreibt den methodischen Aufbau der Arbeit und die Auswahl der Kompetenzen, die im Fokus der Reflexion stehen. Es wird die Ausgangslage des Autors im fünften Semester dargestellt, wobei die Bedeutung von Selbst- und Sozialkompetenzen sowie analytischen und Informationskompetenzen im Kontext von Gruppenarbeiten und Projekten hervorgehoben wird.
Das zweite Kapitel widmet sich der Ausgangslage für die zweite Lerndokumentation. Es werden die Vorerfahrungen des Autors im Bereich der Sozialen Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen beleuchtet. Insbesondere wird die Bedeutung von verschiedenen Typen von professionell Beschäftigten in der Sozialen Arbeit und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in Projektgruppen thematisiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den gewonnenen Erkenntnissen und einem Ausblick auf den weiteren Lernprozess. Es werden die Erfahrungen des Autors in den verschiedenen Modulen und Projekten analysiert und die Auswirkungen auf seine Kompetenzenentwicklung dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von interdisziplinärem Denken und Handeln sowie der Anwendung von wissenschaftlichen Methoden und Theorien in der Praxis.
Das vierte Kapitel reflektiert die Prägung des Handelns des Autors in Bezug auf seinen Lernprozess und sein berufliches Handeln. Es werden die Auswirkungen der gewonnenen Erkenntnisse auf seine Selbst- und Sozialkompetenzen sowie auf seine berufliche Entwicklung dargestellt. Der Autor beleuchtet die Herausforderungen der Zusammenarbeit in heterogenen Gruppen und die Bedeutung von interdisziplinärem Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen, die Herausforderungen der Zusammenarbeit in Projektgruppen, die Reflexion des eigenen Lernprozesses und die Auswirkungen auf das berufliche Handeln, die Anwendung von wissenschaftlichen Methoden und Theorien in der Praxis sowie die Bedeutung von interdisziplinärem Denken und Handeln in der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Lerndokumentation im Studium der Sozialen Arbeit?
Das Ziel ist die Reflexion des eigenen Lernprozesses, insbesondere der Entwicklung von Selbst-, Sozial- und Fachkompetenzen während des Studiums.
Was bedeutet der Begriff „Professioneller Habitus“?
Er beschreibt die professionelle Haltung und das Selbstverständnis einer Fachkraft, die durch ständige Reflexion und die Trennung von Emotionen und Fakten geprägt ist.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Arbeit in heterogenen Gruppen?
Unterschiedliche Vorwissen, Arbeitsweisen und Persönlichkeiten erfordern ein hohes Maß an Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeit sowie interdisziplinäres Denken.
Warum ist die Reflexion von Emotionen in der Sozialen Arbeit wichtig?
Emotionen fungieren als Abwehrmechanismen und persönlicher Schutz. Werden sie reflektiert, helfen sie dabei, Unprofessionalität und Routinefehler zu vermeiden.
Wie beeinflusst wissenschaftliches Arbeiten die Praxis?
Die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Theorien ermöglicht eine fundierte Analyse praktischer Probleme und führt zu einer höheren Qualität im beruflichen Handeln.
- Citar trabajo
- Domingas Schaffner-Neves Cangunga (Autor), 2009, Kompetenzenerwerb durch fachliche Reflexion über den Lernprozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281452