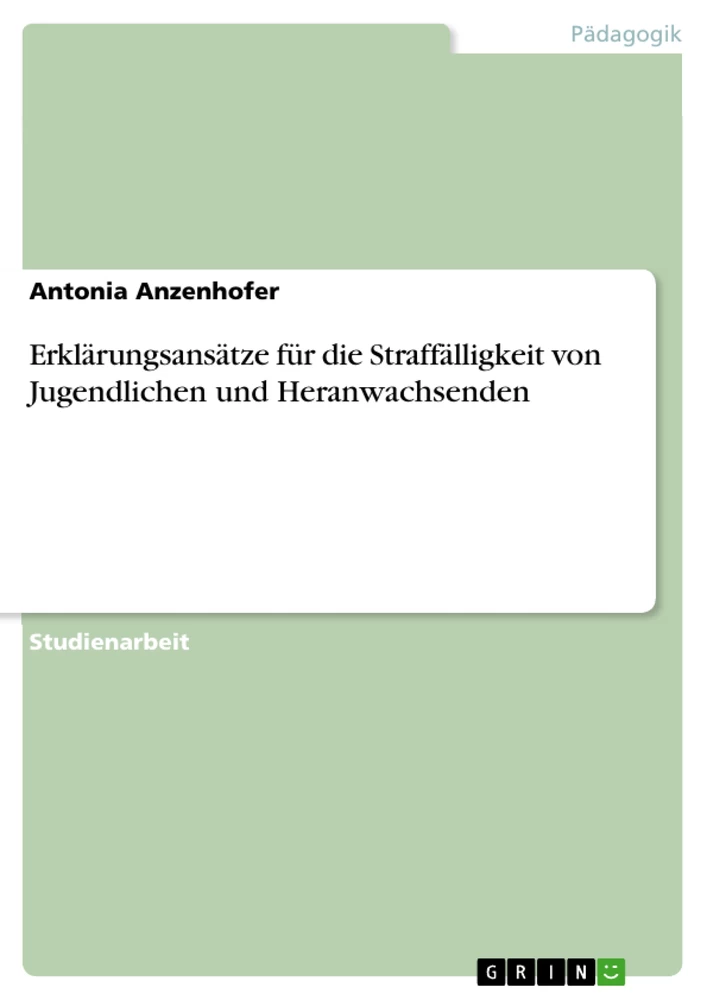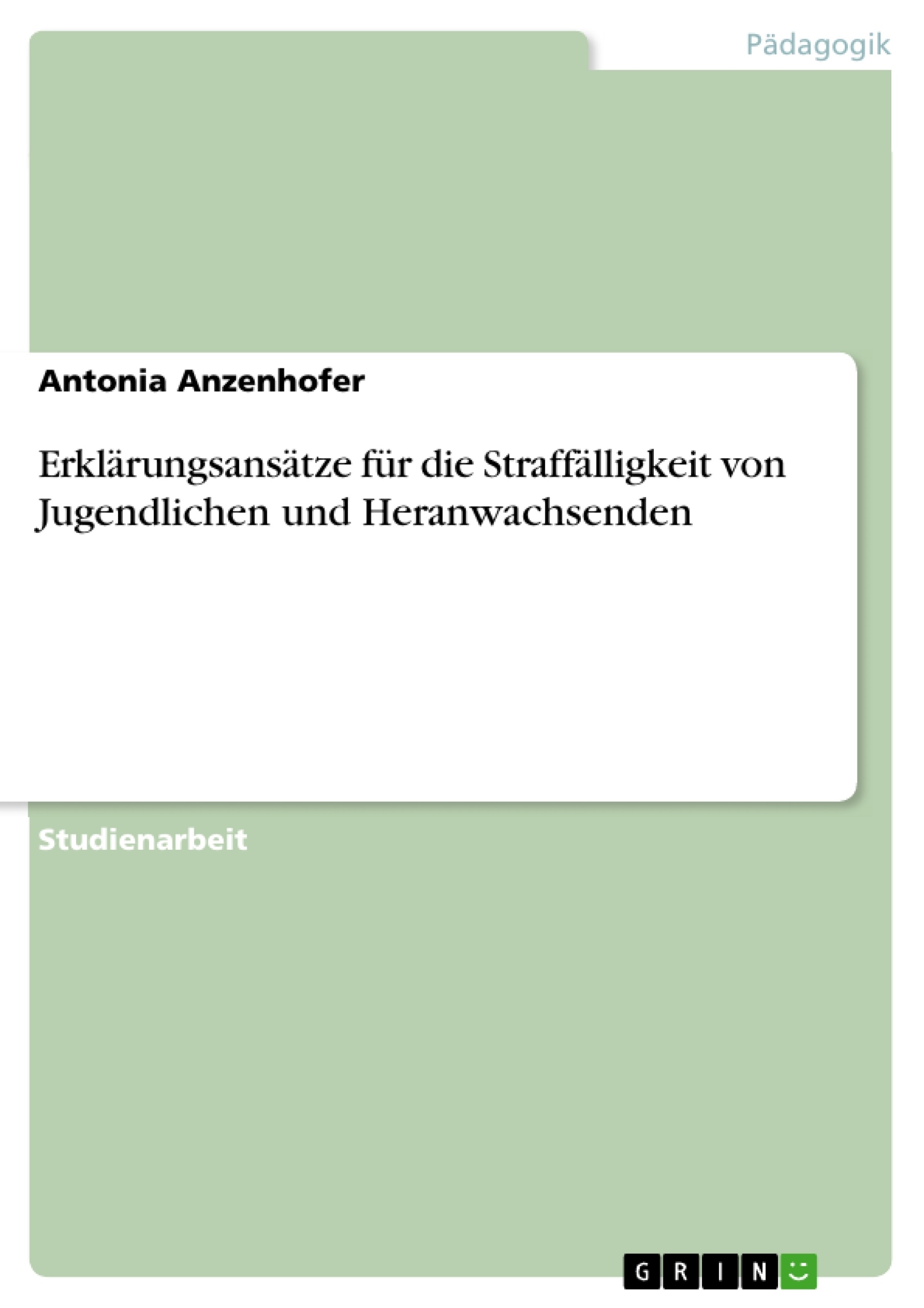Die Kindheit gilt in unserer Gesellschaft als die Zeit der Unbeschwertheit, der Sorglosigkeit und Freiheit. Doch realistisch gesehen gibt es eine Kindheit völlig frei von Stress und Sorgen kaum, denn schon in jungen Jahren treten erste Belastungen und Probleme auf, die zu Überforderung und Bewältigungsbeschwerden führen können. Mit dem Ende der Kindheit tritt dann die Jugend ein, welche allgemein auch als Krisenzeit bezeichnet wird, in der zahlreiche Anforderungen auf den Jugendlichen stoßen. In dieser Phase des Umbruchs verlangen viele Veränderungen in einem nur kurzen Zeitraum von wenigen Jahren eine hohe Anpassungs- und Koordinierungsleistung vom Jugendlichen. Wachstumsvorgänge finden statt, ein personenspezifischer Charakter bildet sich allmählich heraus und das Kind muss eintreten in die Erwachsenenwelt. Die Jugend kann also als Zeit der Identitätsbildung gesehen werden, in der Konflikte, das Ausprobieren, das Eingehen von Risiken und das Überschreiten von Grenzen eine große Rolle spielen. Störungsbilder treten dort auf, wo sich beim Jugendlichen allzu viele Probleme ansammeln und zugleich stützende, strukturierende Hilfestellungen vom unmittelbaren Umfeld fehlen. So können sich beim Heranwachsenden abweichendes Verhalten wie z.B. depressive Anzeichen, Alkohol-und Drogenmissbrauch, Aggressivität, Disziplinprobleme, Provokation, Einsamkeit und sich-unverstanden-fühlen zeigen und als häufigste Begleiterscheinungen bei der Bewältig von auftretenden Schwierigkeiten gesehen werden.
Im Folgenden werden nach einer Begriffsbestimmung und einer Abgrenzung der Delinquenz zur Devianz und Kriminalität zunächst verschiedene psychologische Erklärungsansätze für die Entstehung delinquenten Verhaltens bei Jugendlichen und Heranwachsenden untersucht, wobei diese in psychoanalytische Theorien, Lerntheorien und die Theorie der Selbstkontrolle aufgeteilt werden. Daraufhin wird der Blick weg vom Individuum hin zur Gesellschaft gelenkt und fünf soziologische Erklärungsansätze beleuchtet. Im Anschluss werden auch die biologischen Einflüsse und Ansätze erörtert und genetische sowie sozialdarwinistische Theorien dargestellt. Bevor dann zuletzt die multifaktoriellen Ansätze behandelt werden, die mehrere verschiedene Umstände und Elemente für die Entstehung delinquenten Verhaltens verantwortlich machen, wird noch kurz auf religiöse Theorien und in dem Zusammenhang speziell die Erbsünde eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemumriss
- 1.2 Begriffsbestimmung: Delinquenz
- 1.3 Abgrenzung zur Devianz und Kriminalität
- 2. Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten von Jugendlichen und Heranwachsenden
- 2.1 Psychologische Theorien
- 2.1.1 Psychoanalytische Erklärungsansätze
- 2.1.2 Lerntheorien
- 2.1.3 Das Konzept der Selbstkontrolle (Gottfredson/Hirschi 1990)
- 2.2 Soziologische Theorien
- 2.3 Biologische Theorien
- 2.4 Religiöse Theorien: Die Erbsünde
- 2.5 Multifaktorielle Theorien: Abweichendes Verhalten als Bewältigungs-handeln (Böhnisch 1999)
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Ziel ist es, verschiedene psychologische, soziologische, biologische und religiöse Perspektiven auf dieses Phänomen zu beleuchten und multifaktorielle Ansätze zu diskutieren.
- Definition und Abgrenzung von Delinquenz, Devianz und Kriminalität
- Psychologische Erklärungsansätze (psychoanalytisch, lerntheoretisch, Selbstkontrolle)
- Soziologische Erklärungsansätze (Anomie, strukturelle Gewalt, Etikettierung, Subkulturen, Macht)
- Biologische und religiöse Erklärungsansätze
- Multifaktorielle Ansätze für delinquentes Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beschreibt die Kindheit und Jugend als Phasen mit Herausforderungen und Belastungen, die zu abweichendem Verhalten führen können. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Zunächst werden Delinquenz, Devianz und Kriminalität definiert und abgegrenzt. Anschließend werden psychologische, soziologische, biologische und religiöse Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten bei Jugendlichen und Heranwachsenden vorgestellt, bevor multifaktorielle Ansätze diskutiert werden.
2. Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten von Jugendlichen und Heranwachsenden: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene theoretische Perspektiven auf delinquentes Verhalten. Es werden psychologische Ansätze (psychoanalytische Theorien, Lerntheorien, Selbstkontrolle), soziologische Ansätze (Anomie, strukturelle Gewalt, Etikettierung, Subkulturen, Macht), biologische und religiöse Ansätze (Erbsünde) sowie multifaktorielle Ansätze detailliert untersucht und in ihren Stärken und Schwächen analysiert. Der Fokus liegt auf der Erklärung von jugendlicher Delinquenz durch die Integration verschiedener Faktoren und Perspektiven.
Schlüsselwörter
Delinquenz, Devianz, Kriminalität, Jugendkriminalität, Psychologische Theorien, Lerntheorien, Psychoanalyse, Soziologische Theorien, Anomie, Subkulturen, Etikettierung, Biologische Theorien, Religiöse Theorien, Multifaktorielle Theorien, Selbstkontrolle, Jugendgerichtsgesetz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten von Jugendlichen und Heranwachsenden
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Sie beleuchtet psychologische, soziologische, biologische und religiöse Perspektiven und diskutiert multifaktorielle Ansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung von Delinquenz, Devianz und Kriminalität. Es werden psychologische Erklärungsansätze (psychoanalytisch, lerntheoretisch, Selbstkontrolle), soziologische Ansätze (Anomie, strukturelle Gewalt, Etikettierung, Subkulturen, Macht), biologische und religiöse Ansätze (Erbsünde) sowie multifaktorielle Ansätze detailliert behandelt.
Welche psychologischen Theorien werden betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht psychoanalytische Erklärungsansätze, Lerntheorien und das Konzept der Selbstkontrolle nach Gottfredson/Hirschi (1990).
Welche soziologischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Diskussion soziologischer Ansätze wie Anomie, strukturelle Gewalt, Etikettierung, Subkulturen und Macht.
Wie werden biologische und religiöse Perspektiven berücksichtigt?
Biologische Ansätze und der religiöse Ansatz der Erbsünde werden ebenfalls in die Betrachtung miteinbezogen.
Welche Rolle spielen multifaktorielle Ansätze?
Die Hausarbeit legt einen Schwerpunkt auf multifaktorielle Ansätze, die delinquentes Verhalten durch die Integration verschiedener Faktoren und Perspektiven erklären.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, die Delinquenz, Devianz und Kriminalität definiert und abgrenzt. Das Hauptkapitel präsentiert und analysiert die verschiedenen Erklärungsansätze. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Delinquenz, Devianz, Kriminalität, Jugendkriminalität, Psychologische Theorien, Lerntheorien, Psychoanalyse, Soziologische Theorien, Anomie, Subkulturen, Etikettierung, Biologische Theorien, Religiöse Theorien, Multifaktorielle Theorien, Selbstkontrolle, Jugendgerichtsgesetz.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die Hausarbeit enthält eine Zusammenfassung der Kapitel, die die wichtigsten Inhalte der Einleitung und des Hauptkapitels über Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten zusammenfasst.
- Citar trabajo
- Antonia Anzenhofer (Autor), 2012, Erklärungsansätze für die Straffälligkeit von Jugendlichen und Heranwachsenden, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281578