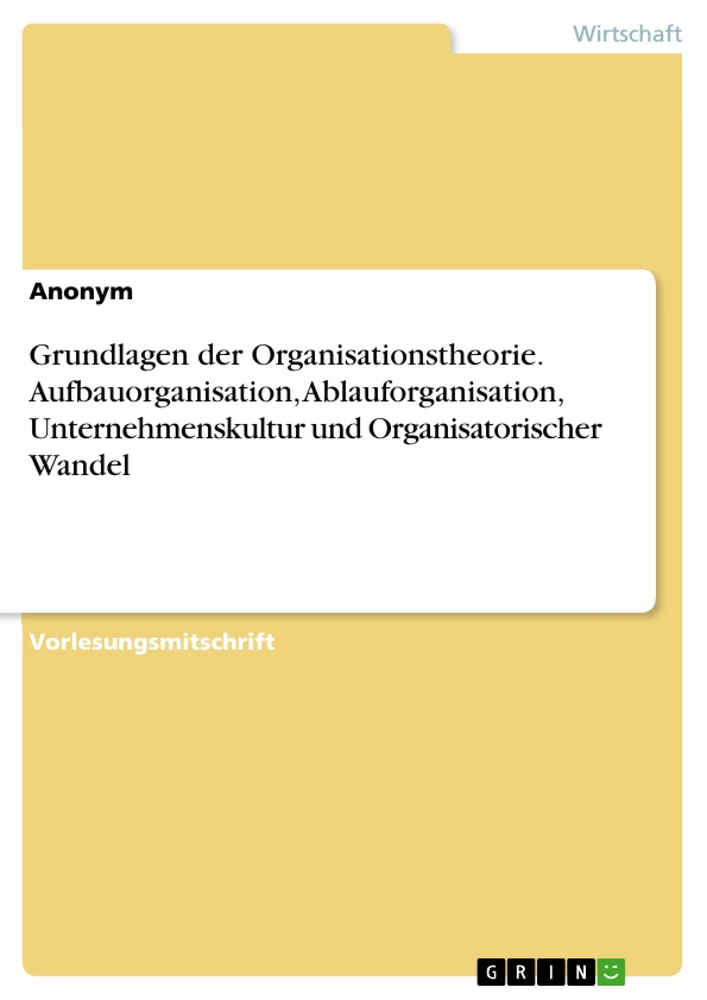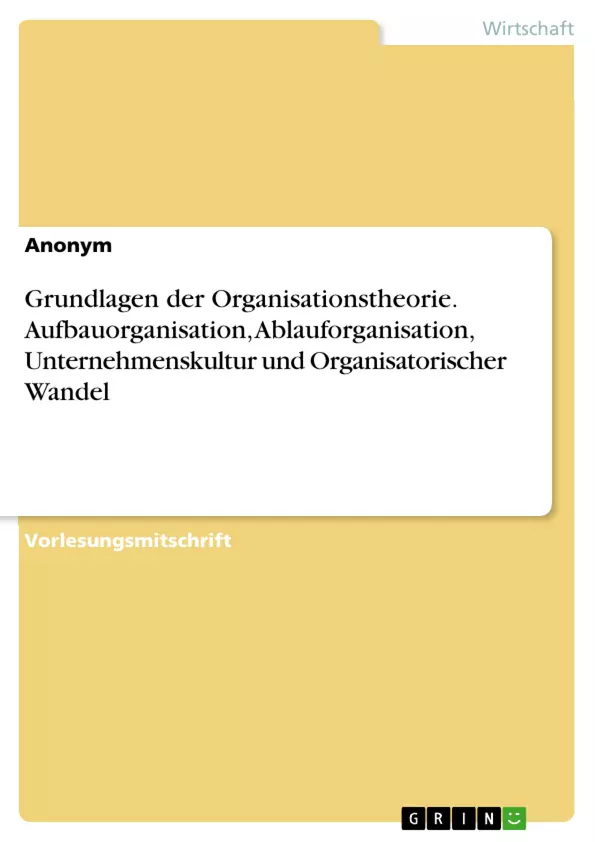Vorlesungsmitschrift zur Veranstaltung Organisation in Stichpunkten und kurzen Abschnitten. Aus dem Inhalt: Grundlagen der Organisationstheorie, Logik und Ziel formaler Organisationsregelungen, Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Unternehmenskultur, Organisatorischer Wandel, (...).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen der Organisationstheorie
- 1.1 Begriff der Organisation
- 1.1.1 Der instrumentelle Organisationsbegriff
- 1.1.2 Der institutionelle Organisationsbegriff
- 1.2 Logik und Ziel formaler Organisationsregelungen
- 1.3 Zentrale Regelungstatbestände der Organisationsgestaltung
- 1.4 Instrumentvariablen der Organisationsgestaltung
- 1.4.1 Spezialisierung
- 1.4.2 Koordination
- 1.4.3 Konfiguration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die Organisationstheorie. Er untersucht verschiedene Organisationsbegriffe, analysiert die Logik und Ziele formaler Organisationsregelungen und beleuchtet zentrale Gestaltungstatbestände. Der Fokus liegt auf der formalen Organisationsstruktur und den Instrumentvariablen ihrer Gestaltung.
- Instrumentelle und institutionelle Organisationsbegriffe
- Logik und Ziel formaler Organisationsregelungen
- Zentrale Regelungstatbestände der Organisationsgestaltung (generelle vs. fallweise Regelung, Regelungsdichte, formale und informale Regelungen)
- Instrumentvariablen der Organisationsgestaltung (Spezialisierung, Koordination, Konfiguration)
- Fremd- und Selbstorganisation in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlagen der Organisationstheorie: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis von Organisationen. Es differenziert zwischen dem instrumentellen Organisationsbegriff, der Organisation als Instrument der Führung betrachtet, und dem institutionellen Organisationsbegriff, der Organisation als eigenständige soziale Einheit sieht. Der instrumentelle Ansatz wird weiter unterteilt in Organisation als Tätigkeit (Gutenberg) und Organisation als Konfiguration (Kosiol), wobei die jeweiligen Unterschiede in der statischen vs. dynamischen Betrachtungsweise herausgearbeitet werden. Der institutionelle Ansatz beleuchtet die Zweckorientierung, geregelte Arbeitsteilung, eindeutige Grenzen und das Bestreben nach Selbsterhaltung als zentrale Merkmale von Organisationen. Die Kapitel legen somit die theoretischen Fundamente für die weitere Auseinandersetzung mit Organisationsgestaltung.
1.2 Logik und Ziel formaler Organisationsregelungen: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung von Routine und Standardisierung in Organisationen. Es wird die Philosophie der präsituativen Regelung eingeführt, die auf der Antizipation von Problemen und der Entwicklung dauerhaft gültiger Verhaltensvorschriften basiert. Die Koordinations-, Informations- und Motivationsfunktionen formaler Regelungen werden detailliert analysiert und ihre Bedeutung für die Gesamteffizienz der Organisation hervorgehoben. Der Aspekt der kontinuierlichen Pflege und Überprüfung von Regeln zur Aufrechterhaltung ihrer positiven Wirkung wird betont. Das Kapitel verdeutlicht, wie Regeln das Verhalten von Organisationsmitgliedern durch Information und Belohnung kanalisieren.
1.3 Zentrale Regelungstatbestände der Organisationsgestaltung: Dieses Kapitel untersucht drei zentrale Aspekte der Organisationsgestaltung: generelle versus fallweise Regelung (Gutenbergs Substitutionsgesetz), das Ausmaß der Regelungsdichte (organisatorischer Normierungsgrad) und die Interaktion von formalen und informalen Regelungen. Es wird erörtert, wie der optimale Regelungsgrad erreicht werden kann und wie organisatorische Regeln Verhalten vorhersagbar, effizient, nachvollziehbar und erfahrungsübertragbar machen sollen. Die Diskussion von formalen und informalen Regelungen und deren jeweiliger Bedeutung für die Organisation und ihre Dynamik ist hier zentral. Der Wandel der Perspektive auf Fremd- und Selbstorganisation wird als wichtiger Kontext dargestellt.
1.4 Instrumentvariablen der Organisationsgestaltung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Konzeptionalisierung von Organisationsstruktur und identifiziert fünf Dimensionen: Spezialisierung, Koordination und Konfiguration. Spezialisierung wird als Arbeitsteilung beschrieben, die Lern- und Übungseffekte bewirken soll, wobei Fragen nach Art und Tiefe der Spezialisierung diskutiert werden. Koordination wird als Abstimmung arbeitsteiliger Prozesse und Ausrichtung von Aktivitäten auf Organisationsziele definiert, wobei der Spannungsbogen zwischen Arbeitsteilung und Integration herausgearbeitet wird. Konfiguration wird als die äußere Form des organisationalen Stellengefüges beschrieben.
Schlüsselwörter
Organisationstheorie, Organisationsbegriff (instrumentell, institutionell), formale Regelungen, Organisationsgestaltung, Spezialisierung, Koordination, Konfiguration, Regelungsdichte, Fremdorganisation, Selbstorganisation, Gutenberg, Kosiol.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Grundlagen der Organisationstheorie"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Einführung in die Organisationstheorie. Er behandelt verschiedene Organisationsbegriffe, analysiert die Logik und Ziele formaler Organisationsregelungen und beleuchtet zentrale Gestaltungstatbestände. Der Fokus liegt auf der formalen Organisationsstruktur und den Instrumentvariablen ihrer Gestaltung. Der Text umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Organisationsbegriffe werden behandelt?
Der Text unterscheidet zwischen dem instrumentellen Organisationsbegriff (Organisation als Instrument der Führung) und dem institutionellen Organisationsbegriff (Organisation als eigenständige soziale Einheit). Der instrumentelle Ansatz wird weiter unterteilt nach Gutenberg (Organisation als Tätigkeit) und Kosiol (Organisation als Konfiguration). Der institutionelle Ansatz betont Zweckorientierung, geregelte Arbeitsteilung, eindeutige Grenzen und das Bestreben nach Selbsterhaltung.
Welche Aspekte der formalen Organisationsregelungen werden analysiert?
Der Text analysiert die Logik und Ziele formaler Organisationsregelungen, einschließlich der Bedeutung von Routine und Standardisierung. Die Koordinations-, Informations- und Motivationsfunktionen formaler Regelungen werden detailliert untersucht, ebenso wie die kontinuierliche Pflege und Überprüfung von Regeln. Die Kanalisierung des Verhaltens von Organisationsmitgliedern durch Information und Belohnung wird hervorgehoben.
Welche zentralen Regelungstatbestände der Organisationsgestaltung werden betrachtet?
Drei zentrale Aspekte werden behandelt: generelle versus fallweise Regelung (Gutenbergs Substitutionsgesetz), der organisatorische Normierungsgrad (Regelungsdichte) und die Interaktion von formalen und informalen Regelungen. Der Text erörtert den optimalen Regelungsgrad und wie organisatorische Regeln Verhalten vorhersagbar, effizient, nachvollziehbar und erfahrungsübertragbar machen sollen.
Welche Instrumentvariablen der Organisationsgestaltung werden diskutiert?
Der Text identifiziert drei zentrale Instrumentvariablen: Spezialisierung (Arbeitsteilung mit Lern- und Übungseffekten), Koordination (Abstimmung arbeitsteiliger Prozesse und Ausrichtung auf Organisationsziele) und Konfiguration (äußere Form des organisationalen Stellengefüges). Der Spannungsbogen zwischen Arbeitsteilung und Integration wird im Zusammenhang mit Koordination hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Organisationstheorie, Organisationsbegriff (instrumentell, institutionell), formale Regelungen, Organisationsgestaltung, Spezialisierung, Koordination, Konfiguration, Regelungsdichte, Fremdorganisation, Selbstorganisation, Gutenberg, Kosiol.
Welche Kapitel sind im Text enthalten?
Der Text umfasst ein Kapitel "Grundlagen der Organisationstheorie" mit den Unterkapiteln 1.1 Begriff der Organisation (1.1.1 instrumentell, 1.1.2 institutionell), 1.2 Logik und Ziel formaler Organisationsregelungen, 1.3 Zentrale Regelungstatbestände der Organisationsgestaltung und 1.4 Instrumentvariablen der Organisationsgestaltung (1.4.1 Spezialisierung, 1.4.2 Koordination, 1.4.3 Konfiguration).
Wer sind Gutenberg und Kosiol?
Gutenberg und Kosiol sind bedeutende Autoren im Bereich der Organisationstheorie, deren Ansätze und Konzepte im Text diskutiert werden. Gutenberg wird im Zusammenhang mit dem instrumentellen Organisationsbegriff und dem Substitutionsgesetz erwähnt, während Kosiol's Beitrag zur Konfiguration von Organisationen behandelt wird.
Worum geht es in der Diskussion von Fremd- und Selbstorganisation?
Die Diskussion von Fremd- und Selbstorganisation beleuchtet den Wandel der Perspektive auf die Steuerung von Prozessen innerhalb von Organisationen. Es wird der Unterschied zwischen der Steuerung durch formale Regeln (Fremdorganisation) und der Eigenregulierung durch die Mitglieder der Organisation (Selbstorganisation) betrachtet.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2006, Grundlagen der Organisationstheorie. Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Unternehmenskultur und Organisatorischer Wandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281580