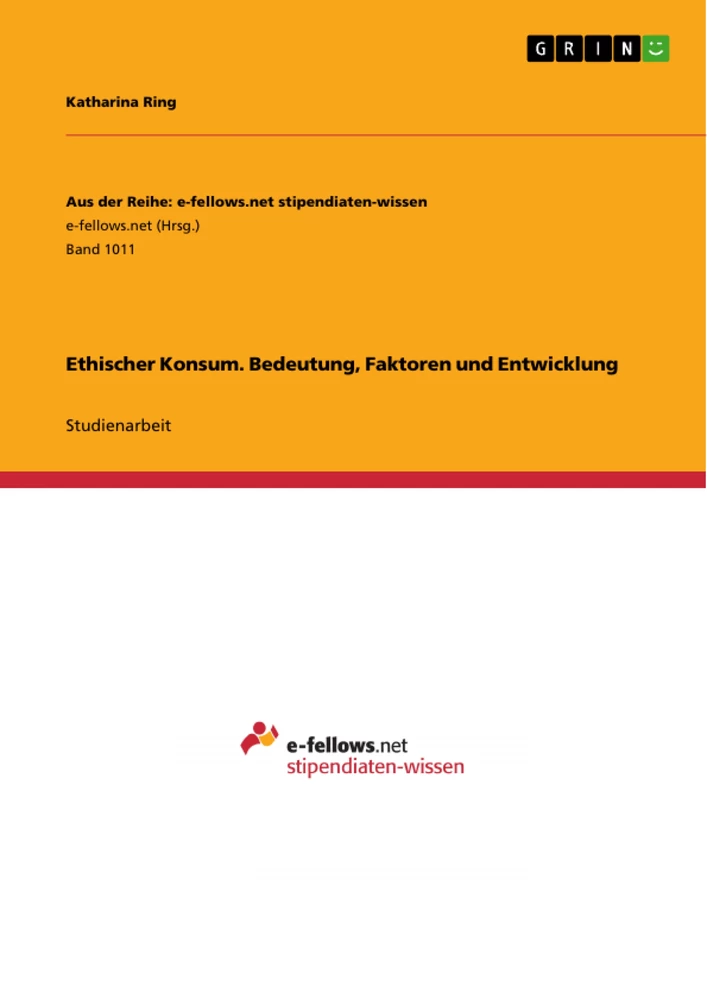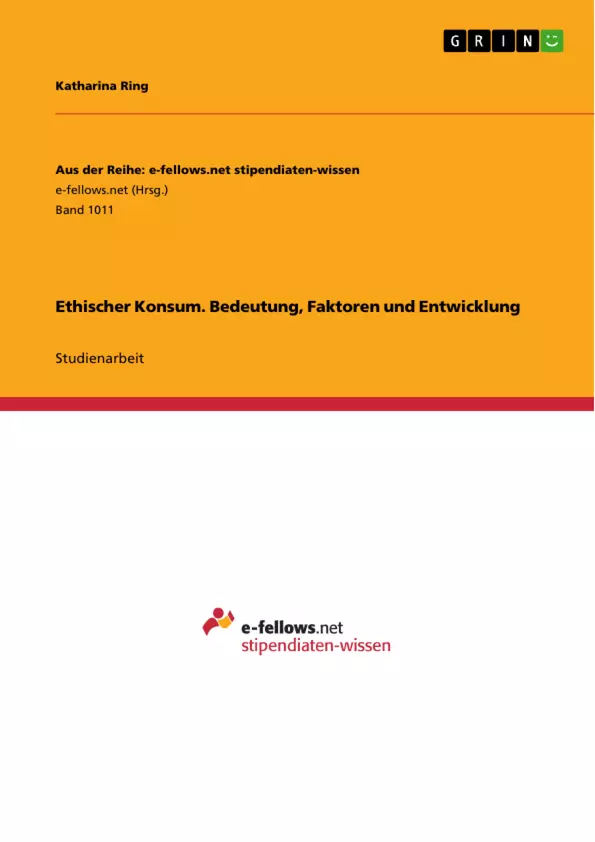Nachdem in den 80er Jahren die Gesundheit ein wichtiger Aspekt des Konsums wurde, entwickelte sich im Laufe der Bio-Bewegung der ethische Konsum, bei dem auch ökologische und tierrechtliche Auswirkungen des Güterverbrauchs in die Kaufentscheidung aufgenommen wurden. Auch der faire Handel gewann im Zuge dieser Strömung an Bedeutung.
Neben der Debatte über die Sinnhaftigkeit von verantwortungsvollem Konsum, zeigt die Empirie eine weitere Problemstellung der Konsumentenverantwortung auf. So deckte 2005 eine Studie von Futerra auf, dass nur 30% der Konsumenten bereit sind ethisch zu kaufen. Desweiteren setzen nur 3% aller Konsumenten diese Bereitschaft auch tatsächlich um.
Inhaltsverzeichnis
- Eine kritische Beleuchtung des ethischen Konsums
- Identifizierung der Einflussfaktoren auf ethisches Konsumverhalten
- Einflussfaktoren auf die generelle Bereitschaft
- Einflussfaktoren auf die Umsetzung der Absicht
- Synthese zu einem holistisches Modell
- Beispielhafte Entwicklungsprognose des ethischen Konsumverhaltens
- Zusammenfassung und zukünftige Bedeutung des ethischen Konsums
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem ethischen Konsum und analysiert die Faktoren, die das Konsumverhalten beeinflussen. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das die zukünftige Entwicklung des ethischen Konsums prognostiziert. Dabei werden die generelle Bereitschaft zum ethischen Konsum und die Umsetzung der Absicht in das tatsächliche Kaufverhalten untersucht.
- Einflussfaktoren auf die generelle Bereitschaft zum ethischen Konsum
- Einflussfaktoren auf die Umsetzung der Absicht in das tatsächliche Kaufverhalten
- Entwicklungsprognose des ethischen Konsums
- Zukünftige Bedeutung des ethischen Konsums
- Kritik am ethischen Konsum
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den ethischen Konsum und seine Entwicklung im Kontext der Bio-Bewegung und des fairen Handels. Es werden kritische Stimmen zum ethischen Konsum und dessen Einfluss auf das Gesamtergebnis diskutiert. Das zweite Kapitel identifiziert die Einflussfaktoren auf das ethische Konsumverhalten, unterteilt in die generelle Bereitschaft und die Umsetzung der Absicht. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt, die die Faktoren des ethischen Konsums erklären. Das dritte Kapitel präsentiert eine beispielhafte Entwicklungsprognose des ethischen Konsums, indem es den Einfluss von digitaler Technologie und dem familiären Umfeld auf das Konsumverhalten untersucht. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und beleuchtet die zukünftige Bedeutung des ethischen Konsums.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den ethischen Konsum, die Einflussfaktoren auf das Konsumverhalten, die generelle Bereitschaft zum ethischen Konsum, die Umsetzung der Absicht in das tatsächliche Kaufverhalten, die Entwicklungsprognose des ethischen Konsums, die zukünftige Bedeutung des ethischen Konsums und die Kritik am ethischen Konsum.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter ethischem Konsum?
Ethischer Konsum bedeutet, ökologische, tierrechtliche und soziale Aspekte (wie fairen Handel) in die Kaufentscheidung einzubeziehen.
Wie viele Konsumenten kaufen tatsächlich ethisch ein?
Obwohl laut Studien 30% der Konsumenten bereit wären ethisch zu kaufen, setzen dies in der Realität nur etwa 3% tatsächlich um.
Welche Faktoren beeinflussen die Bereitschaft zum ethischen Kauf?
Die Arbeit untersucht Einflussfaktoren wie das familiäre Umfeld, digitale Technologien und die generelle Einstellung zur Verantwortung.
Welche Rolle spielte die Bio-Bewegung?
Die Bio-Bewegung der 80er Jahre legte den Grundstein für den heutigen ethischen Konsum, indem sie Gesundheit und Ökologie in den Fokus rückte.
Wie sieht die Zukunftsprognose für ethischen Konsum aus?
Die Arbeit entwickelt ein holistisches Modell, um vorherzusagen, wie sich ethisches Konsumverhalten unter Berücksichtigung neuer Technologien weiterentwickeln wird.
- Arbeit zitieren
- Katharina Ring (Autor:in), 2014, Ethischer Konsum. Bedeutung, Faktoren und Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281590