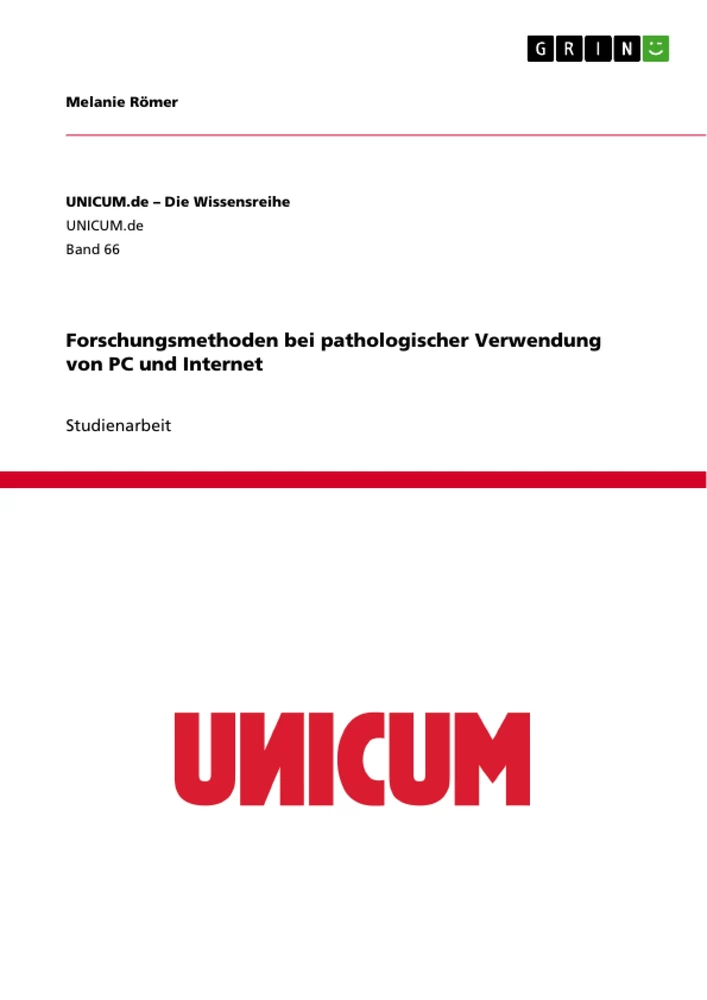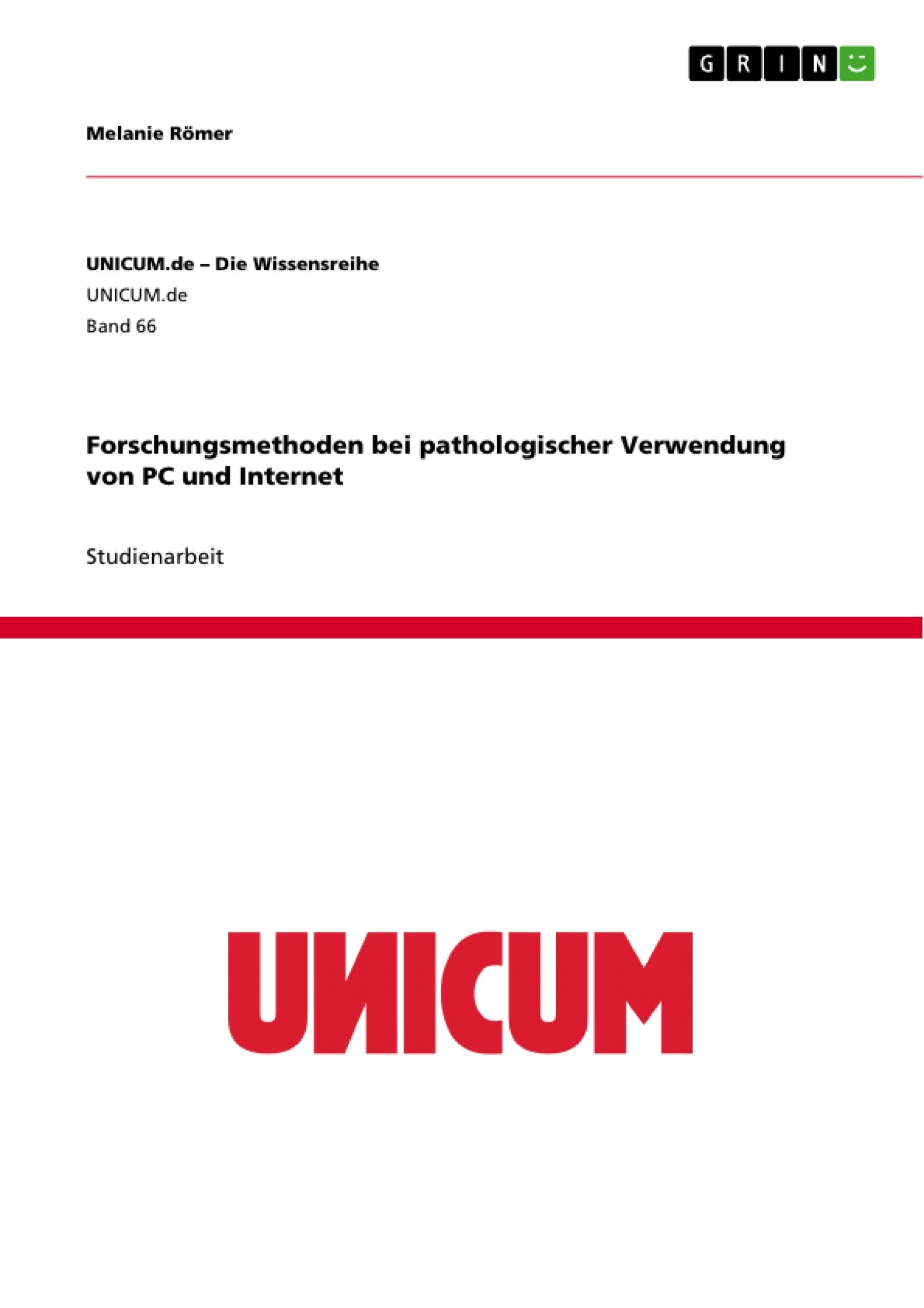Personen, die unter dem Störungsbild des pathologischen PC-/Internetgebrauchs leiden, fallen besonders durch ihren niedrigen Selbstwert, ihre Depressivität, ihre Ängstlichkeit und die mangelnde Kompetenz zu sozialen Beziehungen (im echten Leben) auf. Angesichts der rasant wachsenden Zahl der PC- und Internetnutzer, die auch immer jünger werden, ist es höchste Zeit, sich diesem Themenbereich intensiv zu widmen. Sollte nachgewiesen werden können, dass die Bindungserfahrungen in der Kindheit entscheidend sind, könnte dies Eltern, Therapeuten und Patienten helfen. Einerseits könnte man schon in Kindergärten gezielt auf solche Defizite achten und Therapeuten einschalten, was ohnehin (auch im Bezug auf andere Störungsbilder) sinnvoll wäre und andererseits könnte man in der Therapie der bereits erkrankten Personen speziell an diesem Punkt ansetzen. Mit dieser Erkenntnis wäre ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Ätiologie dieses Krankheitsbildes geleistet. In dieser Ausarbeitung werden daher sowohl ein qualitatives als auch ein quantitatives Design vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Theoretischer Hintergrund
- Design 1 (qualitativ orientiert)
- Begründung, Ablaufschritte
- Stichprobe
- Erhebungsmethode (Beschreibung, Begründung, Beispiele)
- Auswertungsmethoden
- Mögliche Ergebnisse
- Design 2 (quantitativ orientiert)
- Begründung, Ablaufschritte
- Stichprobe
- Erhebungsmethode
- Auswertungsmethode
- Mögliche Ergebnisse
- Vergleich der beiden Designs
- Mögliche Schlussfolgerungen, Konsequenzen für die Praxis
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen einem unsicheren Bindungsmuster und der Entwicklung eines dysfunktionalen/pathologischen PC-/Internetgebrauchs besteht. Die Arbeit analysiert die Entstehung und die möglichen Ursachen des pathologischen PC-/Internetgebrauchs, wobei der Fokus auf der Rolle von Bindungserfahrungen in der Kindheit liegt.
- Bindungsmuster und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung
- Pathologischer PC-/Internetgebrauch als Störungsbild
- Mögliche Ursachen und Risikofaktoren für die Entwicklung des Störungsbildes
- Zusammenhang zwischen Bindungserfahrungen und PC-/Internetgebrauch
- Methoden zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Bindung und PC-/Internetgebrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Es wird erläutert, warum der pathologische PC-/Internetgebrauch als ein relevantes Thema betrachtet werden sollte und welche Besonderheiten dieses Mediums im Vergleich zu anderen Medien ausmachen.
Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Arbeit, insbesondere die Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth. Es werden die verschiedenen Bindungsmuster und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Menschen beschrieben.
Das dritte Kapitel beschreibt das erste Forschungsdesign, welches eine qualitative Kausalanalyse mit einer deskriptiven Fallanalyse beinhaltet. Es werden die Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie die Auswahl der Stichprobe erläutert.
Das vierte Kapitel stellt das zweite Forschungsdesign vor, welches eine quantitative Untersuchung beinhaltet. Es werden die Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie die Auswahl der Stichprobe erläutert.
Das fünfte Kapitel vergleicht die beiden Forschungsdesigns und diskutiert die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden.
Das sechste Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der beiden Forschungsdesigns und diskutiert die Konsequenzen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den pathologischen PC-/Internetgebrauch, Bindungsmuster, Bindungstheorie, Kindheitserfahrungen, psychische Störungen, qualitative und quantitative Forschungsmethoden, Fallanalyse, Datenerhebung und -auswertung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Merkmale zeigen Personen mit pathologischem PC-Gebrauch?
Betroffene leiden oft unter niedrigem Selbstwert, Depressivität, Ängstlichkeit und mangelnder Kompetenz in realen sozialen Beziehungen.
Welchen Einfluss haben Bindungserfahrungen in der Kindheit?
Die Forschung vermutet, dass unsichere Bindungsmuster (nach Bowlby und Ainsworth) ein Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer Internetsucht sein können.
Welche Forschungsmethoden werden zur Untersuchung vorgeschlagen?
Es werden sowohl qualitative (z. B. Fallanalysen) als auch quantitative Designs (statistische Erhebungen) vorgestellt.
Warum ist die Erforschung dieses Themas heute so wichtig?
Da Internetnutzer immer jünger werden, ist ein Verständnis der Ätiologie (Ursachen) entscheidend für Prävention in Kindergärten und gezielte Therapien.
Was ist das Ziel der vorgestellten Studie?
Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen frühkindlichen Bindungsmustern und dysfunktionalem PC-Gebrauch wissenschaftlich nachzuweisen.
- Citar trabajo
- Bachelor of Science Melanie Römer (Autor), 2011, Forschungsmethoden bei pathologischer Verwendung von PC und Internet, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281766